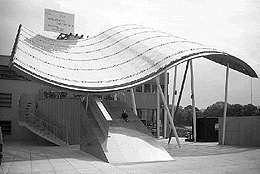Details
- Adresse
- Museumsplatz 1, 1070 Wien, Österreich
- Architektur
- O&O Baukunst (Laurids Ortner, Manfred Ortner, Christian Lichtenwagner), Manfred Wehdorn
- Mitarbeit Architektur Manfred Wehdorn
- Alfred Pleyer (PL), Michael Wistawel (PL), Gerhard Abel, Nathalie Arzt, Walter Beer, Marc Berutto, Rosa Borscova, Margarete Dietrich, Mona El Khafif, Mehmet Even, Angela Hareiter, Roswitha Kauer, Helmut Kirchhofer, Martina Küng, Leszek Liszka, Harald Lutz, Heimo Math, Judith May, Karl Meinhart, Richard Messner, Christian Nuhsbaumer, Eva Maria Rebholz, Georg Smolle, Szczepan Sommer, Wolfgang Steininger, Philipp Tiller, Michael Wildmann, Melih Yerlikaya, Josef Zapletal
- Bauherrschaft
- Stadt Wien, MUQUA Errichtungs- und Betriebs GmbH, Republik Österreich
- Tragwerksplanung
- FCP
- Fotografie
- Rupert Steiner, Gerald Zugmann
- Weitere Konsulent:innen
- Heizung, Klima, Lüftung, Sanitär, Elektro, Fördertechnik: Austroconsult, Wien
Bodengutachten: Erik Würger, Wien
Geometer: Harald Meixner, Wien
Licht-Planung: Kress & Adams, Köln
Bauphysik, Bauakustik: Büro Pfeiler GmbH., Graz; Quiring Consulting, Innsbruck
- Maßnahme
- Neubau
- Funktion
- Museen und Ausstellungsgebäude
- Planung
- 1990
- Ausführung
- 1998 - 2001
Archfoto
Karte
Presseschau
Wenigstens ein Grenzwächter?
Das Museumsquartier ist in Wien als Rufzeichen und Verwunderungskammer für die Kunst etabliert. Das intendierte Stadtstück ist es noch lange nicht, eher eine Kulturinsel, deren Festlandverbindungen nicht regelmäßig verkehren. Anmerkungen zu einem vergessenen Fahrplan.
Zufallspassanten sind erregt, selbst Lagekenner überrascht: Plötzlich temporäre Kunst als ermunternde Einladung vor dem Museumsquartier? Vorzeichen verschärfter öffentlicher Raumwahrnehmung auf einem so ganz und gar nicht hauptstädtisch genutzten Hauptkulturgelände der Republik? Gar der Beginn einer permanenten Schau- und Begegnungszone am wichtigsten österreichischen Museumsplatz?
Bisher leistet er aber als prominente Innenstadtbrache mit baukünstlerisch gut kaschiertem Garagenüberbrückungscharakter nicht viel mehr, als glattes Auf- und Abmarschgelände der Kunstinteressierten zu sein. Das Sempersche Kaiserforum hat keine adäquate räumliche Fortsetzung gefunden. Zur Langfassade von Fischer von Erlach hat sich mangels rechtzeitiger argumentativer Klärung vor der Fertigstellung des Museumsquartiers stadtplanerisch und denkmalpflegerisch nur der Fluchtbegriff „freihalten“ finden lassen.
Das Museumsquartier endet zentrumsseitig auch ein Dutzend Jahre nach dem Wettbewerbs entscheid als Wirkungseinheit an der barocken Fassadenflucht. Hier verläuft noch immer eine Interessengrenze der Betreiber, hier scheiden sich die Interventionsgeister der betroffenen Körperschaften, hier türmen sich wilde Angstpotentiale auf einem touristisch fetten Nährboden, genannt Weltkulturerbe. Könnte als Minimalziel zur urbanistischen Aufrüstung des Vorlandes, fragen sich viele Fachleute, nicht wenigstens ein architektonischer Grenzwächter errichtet werden, der die Sinne mit der Zeit so weit schärft und die Zweifel so weit schwächt, bis eines Tages architektonische Grenzverächter, die man mit den 1987 vorgestellten Wettbewerbsprojekten von Ceska/Hofstätter/Pauzenberger, Riegler/Riewe oder Turnovsky/Hauser noch in inspirierender Erinnerung hat, an ihre Stelle treten können?
Vorerst täuschen große Werbeankündigungen, Leuchtstelen im Raster, Lichtdeckel für die U-Bahn, die zuwenig tief errichtete Garage, Fahrrampen, Stationszugänge, Restrasen, Strauchfallen, eine wohl nach Blattflächenverlust bei der Rodung und nicht nach räumlichem Kalkül gesetzte Alibi-Allee et cetera über den dysfunktionalen Zwischenraum inmitten städtebaulich starker, aber hier nie ganz in kontrollierte Berührung gekommener Baueinheiten der Stadt hinweg. Die derzeitige Installation weißer Igluteile aus Hartschaumkörpern, die zum letztjährigen Weihnachtspunschhütten-Projekt der Architekten Anna Popelka und Georg Poduschka im Museumsquartier gehören, macht eindrücklich Dimension und Bedeutung des scheinbar von Investoren und Politik in seinem Potential übersehenen Stadtraumes bewußt.
Auch wenn die serielle Skulptur von PPAG kommentarlos und nur teilweise das Vorfeld des Museumsquartiers zwischen der auf die Hofmuseen bezogenen Mittelachse und der Mariahilfer Straße besetzt, ihre Stellung und Wirkung zeigt eine schon seit der Wettbewerbsauslobung nicht mehr hart angerissene Problematik auf. Die nun dominierenden städtebaulichen Alleinstellungsmerkmale des Museumsquartiers entsprechen weder der Intention des Bauherrn noch dem Siegerprojekt von Laurids und Manfred Ortner im internationalen Wettbewerb. Vielmehr haben mediale Diffamierung und postwendende politische Redimensionierung bewirkt, daß sich die Bauten hinter dem barocken Rahmen ducken mußten.
Die „Krone“, die sich der dem Ortner-Projekt immanenten lokalen Stadtkrone erfolgreich widersetzte, und ihre ideologischen Zulieferer werden nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden können. Aber auch diese Kräfte werden noch erleben müssen, wie Bürger und Architekturinstanzen die Oberhand gegenüber ihrer Angst vor dem besseren Neuen gewinnen. Zubauten werden das Museumsquartier vervollständigen und dem ursprünglichem Gehalt etwas näher bringen.
Die Ideenkonkurrenz hatte klare Prämissen und ebenso eindeutige Ergebnisse, die in der Projektrealisierung verwässert wurden. In der ersten Phase des Architektenwettbewerbes „Messepalast“ im Areal der ehemaligen Hofstallungen war der städtebauliche Rahmen nicht zu eng gespannt: „Das Wettbewerbsgebiet umfaßt das Areal des ,Messepalasts' einschließlich der als ,Messeplatz' bezeichneten Freifläche. Unter der sich die ,Messeplatzgarage' befindet. Das Wettbewerbsgebiet liegt unmittelbar hinter den beiden großen Museen an der Ringstraße, den Anschluß des geschlossenen, historisch gewachsenen Baugebiets des 7. Gemeindebezirks bildend und südlich und nördlich von der Mariahilfer Straße und der Burggasse als Radialstraße begrenzt. Das Wettbewerbsgebiet ist somit zentral im Stadtgebiet gelegen.“ Die Ausschreibung zur zweiten Phase bestätigte das: „Die Gestaltung des gesamten ,Vorfeldes' wird als wesentliche Aufgabe des Wettbewerbes betrachtet.“
Das Juryprotokoll der zweiten Wettbewerbsstufe vom November 1990 stellte als bestärkende Eigenschaft des Siegerprojekts der Gebrüder Ortner fest: „Der Entwurf geht nun von dem Gedanken aus, das Areal des Messepalastes sei von einer ,Stadtmauer' umfriedet, unterstreicht aber mit der Vielfalt der Zugänge die funktionelle Verflechtung mit dem Stadtraum in optimaler Weise. Konsequenterweise wird im Bereich ,Vorplatz Mariahilfer Straße' der Zugang ins Areal als Unterführung des Fischer-von-Erlach-Baues gesucht. Die Aufteilung des Medienforums auf drei voneinander getrennte Baukörper, von denen sich einer außerhalb der ,Stadtmauer' befindet, entspricht der Auslobung, da es sich um verwaltungsmäßig getrennte Einheiten handelt.“
Das Siegerprojekt zeigt einen quaderförmigen Baukörper parallel zur Lastenstraße, teilweise die Garage überbauend, aber über einen tiefergelegten Hof die Vorlandnutzung in das Quartierinnere ziehend. Die Höhe dieses Baukörpers und seine Stellung orientieren sich an der Traufe und den Fassadenfluchten des Kunsthistorischen Museums, zumindest ein möglicher städtebaulicher Anhaltspunkt. Das Vorfeld ist mit Baureihen und Bodenbelägen grob in rektanguläre Felder in der Ordnung des Kaiserforums gegliedert, vor Fischers Mitteltrakt einen Bereich offen haltend. In den Überarbeitungen verkleinert sich das Medienhaus immer weiter, bis es 1992 aus dem Projekt verschwindet. 1999 steht wieder ein Medienkubus im Entwurf, allerdings nach Süden von der Tiefgarage und dem Grundeigentum der Republik Österreich abgerückt, zur Gänze auf dem als Park gewidmeten Boden der Stadt Wien nahe der U2-Station Mariahilfer Straße. Erst die absehbare Fertigstellung des Museumsquartiers und das Insistieren von Ortner & Ortner auf einer Gesamtlösung im Sinne des von ihnen zur Gänze, inklusive Vorplatzarrondierung- und -bebauung gewonnenen, aber dann von der Errichtungsgesellschaft nie zur Gänze zugeschlagenen Auftrags bringt also konkrete politische und behördliche Überlegungen zum Vorplatz in Gang.
Die Stadt Wien läßt Ortner & Ortner Entwurfsoptionen für das Vorfeld untersuchen, zugleich versuchen die Architekten Investoren von dem Standort zu überzeugen. Die großen Chancen des trapezförmigen Gebiets werden freilich erst bei der Rodung erkennbar. Eine Installation aus einer Parallelschar in grellem Orange gehaltener Netze von „Querkraft Architekten“ erweckt für die Öffentlichkeit erstmals die räumliche Brisanz des Vorgeländes. In einer profunden städtebaulichen Studie für die Magistratsabteilung 19 stellen Erich Raith und Reinhardt Gallister im Sommer 2000 klar, daß die Mariahilfer Ecke eine auf mehrere Arten architektonisch gut bespielbare, städtebaulich vielfältig determinierte und auch mit Gewinn determinierbare Situation darstellt. Eine der drei von ihnen überprüften und für tauglich befundenen Bebauungsoptionen, der Solitär, wird freilich gleichzeitig von Ortner & Ortner schon mit der BAWAG als „Designcenter“ ventiliert.
Obwohl das um neunzig Grad verwundene Ellipsoid für das „Designcenter“ die städtebaulichen Determinanten als autonomes Stück, als alle stadtgeometrischen Anfechtungen weitgehend abweisende Signalarchitektur erfüllte, scheiterte das Projekt am Kleingedruckten. Das Angebot der Stadt, auf bestehendem Grünland auf zehn Jahre ein ephemeres Objekt zu erstellen, erschien der Bank pragmatisch zuwenig fundiert. Eine neue Flächenwidmung war wegen der öffentlichen Ansprüche an jede private Nutzung an diesem prominenten Ort zeitlich zu aufwendig; zudem stimmte wohl die entscheidende Dreiecks-Chemie zwischen Architekt, Investor und Stadt nicht ganz. Das soll kein böses Omen sein: Der Standort ist heiß, kombinierte kunst-, kultur- oder wissenschaftsbezogene Nutzungen zeichnen sich mehrfach ab, der stadtpolitische Wille steht keinem beherzten Investor und auch keiner Institution entgegen.
Wer es ernsthaft wagt, diesen vergessenen Fahrplan aufzuschlagen, dem ist eine direkte Fahrt zu architektonischen und somit medialen Weltwirkungen sicher. Im übrigen ist dieser Ansporn Hans Dichand als Himmelshüter über sämtlichen Hofstallungen anläßlich seines Ausscheidens aus dem aktiven Berufsleben gewidmet, das ihm nun endlich erlauben könnte, im Rahmen einer Honorarprofessur für Populistik im Städtebau seine urbanistischen Argumente auf akademischem Boden prüfen zu lassen.
Neue Suche nach einem Wahrzeichen
Hochfliegende Pläne fürs Museumsquartier
Hinweis: Dieser Artikel ist durch die Umstellung des Standard-Archivs derzeit leider nicht zugänglich.
Mangelkubus
Umbau des Mumok Wien
Zum vollständigen Artikel im „Neue Zürcher Zeitung“ Archiv ↗
Adaptierung im Basaltblock
Das Mumok wird seinem Neubetrieb im MQ gemäß zurechtgeschliffen
Hinweis: Dieser Artikel ist durch die Umstellung des Standard-Archivs derzeit leider nicht zugänglich.
Das Haus eines Sammlers
Am Samstag öffnet das Leopold-Museum im Wiener Museumsquartier. Es dokumentiert Werke der österreichischen Kunst des 20. Jahrhunderts.
Zum vollständigen Artikel im „Salzburger Nachrichten“ Archiv ↗
Eröffnung, die zweite
Erstmals in seiner Geschichte ist die Sammlung des Museums Moderner Kunst unter einem Dach zu sehen sein. Am Samstag wurde die Sammlung eröffnet.
Zum vollständigen Artikel im „ORF.at“ Archiv ↗
Die Moderne hat eine Heimstatt
Am Samstag wird im Wiener Museumsquartier das basaltgraue Museum moderner Kunst der Architekten Ortner & Ortner feierlich eröffnet.
Zum vollständigen Artikel im „Salzburger Nachrichten“ Archiv ↗
Rosa Automaten gegen die Schwere
Einen Architekturführer durch das MQ, den ersten und einzigen, kann man ab heute aus vier Spendern am Museumsareal ziehen.
Zum vollständigen Artikel im „Die Presse“ Archiv ↗
Die Demokratie ist der schlechteste Architekt
Das neue Museumsquartier in Wien ist ein einzigartiges Projekt - und ein erschütterndes Beispiel für den Mangel an architektonischer Zivilcourage.
Zum vollständigen Artikel im „TagesAnzeiger“ Archiv ↗
„Das ist Architektur vom Feinsten!“
Architekt Laurids Ortner zeigt sich von Kritik am MQ unbeeindruckt und ist stolz auf seine „subversive Klassik“.
Zum vollständigen Artikel im „Die Presse“ Archiv ↗
Endgültig eröffnet
Nach mehreren Eröffnungen von Teilen des Wiener Museumsquartiers zieht heute, Freitag, Bundespräsident Klestil die Summe der Eröffnungen.
Zum vollständigen Artikel im „Salzburger Nachrichten“ Archiv ↗
MQ: Operation gelungen, Patient tot
21 Jahre hat es gedauert, bis das Wiener Museumsquartier fertig geworden ist.
Zum vollständigen Artikel im „Kurier“ Archiv ↗
Amnestie für die Realität
Den Originalbeitrag von Matthias Boeckl zur Planungsphilosophie von Ortner & Ortner finden Sie in architektur aktuell.
Zum vollständigen Artikel im „ORF.at“ Archiv ↗
Und ewig lockt der Turm
Nach Jahren erbitterter Diskussionen und mehreren Konzept-Korrekturen wird das Wiener Museumsquartier nun eröffnet.
Zum vollständigen Artikel im „ORF.at“ Archiv ↗
Zufallsergebnis oder geplante Vielfalt?
Den Originalbeitrag von Dieter Bogner zum Konzept des MuseumsQuartiers finden Sie in der aktuellen Ausgabe von architektur aktuell.
Zum vollständigen Artikel im „ORF.at“ Archiv ↗
Der Nutzungsmix
Museumsquartier Wien
Hinweis: Dieser Artikel ist durch die Umstellung des Standard-Archivs derzeit leider nicht zugänglich.
Baustelle betreten erlaubt!
Das Wiener Museumsquartier der Architekten Ortner & Ortner und Manfred Wehdorn ist noch nicht fertig gestellt, wird aber sicherheitshalber eröffnet. Bereits jetzt steht fest: Bevor das alte Gemäuer mit dem Neuen die Ehe vollziehen konnte, sind beide aneinander verstorben.
Hinweis: Dieser Artikel ist durch die Umstellung des Standard-Archivs derzeit leider nicht zugänglich.
Architekturzentrum
Zu Beginn, im Jahr 1993, war alles noch ziemlich improvisiert, doch sehr rasch etablierte sich das Architektur Zentrum Wien (AZW) samt seinem Chef und Vordenker Dietmar Steiner zur quirligsten Architekturinstitution der Bundeshauptstadt.
Hinweis: Dieser Artikel ist durch die Umstellung des Standard-Archivs derzeit leider nicht zugänglich.
Museumsquartier Wien (6)
Das Denkmalamt gibt grünes Licht
Hinweis: Dieser Artikel ist durch die Umstellung des Standard-Archivs derzeit leider nicht zugänglich.
Eine Chronologie: Museumsquartier (5)
Die dritte Redimensionierung
Hinweis: Dieser Artikel ist durch die Umstellung des Standard-Archivs derzeit leider nicht zugänglich.
Der Gartenzwerg
Museumsquartier Wien
Hinweis: Dieser Artikel ist durch die Umstellung des Standard-Archivs derzeit leider nicht zugänglich.
Eine Chronologie: Museumsquartier (4)
Gegenmodell Guggenheim
Hinweis: Dieser Artikel ist durch die Umstellung des Standard-Archivs derzeit leider nicht zugänglich.
Die Junktimierung
Museumsquartier Wien
Hinweis: Dieser Artikel ist durch die Umstellung des Standard-Archivs derzeit leider nicht zugänglich.
Eine Chronologie: Museumsquartier (3)
Die ersten Verzögerungen
Hinweis: Dieser Artikel ist durch die Umstellung des Standard-Archivs derzeit leider nicht zugänglich.
Der „Kulturreaktor“
Museumsquartier Wien
Hinweis: Dieser Artikel ist durch die Umstellung des Standard-Archivs derzeit leider nicht zugänglich.
Es hätte schlimmer kommen können
Fast zwei Dutzend Jahre benötigte die Republik im heftigen Infight mit „Kronen Zeitung“ und Stadt Wien, um von der Idee eines zeitgenössischen Kulturbezirks zu dessen baulicher Realisierung zu gelangen. Noch stehen die meisten Neubauten stumm, aus Steinen ohne was herum und harren ihrer Bespielung. Zur Eröffnung des Museumsquartiers: ein kritischer Rundgang.
Das meiste ist bekannt. Unendlich langes Gezerre im Vorfeld. Intrigenspiele, Schach- und Winkelzüge sowie Kompromisse gäben Stoff für mehrere Tragikomödien - doch wir sind in Wien, wo derlei Alltag ist. Die Architekten Ortner & Ortner, Gewinner des Wettbewerbs, planten jedenfalls mehr als einmal um. Doch seit 1995 stand das städtebauliche Konzept in großen Zügen fest - Präzisierungen im Detail wie immer vorbehalten -, und heute ziehen sich die Bautruppen unter Hinterlassung der üblichen Rückstände mehr oder weniger geordnet zurück.
Der Blick vom Burgtor offenbart einiges: Hinter dem pfirsichrosa leuchtenden Prospekt der ehemaligen Hofstallungen des Johann Bernhard Fischer von Erlach, wie sie halt nach Kriegszerstörungen im frühen 19. Jahrhundert und amtlicher Wiederherstellung nach Beschädigungen im Revolutionsjahr 1848 ins 20. Jahrhundert gedämmert sind, wächst rechter Hand eine dunkle Wölbung über den langen First, die sich vor der hohen Häuserzeile an der Breiten Gasse deutlich abhebt. Linker Hand schiebt sich, bloß schwach erkennbar, ein heller Baukörper unter die lagerhafte Attikabebauung über der Karl-Schweighofer-Gasse. Und seit über einem halben Jahrhundert darf der Flakturm in der Stiftskaserne die Blickachse dominieren.
Der schwache Kompromiß aus der Forderung der Neugläubigen, daß sich die Neubauten über den niederen Altbestand hinaus zeichenhaft manifestieren dürften und auch sollten, und der Reaktion der Altgläubigen, daß dies keinesfalls geschehen dürfe, hat ein eklatantes Ungleichgewicht hinterlassen. Kein Wunder in einem kulturpolitischen Klima, das von allen möglichen Seiten permanent und wider bessere Erkenntnis vergiftet wurde. Einem Klima, in dem sich Kontrahenten gegenseitig selbst die Eiterzähne neiden, wie man weiter westlich zu sagen pflegt. Allein die nüchterne Chronologie der Ereignisse mit den Schlagzeilen der Gehsteigpresse, zusammengestellt von Architekturzentrum und Museumsquartier, spricht Bände (siehe „hintergrund Nr. 11“, eine Publikation des Architekturzentrums Wien).
Nun, es hätte schlimmer kommen können. Einmal durch den Haupteingang spaziert, in den vorläufig Mittelhof genannten, zentralen Außenraum - es wird sich nächstens gewiß der Name eines verdienten (Kultur-)Politikers des Volkes finden, nach dem er dann benannt wird -, steht man also auf einem geräumigen Platz, erblickt zur Linken einen neuen weißen Baukörper, zur Rechten einen neuen dunkelgrau changierenden und in der Mitte einen brav neobarock erneuerten querstehenden Trakt mit einem dreibogigen Vorbau, dessen Attika weiterhin eine Uhr trägt, damit alle wissen, was es geschlagen hat und ob sie noch rechtzeitig zur angepeilten Veranstaltung kommen.
Von seiner Zeichenhaftigkeit sollte man sich aber nicht irritieren lassen. Hier geht es nicht hinein. Die seitlichen Treppen führen nur hinauf und wieder herunter. Aber die Eindeutigkeit der übrigen Disposition, große Baukörper, helle und dunkle Oberflächen, lassen solche Verwirrspielchen der alten Bausubstanz abblitzen, denn deutlich signalisieren die breiten, je beiden Neubauten angefügten Treppen, daß es hier weitergeht. Der Platzraum wird von den genannten vier Gebäudevolumen - dem ehemaligen Palais des Oberhofstallmeisters, der ehemaligen Winterreithalle, dem Leopold Museum und dem Museum Moderner Kunst - als Spannungsfeld von zwei sich kreuzenden Baukörperbeziehungen definiert, wobei die Relation der Neubauten etwas freier interpretiert ist als die axialsymmetrische Gegenüberstellung der zentralen Gebäude des Bestands. Er wirkt nicht so groß, wie er ist, da die beiden Neubauten ein Ablesen von Geschoßen zumindest erschweren. Aus Distanz erscheinen sie kleiner - also vermeintlich näher. Weder kann man daher übermäßige Monumentalität vorwerfen, noch daß sich ihre Proportionen außerhalb des vorhandenen städtebaulichen Maßstabs bewegten.
Das Vorstoßen der beiden neuen Baukörper in den weiten Freiraum hinter der bestehenden Randbebauung gliedert diesen in mehrere platzartige Zonen, die trotz des Kontinuums Eigenständigkeit erlangen. Sie versprechen abwechslungsreiches Flanieren und vielfache Bespielbarkeit. Dabei wird die Rückseite des Frontprospekts, die eben eine Rückseite ist, von zwei Reihen Ahornbäumen, die das Mittelpalais flankieren, abgeschirmt und neutralisiert. Begleitende Holzbänke geben dieser Platzkante eine unkomplizierte, urbane Wohnlichkeit. Im Kontext des Rahmens, der vom zu erhaltenden Bestand vorgegeben wurde, ist das Konzept, die beiden Neubauvolumen auf zwei Hauptbaukörper zu konzentrieren, diese aber aus dem Raster zu lösen und mit einer Drehung auf benachbarte städtebauliche Richtungen zu beziehen, durchaus geglückt. Hinter der von der Winterreithalle markierten Linie ist das Museumsquartier nicht zu Ende: Eine Art Hintergasse, die sich zwischen Bestand und den Rückseiten der Neubauten durchwindet, entwickelt ein spezifisches Flair derartiger Zonen, mit Müllcontainern, Servicefahrzeugen, Berufstätigen und verirrten Touristen.
Hier stößt man auf den dritten großen Neubaukörper, jenen der Kunsthalle Wien, der parallel zur ehemaligen Winterreithalle, der nun zwei Veranstaltungshallen eingeschrieben sind, unmittelbar an diese anschließt. Der knappe verbleibende Umraum wird vom sogenannten Ovaltrakt gefaßt, dem hintersten Teil des Altbestands. Der lange Gassenraum dazwischen ist in seiner Kontrastwirkung nicht unattraktiv. Etwas problematisch scheint jedoch die beziehungsneutrale Distanzlosigkeit von Reithalle und Kunsthalle in städtebaulicher Hinsicht. Obwohl sie über einen gemeinsamen Eingang verfügen, signalisiert von einem hohen gemauerten Torbogen, dessen ziegelrote Schmucklosigkeit der Symmetrie der Reithalle ein Schnippchen schlägt, bilden sich hier die Zwänge am deutlichsten ab; die Durchfahrt für die Anlieferung, die Unverrückbarkeit der Winterreithalle, der knappe Platz erschwerten ein Interagieren von Neu mit Alt. Die zwei langen Baukörper sind aneinandergequetscht, die eigenartig asymmetrische Dachform des neuen läßt den Betrachter ratlos. Die Zugänge halten sich im wesentlichen an das Angebot des Bestands, der das Museumsquartier umschließt. Man betritt die (Klein-)Stadt der Museen in der musealen Stadt durch Torbogen. Oft zieren deren Schlußsteine süßlich modellierte Pferdeköpfe, die eher aus dem verklemmten 19. Jahrhundert als aus der Barockzeit stammen. Nur von Westen, aus dem siebten Bezirk wurde von der Breiten Gasse her eine Bresche in die Häuserzeile geschlagen. Ein Steg führt auf den umlaufenden offenen Gang, der auf Höhe Dachgeschoß des Ovaltrakts verläuft. Die beiden Arme dieses Weges leiten nach links und nach rechts durch Durchlässe, über weitere Stege und Treppen - ja, auch Aufzüge - auf die Terrassen hinunter, welche die Reithalle flankieren und als Zugangsebenen der beiden großen Museen dienen.
Auf die reale Hinterhofatmosphäre der alten Feuermauern und des noch zu regenerierenden Glacis-Beisels reagierten die Architekten mit einem gleichsam synthetischen Backstage-Design, dessen von der Kunsthalle entlehnter Ziegelbodenbelag befremdlich wirkt. Überhaupt scheint man sich hier in der Wahl der Mittel vertan zu haben. Die überkandidelten Geländer sind eben nicht anspruchslos, die verzogene, angeschnittene Rückseite des Ovaltrakts ist zu kleinkrämerisch. Mag sein, daß die Zeit die schlimmsten Wunden heilt, doch die Selbstverständlichkeit eines Wiener Hinterhofzugangs wurde nicht erreicht, die selbstgestellten Ansprüche, sofern sie bestanden, wurden nicht eingelöst.
Auch der südliche Zugang, von der Mariahilfer Straße her, läßt Fragen offen. Wer hat bloß die unsäglichen eckigen Betonkisten für die zahlreichen Bäume im Klosterhof zu verantworten, die den kleinen Hofraum zerstören?
Der Städtebau ist also halbwegs zufriedenstellend, wenn auch nicht sensationell ausgefallen. Die Vitalität der Nutzungen, vor allem die der Besucher wird sich der Plätze, Höfe und Gassen bemächtigen, sie beleben und permanent umfunktionieren. Neben Straßencafés werden sich wohl zwar keine Schuhputzer ansiedeln, aber vielleicht fliegende Fußmasseure, die den brennenden Sohlen der Besucher nach den vielen durchwanderten Sälen Linderung verschaffen. Nach dem Städtebau soll nun der Blick auf die Architektur der einzelnen Neubauten gerichtet sein, die nach dem Prinzip der harten Schale - weiß, anthrazit, rotbraun; Kalkstein, Basalt, Ziegel - gestaltet und unterschieden sind. Der augenfälligste Neubau ist das Museum Moderner Kunst, dessen hochgewölbte Dachform Signifikanz verleiht und dessen allseitige Fassade in dunklen braungrauen bis anthrazitschwarzen Farbtönen changiert. Mauerwerkstruktur und Farbtextur erzeugen ein faszinierendes Spannungsverhältnis. Lichtwechsel und Lichtfarbe - etwa bei Dämmerung - werden den Ausdruck ständig verändern, Regen auch. Der klare Baukörper wird immer wieder anders erscheinen, neugierig machen auf das Innere und sich längerfristig zu behaupten wissen. Die nach oben strebende Großform wächst wie ein Pilz aus dem Platzbelag heraus. Eine kragenartige Scheide aus hellem Stein definiert dessen Rand. Die anfangs gerundeten, nach oben gleitend schärfer werdenden Gebäudekanten verstärken die aufstrebende Wirkung. Warum ist aber der Abstand des weißen Wulstes zum Baukörper vorne und seitlich ungleich? Will uns der Architekt hier etwas mitteilen, wenn ja, was? Jedenfalls wirkt dieses Detail unentschieden in einem sonst starken und schlüssigen Konzept. Der niedrige Eingang, der von der Terrasse auf halber Höhe erfolgt, muß nach der breiten Freitreppe, die als Signal für die Besucher wirkt, nicht noch gesondert betont werden. Die scheinbare Beiläufigkeit ist sympathisch und beeinträchtigt den zugleich als Freiluftcafé genutzten Zwischenbereich wenig. Ein pompöser Eingang hätte die geschlossene Einheit des Baukörpers zerstört. Das Kunsthaus Bregenz oder die Landesbibliothek und das Landesarchiv in St. Pölten legten für einen Gebäudezugang in zurückhaltender Art und Weise die Spur. Wenn die Lage des Zugangs wie hier städtebaulich bereits definiert ist, braucht es kein auffälliges Portal mehr.
Im Inneren empfängt den Besucher eine hohe, ebenfalls mit Basalt verkleidete Halle, dessen Porosität raumakustisch angenehm dämpfend wirkt. Ein verglaster Lift ist heute offenbar ein Muß, während die gußeisernen Treppenstufen zumindest originell wirken, aber zugleich etwas erzwungen. Unverständlich immer wieder die Glasbrüstungen, auf die man sich nicht bequem stützen kann, auch wenn der eindrückliche Tiefblick - oder ein müder Rücken - dies nahelegen möchten. Das mittlerweile erforderliche Verbundsicherheitsglas mit zwei Glasscheiben, also vier Spiegelungsebenen, weist wegen der Glasstärke einen leichten Farbton auf und hat nicht mehr die Durchsichtigkeit einer einzelnen Scheibe - oder eines einfachen Metallgeländers aus schlanken Stäben.
Die Säle sind flexibel unterteilbar, das System der Beleuchtung drängt sich allerdings vor Hängung oder Aufstellung der Kunstwerke noch relativ stark in den Vordergrund. Die Raumakustik weist wegen der harten, glatten Oberflächen einen langen Nachhall auf, was bei Führungen problematisch sein wird. Und Lautsprecherdurchsagen wird man kaum verstehen. Das Prinzip der neutralen, weißen Räume, ausschließlich mit Kunstlicht, war ein Nutzerwunsch. Doch hier gibt es rasch wechselnde Moden. Nur im obersten Geschoß durchbricht ein breites Fenster, das den Blick auf Dächer und Kuppeln der Innenstadt freigibt, die hermetische Schale. Hier oben folgt die Decke auch der äußeren Wölbung, eine Galerie gibt dem für Veranstaltungen und die Vernissagen gedachten Raum individuelles Flair. Insgesamt hinterläßt das Bauwerk für das Museum Moderner Kunst, trotz einiger diskussionswürdiger Teilaspekte in architektonischer Hinsicht, einen guten, ja den besten Eindruck. Der große Quader für das Museum Leopold bildet dazu das städtebauliche Gegenstück. Er ist weniger hermetisch, mit Fensteröffnungen in der blendend weißen Natursteinschale. Mit einer breiten Treppe zur Eingangsterrasse hinauf und dem bescheidenen Eingang ist es gleich erschlossen wie das dunkle Schwestergebäude. Der Grundriß ist nach dem Windradprinzip um eine hohe zentrale Halle organisiert, was außen mittels schmalhoher Fensterschlitze ablesbar gemacht ist. Eine eigenartige Stelle in der Fassade ist jedoch dort, wo die Steinbank, die den Übergang der Gebäudebasis zum Platz formuliert, unvermittelt abbricht und nur mehr als steinerne Leiste fortgesetzt wird. Und gerade an dieser Stelle endet irgendwie der hohe Fensterspalt. Die primäre strukturelle Ebene mischt sich in nicht nachvollziehbarer Weise mit tertiären Detailaspekten. Diese Unstetigkeit oder Störung wirkt unbeholfen, wie „passiert“ und läßt die sorgende Hand des Architekten vermissen. Sollte sie jedoch gewollt sein, fehlt ihr der nötige Kick. Wenig gelungen sind auch die flachen, feldweisen Kanneluren des Kalksteinmantels. Auch hier fehlt eine architektonische Beziehung dieser Applikation zum Ganzen oder zu den eingeschnittenen Fenstern. Für eine kontrastierende Maßnahme ist sie wiederum zu schwach.
Die Kalksteinverkleidung zieht sich auch in die allgemeinen Räume der Innenwelt des Leopold-Museums. Oft deckt sie alle sechs begrenzenden Flächen der Räume. Die glatten Oberflächen schaffen raumakustische Probleme, auch wenn Konzerttauglichkeit nicht im Pflichtenheft gestanden ist. Der alles deckende Naturstein wirkt in diesem Ausmaß eher verkrampft und bemüht, was gewiß auch mit der nicht übermäßig sorgfältigen handwerklichen Bearbeitung zusammenhängt. Insgesamt verläßt der Betrachter das leere Haus nicht sonderlich befriedigt. - Der Entscheid, die Kunsthalle mit Ziegeln zu verfliesen, erscheint im Gesamtzusammenhang nicht sorgfältig genug durchgearbeitet. Immerhin ist die Gestaltung der langen Mauer zum Ovaltrakt gelungen. Der Gassenraum ist angenehm unprätentiös und ruhig, gewinnt sogar als der schönste der Hintergassenzüge eigenständige Qualität. Aber das Gebäude verliert seine Objekthaftigkeit im Vergleich mit den anderen beiden Museen, weil die Ziegel über alles und jedes und sogar noch bis zur Breiten Gasse hinauf gezogen sind. Das Innere einer Kunsthalle wird gewöhnlich einem permanenten Wandel unterworfen, doch auch hier tritt das Beleuchtungssystem stark in Erscheinung.
Die Erneuerung des ursprünglich von Fischer von Erlach geplanten langen Hauptprospekts durch Manfred Wehdorn ist noch nicht abgeschlossen. Die Chance, das Bauwerk im Sinne des Entwurfs Fischers in städtebaulicher und architektonischer Hinsicht mit einer deutlicher differenzierten Dachlandschaft und einer Betonung der Eckrisalite zu stärken, wurde nicht wahrgenommen. Es zeigt sich bei diesem konservatorischen Ansatz ein Problem, indem selbst bei dieser architektonisch eher durchschnittlichen Bausubstanz und - bezogen auf die Renovationen des 19. Jahrhunderts - einem relativ geringen Gebäudealter der technisch-denkmalpflegerischen vor einer architektonisch-kritischen Erneuerung der Vorzug gegeben wurde.
In der gesamten Anlage waren zahlreiche Detailaspekte architektonisch zu lösen. Das sind Geländer, Treppenrampen, Anschlüsse von Alt und Neu, der Einbau von Liften, die Verteilung von Platzbelägen und so weiter. Ob es nun die in Steinbrüstungen eingeschnittenen zusätzlichen Glasgeländer oder überhaupt die gestalterisch stark hervortretenden, verschiedenen Geländerarten sind, die großen Glaslifte im rückwärtigen Bereich oder die sarkophagartigen Steinbänke vor der Reithalle: in dieser Maßstabsebene, in der der Mensch den Architekturelementen körperlich sehr nahe kommt, machen sich mangelnde Durcharbeitung in Hinblick auf Selbstverständlichkeit und Unkompliziertheit schnell bemerkbar. Wegen der angestrebten großen Keilform der Außentreppen werden beispielsweise die den Eindruck wieder schwächenden Glaseinsätze in Kauf genommen. Oder die attraktiven Gitter vor den Glasliften werden durch ihre anschließende Degradierung zu Geländern entwertet und entwerten ihrerseits die Liftprismen in ihrer Wirkung. Und wo stellt das erwartete, zahlreiche junge Publikum seine Räder hin?
Mag sein, daß bei so umfangreichen Projekten die Detailliebe nicht omnipräsent sein kann. Vielleicht handelt es sich auch um eine Entwicklung, die in anderen Ländern längst abgeschlossen ist und hier gerade nachvollzogen wird. Schade ist es allemal.
Eine Chronologie: Museumsquartier (2)
Die Geschichte des Wettbewerbs
Hinweis: Dieser Artikel ist durch die Umstellung des Standard-Archivs derzeit leider nicht zugänglich.
Der „Bahnhof“
Die Geschichte des Museumsquartiers ist eine der permanenten Redimensionierungen.
Hinweis: Dieser Artikel ist durch die Umstellung des Standard-Archivs derzeit leider nicht zugänglich.
Eine Chronologie: Museumsquartier (1)
Die Vorgeschichte
Hinweis: Dieser Artikel ist durch die Umstellung des Standard-Archivs derzeit leider nicht zugänglich.
Der „Geniestreich“
Museumsquartier Wien
Hinweis: Dieser Artikel ist durch die Umstellung des Standard-Archivs derzeit leider nicht zugänglich.
Nekropolis statt Akropolis
Das MuseumsQuartier erweist sich als Ganzes und in seinen Hauptbauten als architektonisches Desaster. Die entscheidenden Fehler liegen Jahrzehnte zurück.
Das MuseumsQuartier - das gemeinsame Werk von Aurelius (Hans Dichand), Günther Bischof (Geschäftsführer), Dieter Bogner (Museumsexperte), Gertrude Brinek (Politikerin), Erhard Busek (Minister), Peter Czernin (Architekt), Hans Dichand (Zeitungsbesitzer), Günther Domenig (Juror), Wolf Dieter Dube (Juror), Martin Eder (Anwalt), Brigitte Ederer (Finanzstadträtin), Rudolf Edlinger (Minister), Karlheinz Essl (Kunstsammler), Hermann Fillitz (Kunsthistoriker), Elisabeth Gehrer (Ministerin), Ernst Gisel (Juror), Bernhard Görg (Planungsstadtrat), Eberhard Graf (Juror), Michael Häupl (Bürgermeister), Lorand Hegyi (Museumsdirektor), Werner Hofmann (Juror), Wilhelm Holzbauer (Architekt), Arnold Klotz (Stadtplanungsdirektor), Wolfgang Kos (Journalist), Ferdinand Lacina (Minister), Rudolf Leopold (Kunstsammler), Bernd Lötsch (Biologe), Ferdinand Maier (Politiker), Peter Marboe (Kulturstadtrat), Boris Marte (Politiker), Johann Marte (Juror), Gerald Matt (Kunsthallendirektor), Hans Mayr (Finanzstadtrat), Günther Nenning (Journalist), Walter Nettig (Wirtschaftskammerdirektor), Laurids Ortner (Architekt), Manfred Ortner (Architekt), Ursula Pasterk (Kulturstadträtin), Rainer Pawkowitz (Politiker), Gustav Peichl (Architekt), Peter Pilz (Politiker), Roland Rainer (Juror), Sepp Rieder (Finanzstadtrat), Georg Rizzi (Bundesdenkmalamtspräsident), Karlheinz Roschitz (Journalist), Arthur Rosenauer (Kunsthistoriker), Gerhard Sailer (Bundesdenkmalamtspräsident), Klaus Albrecht Schröder (Geschäftsführer), Richard Schmitz (Politiker), Wolfgang Schüssel (Minister), Dietmar Steiner (Architekturkritiker), Martin Stelzl (Fiaker), James Stirling (Juror), Hannes Swoboda (Planungsstadtrat), Herbert Tachmina (Bezirksvorsteher), Gexi Trostmann (Trachtenhändlerin), Klaus Vatter (Juror), Franz Vranitzky (Bundeskanzler), Wolfgang Waldner (Geschäftsführer), Peter Weibel (Kunstpolitiker), Manfred Wehdorn (Architekt), Helmut Zilk (Bürgermeister), Walter Zschokke (Architekturkritiker) sowie vielen anderen - ist ein Desaster.
Was hat man uns nicht alles versprochen, aus dieser einmaligen Jahrhundertchance zu machen? Eine Akropolis der Gegenwartskultur! Ein weit sichtbares Exempel demokratischer Architektur im konservierten Stadtbild der imperialen Ringstraße! Ein Laboratorium für die Kunst des 21. Jahrhunderts! Das Wiener Centre Pompidou oder gar das „beste Kulturzentrum der Welt“!
Kein Versprechen wurde erfüllt. Statt Akropolis eine Nekropolis, statt eines weltoffenen Laboratoriums des Neuen eine Reservation des österreichischen Provinzialismus, statt einer demokratischen Architektur-Antithese zum imperialen Gehabe des Kaiserforums dessen Fortsetzung, statt Centre Pompidou in Wien seine Wiener Antithese: das MuseumsQuartier.
Gehen wir es von hinten an und von dem Versprechen aus, das MuQua würde sich zum 7. Bezirk hin öffnen und das großstädtische Leben zwischen derCity und dem Spittelberg zum Strömen bringen. Für den einzigen Durchgang vom 7. Bezirk steht eine schmale Baulücke in der Breiten Gasse zur Verfügung. Dort befindet sich ein Steg, der, obwohl seine geringe Neigung eine Rampe problemlos zugelassen hätte, als achtstufige Stiege ausgebildet ist. Damit ist der Zugang zu einem der beiden Aufzüge für die Rollstuhlfahrer versperrt. Selbstredend muss man jetzt die Brücke umbauen. So wie man nachträglich den Monumentalstiegen zu den zwei Museen die scheußlichen Glasbrüstungen und Zinkeisenhandläufe aufsetzen hat müssen.
Der unerfreuliche Weg führt über eine Dachterrasse an einem Bärengraben vorbei, der früher der Garten des berühmten Glacisbeisls war. Angeblich soll das einst wegen seines Verstecktseins beliebte Gartenrestaurant wieder zurückkehren, wer aber wird da noch speisen wollen, wenn von oben die Passanten direkt in die Teller schauen können? Dieser ins Dach hineingeschnittene Weg ist auf die einfallsloseste Dachaufstockungsart gestaltet, die man sich nur vorstellen kann.
Der gänzlich mit Klinkerziegelattrappen verkleidete Bunker ist die bestversteckte kommunale Kunsthalle für die zeitgenössische Kunst auf der Welt. Natürlich ist darunter alles aus Stahlbeton - so wie bei den beiden Museen auch. Eine völlig banale Stahlbetonkiste, verkleidet mit roten Ziegeln. Wohl deshalb, weil rote Klinker einst beliebtes Dekorelement der kommunalen Wohnhäuser des Roten Wien waren. Auch der komische Bogen, der der verputzten Winterreithalle hinzugefügt wurde, damit die Menschen den Eingang zur Kunsthalle überhaupt finden, ist aus roten Ziegeln. Diese Form ist allerdings ein für die faschistische Architektur der Mussolini-Zeit charakteristisches Element.
Durch einen Tunnel im Satteldach des einstigen Lagergebäudes erreicht man einen mit einer Stiege verbunden Steg. Der dunkle Bunker mit den schmalen Schießscharten statt der Fenster ist der sichtbare architektonische Höhepunkt des MuQua: das MUMOK SLW, wie das Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien nun heißt. „Dieser Begriff ist einprägsam und weltweit unverwechselbar“, berichtet die erste Nummer des MUMOK SLW Newsletter. MUMOK kommt nur im Wörterbuch der Zine-Sprache in Tschad vor und ist ein Synonym für „bak-bak“, was „fest und lang“ bedeutet. Die MUMOK SLW Newsletters berichten darüber, wie Journalisten aus aller Welt auf unterschiedlichste Weise inspiriert wurden. Als „ernstes Symbol der Unbestechlichkeit“ liege das MUMOK neben der „barocken Leichtigkeit“ der Kunsthalle, urteilt der Mann von der Neuen Zürcher. Fraglich bleibt, ob er die barocke Leichtigkeit an der plumpen alten Winterreithalle oder an der noch plumperen neuen Kunsthalle entdeckt hat. Er ist aber nicht der Einzige, der diesen Blödsinn schreibt. Während die Neue Passauer Zeitung feststellt, dass der „gewaltige gewölbte Bau trotz seiner Ausmaße durch die unregelmäßige Oberfläche aus anthrazitfarbenem Lavagestein leicht und einladend wirkt“, kommt das MUMOK SLW-Blatt zu anderen Assoziationen: „Schlachtschiff, U-Boot, Space-Shuttle. Tatsächlich wirkt der Neubau von außen wie (...) ein dunkler, geschlossener Block, der unmittelbar aus der Tiefe aufzutauchen scheint“. Man kann es freilich auch umgekehrt betrachten: Er versinkt in der Tiefe.
Wohin auch immer. Der kleine, unauffällige Einschnitt in diesem „Lava-Fels in Kultur-Brandung“ (die Presse) ist der Eingang und symptomatisch für die ausgeklügelte Symbolik im ganzen MuQua: Der Zugang zur Kunst soll erheblich erschwert werden. Der Eingang in das gegenüber liegende Cafe ist unvergleichbar größer und einladender als der ins MUMOK SLW. Die Gastronomie funktioniert.
Es gibt viele Absurditäten in diesem MuQua; die größten sind wohl die beiden Monumentalstiegen, über die man den Kunstgenuss ersteigen muss. Für Rollstuhlfahrer stehen Lifte zur Verfügung, die allerdings nicht leicht zu finden sind. Während im Centre Pompidou (eröffnet 1977) oder in Tate Modern (2000) der Platz draußen gleichsam hineinfließt, wird in Wien das Gegenteil angestrebt: verbauen. Weshalb die Eingänge nicht ebenerdig situiert sind, bleibt rätselhaft.
Drinnen im MUMOK SLW merkt man, dass - erstens - der nach außen so kompakt wirkende Block aus zwei voneinander getrennten Teilen besteht, die durch Brücken in jeder Etage miteinander verbunden sind; und dass - zweitens - das Museum tief in der Erde vergraben ist. Es gibt kein Foyer. Man steht gleich vor einem tiefen Loch. Der Schacht mit den drei Personenaufzügen, auf den Laurids Ortner besonders stolz ist, soll den Bergbau symbolisieren. „Dieses Haus wirkt wie ein Bergwerk der Künste, in das man einfahren kann zu Minimal, Pop-Art oder Arte povera und in dem etwas von den vulkanischen Aus- und Umbrüchen, auch vom Schwarz und Weiß des 20. Jahrhunderts, fortzuleben scheint“: Der Zeit-Kunstknappe Hanno Rauterberg hat eine der zahlreichen Metaphern, mit denen Laurids Ortner die Journalisten laufend versorgt, dankbar aufgenommen.
Doch das alles sind bloß Urteile, und die sind beweglich. Fest hingegen steht die Aufteilung der Ausstellungsflächen auf die Geschoße und der Geschoße auf die beiden Trakte:Die Ausstellungssäle sind jeweils um einen halben Stock versetzt, sodass der Besucher nach der Besichtigung eines der verhältnismäßig kleinen Säle entscheiden muss, ob er mit dem Aufzug um eine Etage weiterfährt oder über die Stiege geht.
Ein weiteres Problem besteht darin, dass die Säle auf der linken Seite viel kleiner sind, sodass die Ausstellungsmacher (jetzt Lorand Hegyi, dann Engelbert Köb) ihre Konzepte nach der Größe der Werke durchdenken müssen: eine - sagen wir es sehr wohlwollend - völlig unorthodoxe Lösung für ein Museum der Gegenwartskunst. Hinzu kommt, dass die wichtigsten Wände von Fluchtwegtüren oder mit Infrastrukturkasten besetzt sind.
Die wahre Katastrophe des MuQua aber ist die kommunale Kunsthalle. Die Kombination mit den in die Winterreithalle äußerst mühevoll hineingestopften Tanz- und Theatersälen erweist sich als überaus ungünstig. Man geht hinein, zahlt an der Kassa und weiß nicht, wo es weitergeht. Mehrere Eingangslöcher stehen zur Verfügung. Drinnen setzt sich die Irritation fort. In der umgebauten Restreithalle sieht es aus wie in einem renovierten Vorstadtkino, das früher einmal ein Tanzsaal war. Allerdings ist das Durcheinander an Materialien und Formen samt der entsetzlichen neubarocken Stukkatur derart stark, dass es erforderlich geworden ist, viele Teile hinter textilen Vorhängen zu verstecken: die Spiegel, die unangenehm grell leuchtenden Milchglaswände, den gläsernen Aussichtsaufzug.
Das „Ziegelfoyer“ erinnert an ein evangelisches Kirchenzentrum aus den früher Siebzigerjahren irgendwo bei Hamburg. Dort waren Klinkerwände wegen der großen Ziegelbautradition gleichsam obligatorisch - allerdings echt gemauert und nicht bloß aufgeklebt wie hier. Laut der MuQua-Metaphorik soll es eine Fabrik symbolisieren: sozusagen die Werkhalle, in der die neue, heiße Kunst geschmiedet wird, während im Basalt-Museum jene Kunst untergebracht ist, die den Vulkan bereits verlassen hat und nun einen verdienten Platz für die Auskühlung in der Kunstgeschichte bekommt. Das außen wie innen mit weißem Muschelkalkstein verkleidete Leopold Museum hingegen soll „die konsolidierte Geschichtlichkeit der Sammlung Leopold symbolisieren“ (MuQua-Presseinformation).
Der Hauptsaal der Kunst- und Werkhalle ist eine Art Hommage a Fischer von Erlach. Er weist eine Gewölbedecke auf, die durch prägnante Streifen mit Ausstellungstechnik und Licht zusätzlich sakralisiert wird. Weil die Schächte mit den Aufzügen und Stiegen in den Saal hineingestellt wurden, wirkt der Raum klein, bedrängt und unbestimmt. Wie mühsam es sein wird, unter der verhältnismäßig niedrigen Gewölbedecke gute Ausstellungsarchitektur zu schaffen, lässt bereits die Gestaltung der „barocken Party“ ahnen, mit der auch so gute Architekten wie Berger + Parkkinen gescheitert sind.
Das Leopold Museum ist farblich mit dem hellen Kalksteinbelag des geräumigen kahlen Innenhofes verbunden und beherrscht dadurch visuell das ganze MuQua-Hauptfeld, das mit der imperialen Loggia der Winterreithalle den Charme eines Kasernenplatzes verströmt - allerdings in einer mediterranen Stadt. Rudolf Leopold muss man gratulieren. Er ist der klare Sieger der MuQua-Wettlaufes. Der kluge, neureiche Mann aus Grinzing hat von dem neureichen, klugen Mann aus Aachen, Peter Ludwig, gelernt, wie man es am besten macht, wenn man Kunst stiftet. Wahrscheinlich als Einziger hat Leopold genau das bekommen, was er sich gewünscht hat: ein prachtvolles Mausoleum zur Lebzeiten. Drinnen maßgeschneidert für seine Sammlung, draußen blendend aufpoliert für das Selbstgefühl.
Dass die Stadt Wien zugestimmt hat, ihre Prestigeinstitution der Kunst unsichtbar im Hinterhof des toten Reithauses verstauen zu lassen, macht den Triumph Leopolds noch strahlender. Unwahrscheinlich, dass sich die Rathaussozialisten von der roten Farbe der Klinkerverkleidung allein blenden haben lassen. Vielmehr haben sie der Verfügung von Aurelius fast wortwörtlich Folge geleistet, wie sie dieser bereits im Herbst 1992 in der Kronen Zeitung bekannt gab: „Verkleinert man das Museum moderner Kunst und die Ausstellungshalle um etwa ein Drittel, fände die letztgenannte leicht Platz anstelle der unwichtigen Veranstaltungshalle und das Leopold Museum auf dem früheren Platz der Ausstellungshalle.“ Das ist der Grundstein des Desasters: Die Freundschaft der zwei neureichen, klugen Männer aus Grinzing. Dazu kamen einige Verfahrensfehler.
Der erste Kardinalfehler passierte 1990 der Jury unter dem Vorsitz Ernst Gisels. Ortner & Ortner reichten für die zweite Runde ein völlig anderes Projekt ein. Eines, von dem Hans Hollein behauptete, es sei von seinem Entwurf abgekupfert. Wie auch immer: Ortner & Ortner übernahmen Holleins Strategie einer städtebaulichen Collage. Die weitgehend unverbindliche Verteilung und Ausformung der Bauten im Entwurf ermöglichte Rochaden, Verkleinerungen, Auslassungen und den Austausch von Bautypen (Stahlbetonbau statt Glas-Eisen-Bau). Durch die Veränderungen und Abweichungen vom tatsächlich prämierten Entwurf lassen sich viele unverständliche Aspekte der nun vollendeten Neugestaltung erklären. Zum Beispiel, weshalb der Weg so obskur über die Dachböden geführt wird: weil die Altbauten nicht durch Neubauten ersetzt wurden. Oder weshalb das MUMOK von der rechteckigen Ausrichtung der barocken Anlage abweicht: weil die Achse des MUMOK auf einen der letztendlich doch nicht gebauten Neubauten ausgerichtet war und als Residuum der ursprünglichen, durchaus sinnvollen Komposition übernommen wurde - nun völlig sinnlos und falsch. Eine Abweichung übrigens, die den Eindruck hervorruft, dass die Winterreithalle die beiden Museumsblöcke fast gewaltsam auseinander hält. Ganz im Sinn der katholischen Ikonographie übrigens, die Ortner & Ortner der gesamten Komposition - bewusst oder unbewusst - zugrunde gelegt haben: Das Helle ist das Gute, das Dunkle ist das Böse, und das Böse wird zurückgehalten.
Der zweite Kardinalfehler bestand darin, mit einer derart riesigen Aufgabe nur ein einziges Architektenteam zu beauftragen. Ortner & Ortner waren hoffnungslos überfordert - genauso wie Politiker, Museumsexperten, Denkmalschützer ... Es wäre ratsam gewesen, die einzelnen Kunsthäuser von verschiedenen Architekten ausführen zu lassen. Die Konkurrenz der Architekten untereinander hätte dem Gesamtprojekt gut getan; hätte die federführenden Architekten gegen die widrigen Umstände gestärkt. Ein starker, unter Umständen ausländischer Architekt hätte es sich nicht gefallen lassen, mit der Kunsthalle in den Hinterhof abgeschoben zu werden. Ortner & Ortner konnte es egal sein, immerhin haben sie noch zwei andere prächtige Platzhirsche im Areal vorzuweisen.
Der dritte Kardinalfehler war der staatliche Ankauf der Schiele-Klimt-Ozeanien-et-cetera-Sammlung von Rudolf Leopold. Durch sie hat die Idee des MuseumsQuartiers eine neue Bestimmung bekommen, die im fundamentalen Widerspruch zur ursprünglichen Intention eines ausschließlich gegenwartsbezogenen Kulturzentrums steht. Symptomatisch: Das MuQua wirbt nun nicht mit Architektur, sondern mit Gastronomie. Und so wird es wohl bleiben.
Der vierte Kardinalfehler schließlich bestand darin, dass Ortner & Ortner die Gestaltung des Vorplatzes vor dem Fischer-von-Erlach-Bau nicht entzogen wurde. Offensichtlich haben sich die Architekten vom Zentralfriedhof inspirieren lassen: Die heckenumrahmten Rasenflächen erinnern an die Ehrengräber der Stadt Wien. So wie die Steinsitzbänke vor der Winterreithalle wie Grabsteine aussehen und genauso bequem sind.
Eine barocke Party
Am Montag (11. Juni) feiert die Kunsthalle ihre „Gesamteröffnung“. Am 28. Juni wird dann das komplette MuseumsQuartier eingeweiht.
Zum vollständigen Artikel im „ORF.at“ Archiv ↗
Kein sichtbares Zeichen
„Überall fragt man mich, warum wir kein deutlich sichtbares Zeichen nach außen haben“, stellt Museumsquartier-Geschäftsführer Wolfgang Waldner vor der offiziellen Eröffnung des neuen Kulturbezirks fest.
Zum vollständigen Artikel im „ORF.at“ Archiv ↗
Endspurt im Quartier
Der größte Museumsneubau Europas geht seiner Vollendung entgegen. Die Stätten des Wiener Museumsquartiers werden jetzt sukzessive eröffnet.
Zum vollständigen Artikel im „Salzburger Nachrichten“ Archiv ↗
Kunst und Stadtentwicklung
Sabine Oppolzer über eine international besetzte Diskussionsreihe über mögliche Entwicklungen des Museumsquartiers.
Zum vollständigen Artikel im „ORF.at“ Archiv ↗
Wiener Museumsquartier - ganz nach Mehrheitsgeschmack
In Wien steht nach jahrzehntelangem Ringen das MuseumsQuartier vor seiner Vollendung: Ein ganzer Stadtteil nur für Kunst, Kultur und Kaiserschmarren.
Zum vollständigen Artikel im „TagesAnzeiger“ Archiv ↗
MQ - Die Museumsmeile
Der großflächige Komplex des Museumsquartiers ist auf dem Weg, zu einem der bedeutendsten Kulturbezirke der Welt zu werden.
Zum vollständigen Artikel im „ORF.at“ Archiv ↗
Auch das Ruhige kann Spektakel sein
Allen Unkenrufen zum Trotz ist mit dem Museumsquartier ein beschaulicher Kulturbezirk entstanden, in dem der Besucher selbst Muse sein darf. Ein erster Rundgang mit Architekt Laurids Ortner
Hinweis: Dieser Artikel ist durch die Umstellung des Standard-Archivs derzeit leider nicht zugänglich.
Freibier auf Österreichs größter Baugrube
Wien - Seit 2. April wird gebaut. Auf 45.000 Quadratmetern Grund wächst das Museumsquartier. Die ehemaligen kaiserlichen Hofstallungen wurden zunächst von 92.000 Kubikmetern umbautem Raum gereinigt und um 85.000 Kubikmeter oder 6000 Lkw-Ladungen Aushub erleichtert. Und so kam es also zunächst zu drei gewaltigen Löchern. Jenes, aus dem dann das Museum moderner Kunst wuchs, reichte gleich 17,5 Meter in die Tiefe.
Hinweis: Dieser Artikel ist durch die Umstellung des Standard-Archivs derzeit leider nicht zugänglich.
Ein Stück Kulturgeschichte
1990 war der Wettbewerbsentscheid, 2001 soll es eröffnet werden: das Museumsquartier. Das Architektur Zentrum Wien präsentiert ab 15.9. erstmalig das gesamte Projekt der Öffentlichkeit. Die Ausstellung lässt zehn Jahre des Kampfes, der Resignation, der Ablehnung, der Wiederaufnahme und der Zustimmung Revue passieren. Die Planungsphasen und die Rekonstruktion der politischen Diskussionen - begleitet und geleitet von den Medien - sollen die BesucherInnen in ein „Stück Kulturgeschichte eintauchen lassen“.
Zum vollständigen Artikel im „ORF.at“ Archiv ↗
Zwischen „zawos“ und „ehwurscht“
Über das Wiener Museumsquartier wird nicht einmal mehr gestritten
Hinweis: Dieser Artikel ist durch die Umstellung des Standard-Archivs derzeit leider nicht zugänglich.
Größe braucht Signalwirkung - Bringt den Turm wieder ins Spiel!
Andernorts (siehe Kunsthaus/Graz) wird über zentrale Projekte der Stadtarchitektur das Volk befragt. In Wien genügt das Veto eines Zeitungsherausgebers. Die Amputation des „Leseturms“ war einst jener Kompromiß, der den Bau des Museumsquartiers möglich machte. Platz für den Turm gibt es aber nach wie vor. Und gute Gründe, ihn zurückzufordern, meint Wolfgang Kos. Eine Intervention.
Hinweis: Dieser Artikel ist durch die Umstellung des Standard-Archivs derzeit leider nicht zugänglich.
Die Schräglage der Neunziger
Zu Unrecht geschmäht: Das kürzlich abgesegnete Projekt für die Neugestaltung des Wiener Museumsquartiers ist keine zurechtgestutzte Variante des ursprünglichen Entwurfs, sondern ein neuer städtebaulicher Ansatz. Eine Revision.
Abschied nehmen heißt es von der Vorstellung, das aktuelle Projekt für die Neugestaltung des Wiener Museumsquartiers sei eine redimensionierte, gebändigte Variante des vieldiskutierten, vielgeschmähten und zögerlich verteidigten Entwurfs, der vor drei Jahren die Gemüter erregte, weil da noch ein Turm zuviel aus dem Modell ragte.
Ein neuer städtebaulicher Ansatz aus den neunziger Jahren ersetzt jenen aus dem vorangegangenen Jahrzehnt. Während mit dem Vorgängerprojekt versucht wurde, über die Firstlinie des sogenannten Fischer-Trakts städtebauliche Zeichen Richtung Heldenplatz und Innenstadt zu senden, erzeugt der neue Ansatz in der Weite hinter dem Altbestand einen großen querliegenden Platz.
Dieser städtische Binnenraum wird von vier ungefähr gleichwertigen Baukörpern definiert: dem zentralen Palais des Marstallkommandanten, dem zum Kubus tendierenden Quader des Leopold-Museums und dem langgestreckten, sphärisch überdachten Quader des Museums Moderner Kunst. Diese vier wichtigsten Bauten sind entweder nur durch niedrige Nebentrakte oder gar nicht miteinander verbunden und erzeugen durch die kreuzweise Gegenüberstellung in der freien Mitte ein räumliches Spannungsfeld.
Die polare Disposition des Palais zur Reithalle wird von den konzentrierten Volumen von Leopold-Museum und Museum Moderner Kunst flankiert. Die beiden Neubauten sind aber gegenüber den Hauptachsen des Bestands um einige Winkelgrade verdreht. Der erste bezieht sich auf die städtebauliche Ordnung der ehemaligen Hofmuseen, der zweite nimmt die Richtung der Parzellenstruktur am Spittelberg auf, die von den hohen Feuermauern der Häuserzeile an der Breiten Gasse weitervermittelt wird.
Diese spezifische Schrägstellung läßt die beiden Quader im alten Gefüge scheinbar frei floaten, sodaß im Umfeld Außenräume differenzierten Zuschnitts entstehen. In der Querrichtung des fußballfeldgroßen Binnenplatzes bilden sie daher weniger einen seitlichen Abschluß als zwei Einschnürungen, welche die gesamte Freifläche zwischen Fürstenhof und Staatsratshof zonieren.
Hinter der Reithalle, die zur Veranstaltungshalle umgebaut wird, schließt parallel ein längsrechteckiger Neubau an: die Kunsthalle. Der hintere Bereich des Quartiers ist das genaue Gegenteil der weiträumigen Höfe und der Weite davor: Verwinkelte Gassenräume und kleine Höfe unregelmäßigen Zuschnitts lassen den Neubau nur auf kurze Distanz in Erscheinung treten. Es entsteht ein dichtes Gemenge mit zahlreichen Brüchen und Störungen, die für Wien ebenso typisch sind wie die Großräumigkeit der Ringstraße.
Das neue städtebauliche Konzept der konzentrierten Intervention bewahrt einerseits die vielbeschworene Identität der ehemaligen Hofstallungen, andererseits treten die Neubauten mit dem Bestand in ein gleichwertiges, durchaus spannungsreiches Verhältnis.
Wenn nun das Neue konzentriert wird und jeweils zwei bis drei Geschoße tief unter den Boden reicht, stellt sich die Frage, was vom Altbestand übrigbleibt. Es ist dies der lange Fronttrakt zur Stadt, dessen Ursprünge auf Fischer von Erlach zurückzuführen sind und der, obwohl im 19. Jahrhundert von Amtsarchitekten historistisch überformt, Fischer-Trakt genannt wird. An dem der Mariahilfer Straße zugewandten Teil ist es der größere Fürstenhof mit angrenzenden Bauten und an der Burggasse spiegelbildlich der Staatsratshof mit seiner Bausubstanz, die bewahrt werden. Die uminterpretierte Winterreithalle mit Kaiserloge und der dahinterliegende Halbrundbau und natürlich das Glacis-Beisl bleiben ebenso erhalten.
Das neue Leopold-Museum besteht aus vier windradförmig um einen Lichthof gefügten Teilkörpern. Eine äußere Hülle aus hellem Kalkstein, die aus gemauerten Blöcken ähnlich jenen von Bibliothek und Archiv in St. Pölten besteht, bestimmt die architektonische Erscheinung.
Das neue Museum Moderner Kunst wird von einer vertikalen Erschließungsschicht mit Aufzügen und Treppen in einen größeren vorderen und in einen hinteren Abschnitt geteilt. Auch dieser Bau erhält eine massive Natursteinverkleidung. Um das Monolithische zu betonen, wird bei beiden Gebäuden das Material über die Dachfläche gezogen. Die neue Kunsthalle erfährt eine ähnliche Materialisierung in Ziegelstein, sodaß sich in der Flugsicht auf das Quartier eine Art fünfte Fassade ergibt.
Über breite, sockelartige Stiegenrampen gelangt man zu den beiden Museen. Vor den Eingängen dehnen sich jeweils größere Terrassen, von denen weitere Treppenläufe zum Durchgang in den siebten Bezirk führen, der von beiden Aufgängen her hinter dem Halbrundbau zusammengefaßt wird. Diese Durchgänge erscheinen im derzeitigen Planungsstand noch etwas ungeschlacht, wie überhaupt das ganze Quartier erst in der baulichen Konkretisierung abschließend zu beurteilen ist.
Die zurückhaltendere und auch sparsamere Art weist diesen zweiten Entwurf als Produkt der neunziger Jahre aus, das sich von jenem frecheren aus der zweiten Wettbewerbsstufe mit insgesamt drei (!) Türmen klar unterscheidet. In der Reduktion war es eher schwächer geworden, und mit der gläsernen Hülle des Museums Moderner Kunst taten sich manche schwer.
Im aktuellen Projekt erweist es sich städtebaulich als richtig, die imperiale Achse des Kaiserforums nach dem Triumphbogenmotiv des zentralen Palais auf dem großen Querplatz ausklingen zu lassen und nicht in die alte Reithalle hinein weiterzuführen, die in Zukunft von der nördlichen Stirnseite her zugänglich sein wird.
Das Nutzungskonzept postuliert ein urbanes Nebeneinander von auf lange Dauer ausgelegten Institutionen, wie es die beiden Museen oder die Kunst- und die Veranstaltungshalle sind, mit rascher sich verändernden oder in Entwicklung befindlichen Instituten wie dem Kindermuseum, dem Architekturzentrum, dem Kunstdepot und vielen kleineren und kleinsten Elementen der Wiener Kulturlandschaft. In diese Mischung finden sich wie selbstverständlich eingelagert auch zahlreiche Wohnungen, einige Ateliers und zirka 2000 Quadratmeter Büroflächen.
Diese Kombination läßt auf ein urbanes Museumsquartier hoffen, nicht zuletzt deshalb, weil ein Teil dieser Nutzungen bereits heute das Leben im Museumsquartier bestimmt und Anlaufschwierigkeiten vorbeugt. Das Verhältnis wird sich zwar etwas verschieben, wenn die großen Brocken der zwei neuen Museen in Betrieb gehen, aber auch sie werden vom bunten Leben rundherum profitieren.
Man kann sich natürlich fragen, ob das eher unspektakuläre Projekt, wie es jetzt vorliegt, allen Ansprüchen auf internationale Repräsentation zu genügen vermag. Doch wird es sich als wichtiger herausstellen, wie das ganze Ensemble bespielt wird und wie es im Stadtleben verankert ist. Ich neige dazu, das zurückhaltende, als neu einzustufende zweite Projekt als besser zu bewerten als die reduzierte Endstufe des vorherigen, wo der Reithalle die etwas problematische Rolle eines Mehrfachfoyers zugekommen wäre; doch muß alles erst gebaut werden, bevor ein differenzierteres Urteil möglich wird.
Ein Aspekt, der nicht außer acht gelassen werden darf, ist die Erneuerung des sogenannten Fischer-Trakts. Während die Architekten sich in zwei Wettbewerbsstufen maßen und das erstprämierte Projekt mittlerweile neu konzipiert wurde, hat man von den 150 Kunsthistorikern wenig Substantielles gehört, die vor ein paar Jahren den Fischer-Trakt vom Rang her knapp unter der Karlskirche einstufen wollten. Niemand hat sich die Mühe gemacht nachzuforschen, wieviel an dem Trakt nach dem Artilleriebeschuß von 1809 noch von Fischer stammt. Damals verschwanden die Dachaufsätze auf den Außenrisaliten, die 1986 von Hermann Czech als wesentlich reklamiert wurden. Es war aber auch die von Fischer differenzierte Dachlandschaft durch eine amalgamierte Form ersetzt worden.
Diese städtebaulich und architektonisch wichtigen Komponenten, die dem Fronttrakt erst wieder zum Präfix „Fischer“ verhelfen könnten, würden diesem gegenüber den je zwei benachbarten Museumsbauten jenes städtebauliche Gewicht geben, das für den langen, mehrheitlich niedrigen Baukörper mit einer Fassadenrenovation nicht zu erreichen ist.
Wenn es möglich ist, dem Mittelrisalit der Gloriette unter Mißachtung der architektonischen Klarheit Fenster einzusetzen, weil es sie einmal gegeben hat, dann muß es doch möglich sein, den Fronttrakt des Museumsquartiers wieder mit jenen wesentlichen Elementen zu versehen, die es einmal gegeben hat und die ihm zu jener architektonisch-städtebaulichen Klarheit verhelfen, unter der er den Namen Fischer-Trakt auch verdient. Daß diese Aufgabe nicht mit denkmalpflegerischer Technologie, sondern mit dem kreativen Einfühlungsvermögen eines Architekten zu bearbeiten ist, steht auf einem anderen Blatt.
Das Ende einer unendlichen Geschichte
Das Denkmalamt stimmt der Realisierung des Museumsquartiers vorbehaltlos zu. Präsident Gerhard Sailer hat Wort gehalten: Wie versprochen, übergab er der Museumsquartier-Errichtungsgesellschaft noch im Oktober den Bescheid des Denkmalamtes. Dem Antrag auf Neugestaltung des Messepalast-Areals wird darin stattgegeben. Spatenstich ist am 8. Dezember.
Zum vollständigen Artikel im „Der Standard“ Archiv ↗
Messepalast: Einreichung im April 1997
Architekt Wehdorn rechnet mit einer Einreichung des Museumsquartiers bei Denkmalamt und Stadt Wien im kommenden April: „Alles läuft stinknormal“.
Zum vollständigen Artikel im „Die Presse“ Archiv ↗
Ensemble
MuseumsQuartier Wien

MuseumsQuartier Wien - MQ
Neubau, Wien (A) - 2001
O&O Baukunst, Manfred Wehdorn
Architekturzentrum Wien

Leopold Museum - MuseumsQuartier Wien
Neubau, Wien (A) - 2001
O&O Baukunst
Architekturzentrum Wien

MUMOK - MuseumsQuartier Wien
Neubau, Wien (A) - 2001
O&O Baukunst
Architekturzentrum Wien

Halle E + G - MuseumsQuartier Wien
Umbau, Wien (A) - 2001
O&O Baukunst, Manfred Wehdorn
Architekturzentrum Wien

KUNSTHALLE wien - MuseumsQuartier Wien
Neubau, Wien (A) - 2001
O&O Baukunst
Architekturzentrum Wien