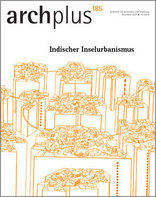Zeitschrift

Auf dem Weg zu einem hässlichen Indien
Geht man in irgendeiner beliebigen Stadt die Hauptstraße hinunter, ist es immer dieselbe Geschichte: Straßen voller schreiender Reklame. Zwischen alten Monumenten liegen Exkremente im Müll. Entlang der Straße Imitate westlicher Bars, französische Restaurants, Hallen aus Granit und klimatisierte Einkaufsarkaden. Bittere deutsche Schokolade, Kaffee und warme Croissants inmitten des Gestanks eines Markturinals. Man watet durch den Schlamm eines überlaufenden Abflusses, um in einem imitierten Londoner Gasthaus zu speisen. So kontrastieren Momente des völligen Verfalls und des übersteigerten Genusses. Dies ist der neue Geschmack des urbanen Indien.
Und es gibt eine wachsende Kluft zwischen den Menschen, die den gleichen Raum besetzen: Parkplätze, die für Hotels reserviert sind, Migrantenfamilien in Abwasserkanälen, Wachhunde und hohe Schutzmauern, Sicherheitsdienste und BMWs. Wohnungen in Industriesümpfen, mit Reklame verunstaltete Bürofassaden, Farmhäuser ohne Farm oder irgendeine Beziehung zum Land, barocke Villen ohne Verbindung zu Rom. Ist es überraschend, wenn wir so angewidert sind von den Orten, die wir für uns selbst schaffen?
Die Zusammenhanglosigkeit der Stadt
Kürzlich erkannte ich auf einer Reise nach Rishikesh blitzartig, woher der Hass kam. Denn dort am Ufer des Flusses waren zwei Ansichten der Stadt tief in die Skyline geprägt. Jenseits des rauschenden Flusses konnte ich die freundliche Silhouette des Hinduismus erkennen – eine Linie von Ghats dicht am Ufer, schlichte Tempelumrisse und eine Folge von Ahram-Fenstern in weiß getünchten Wänden entlang der Straße. Ein einfaches Leben, einfach ausgedrückt. Doch auf meiner Seite des Flusses bot die Stadt ein erschreckendes, zeitgenössisches Bild. Entlang der Hauptverkehrsstraße erstreckte sich die nordindische Standardstadt mit ihren Slums. Rosa und gelb verputzte Häuser, unvollendete pastellfarbene Bauten, vom Monsun beschmutzt, an der Basis mit ausgespucktem Betel und Urin besudelt und an der Spitze durch Reklamezeichen verunstaltet. Es gab Pepsi-Schilder, klimatisierte Einkaufsarkaden und Hotels aus Rajasthani-Sandstein, alle mit getönten, an den Rändern gewellten Fenstern, die der Fassade einen speziellen ironischen Anklang verliehen, einen architektonischen Akzent, damit die Leute wussten, dass dies das Mughal Ganga Hotel war, schöner als die Krishna Palace Lodge unten an der Straße. Jedes Hotel hatte eine Bar und ein Restaurant im Freien. Jedes hatte Ausblick auf den Fluss. Jedes versuchte das andere in Design, Farbe, Details und Reklamemätzchen zu übertreffen. Die alte Stadt am anderen Ufer dagegen war ein stummer, melancholischer Zeuge der architektonischen Veränderungen.
Sollte die Architektur wie andere Bereiche der Populärkultur etwas vom Geschmack und von den Verhältnissen der Gegenwart widerspiegeln? Tut sie es, so wird sie schließlich auch die Trostlosigkeit der Straßen aufzeigen, die Verwahrlosung der kommerziellen Zonen, die Zusammenhanglosigkeit des öffentlichen Wohnbaus, die alle zu jenem Gefühl der Isolation beitragen, das die Menschen in der Stadt empfinden. Eine positive Identifikation zu vermitteln, ist die schwere Bürde, die der alten Architektur überlassen bleibt: die Ashrams von Rishikesh, die Ghats von Vrindavan, die Moscheen von Delhi – Bauten, die nicht nur unsere Vorstellungswelt bilden, sondern auch die notwendigen Orte schaffen, die Geschichte, die wir für uns selbst brauchen.
Die Zusammenhanglosigkeit der Stadt hat freilich eine lange Entwicklung hinter sich. Rapide steigende Bevölkerungszahlen, das Wachstum der Stadtzentren, chronische Arbeitslosigkeit und die schwierige Wirtschaftslage haben in den letzten fünfzig Jahren auf die gebaute Landschaft der Stadt eingewirkt. Der wachsende Druck auf städtische Grundstücke aufgrund der zunehmenden Urbanisierung führte zu unkontrolliert wuchernden Stadtzentren, die dem öffentlichen Raum und der urbanen Architektur einen neuen Maßstab verliehen.
Öffentlicher Raum: eine westliche Vorstellung
Architektur beeinflusst den öffentlichen Raum in vielfältiger Weise. Sie bestimmt, was wir im öffentlichen Bereich einer Stadt erleben, wie wir uns zwischen den Gebäuden bewegen, wie diese Bewegung in Bild und Klang eingefangen wird, wie sie sich durch Objekte und Landmarken verändern kann – Parks, Gebäude, Reklamewände. Alle diese Elemente, ob bewusst geplant oder zufällig vorhanden, ihre physische Erscheinung und ihre Wahrnehmung, Distanz und Nähe sind Teil des Szenarios, das sich urbanes Leben nennt.
Gibt es in Indien einen bewusst kultivierten Sinn für den öffentlichen Raum, den Bereich außerhalb unseres Hauses? Erfassen wir intuitiv, wie die Stadt angelegt und genutzt werden muss? Gibt es also eine indische Identifikation mit öffentlichen Räumen – ein Gefühl der Zwanglosigkeit und der Aneignung, das sich von den Normen des öffentlichen Lebens im Westen unterscheidet?
Man betrachte den Nehru Place. Er wurde in den 1960er Jahren als erhöhte Plaza mit Arkaden und Fußgängerzugang zu den Läden und Büros konzipiert. Die offenen Fronten sollten an die großen Plätze Europas erinnern – San Marco, vielleicht die Piazza Navona. Die Menschen sollten sich in den offenen Bereichen versammeln, umgeben von klaren modernistischen Bauten, mit Freiluftcafés auf den asphaltierten Flächen und Straßenmusikern im Herbstlicht. So entstand ein sozial idealisierter Außenraum nach den Vorstellungen der städtischen westlichen Mittelklasse. Gab es eine Diskrepanz zwischen dem Ideal und der Realität? Oder war das Konzept des Nehru Place von vornherein verfehlt?
Vielleicht ist dies ein zu harsches und unfaires Urteil über die Architekten des Nehru Place. Schließlich erleiden alle Bauten in Indien das Schicksal dieses Platzes. Wie hässlich, ordinär, armselig und geistlos der Nehru Place auch ist – an ihm vollzieht sich ein typisch indisches Phänomen, das man jeden Tag in jeder indischen Stadt beobachten kann. Man überlasse irgendein Gebäude unkontrolliert der freien Aneignung – sei es das Taj Mahal, der Connaught Place oder das Victoria Memorial, irgendeins. Man lehne sich zurück und warte. Man warte eine Woche, einen Monat, ein Jahr. Die Leute würden anfangen, jede freie Fläche in Beschlag zu nehmen: Paan-Shops auf Fensterbänken, Kopierzentren in Nischen für Feuerlöscher, Restaurants in fensterlosen Kellern, Küchen unter Treppen. Wäsche trocknet an Straßensperren, Menschen schlafen auf den Gehsteigen. Büros umbauen Balkone als eigene Räume. Der städtische Inder nimmt hemmungslos alles in Besitz, was sich im öffentlichen Raum befindet. Dass dieser Raum niemandem gehört, ist eine merkwürdige westliche Vorstellung; dass er von jedermann erhalten und bewahrt werden muss, eine völlig fernliegende Idee.
Das gute Leben ist insulär
Die Architekturgeschichte der Stadt ist eine Geschichte der Interessenkonflikte, in denen persönliche, nationale, regionale und internationale Identitäten aufeinander stoßen. Unbekümmert breiten sich hybride Stile wie Chandni-Chowk-Chippendale, Tamil-Tiffany, Marwari-Manierismus, Punjab-Barock, Bania-Gotik, anglo-indisches Rokoko und viele andere in den expandierenden Vororten so unterschiedlicher Orte wie Delhi, Madras, Bangalore und Lucknow aus. Sie verströmen einen gewissen selbstbewussten Charme. Eine solche trotzige Architektur ist jedoch nur die angstvolle Antwort auf das umgebende Elend, auf die langsam um sich greifende Hoffnungslosigkeit der Lehmhütten, der Notbehausungen in Abflussrohren und Schlaflager auf Gehsteigen, die in jedem Viertel einer jeden Stadt zu finden sind. In diesem Kontext dient Architektur lediglich dazu, Abstand zur deprimierenden Realität zu schaffen.
Aus Furcht vor der umgebenden Armut und Unsicherheit müssen die Bauten für angemessene Distanz sorgen, zwischen ihnen und uns, zwischen tiefster Not und unermesslichem Reichtum, zwischen ihrem abstrakten Leiden und unserem spürbaren Komfort, zwischen 80 Menschen an einer Handpumpe und einem Mann auf einem 80 Morgen großen Golfplatz. Ist diese Exklusivität aus irgendeinem Grund gefährdet, passt sich die Architektur einfach an. Scheint die Sicherheit bedroht, erheben sich Mauern; wird der Status in Frage gestellt, erscheinen neue, prunkhaftere Symbole an der Fassade. Reicht die städtische Wasserversorgung nicht aus, wird ein Röhrenbrunnen benutzt; fällt der Strom aus, übernimmt ein Inverter. Polizei, Wasser, Strom, wer braucht sie? Wer braucht die Stadt? Das gute Leben ist insulär, und die Architektur muss dafür sorgen, dass es so bleibt.
Architektur und kollektive Identität
Indien ist heute der größte Markt der Bauwirtschaft, mit Projekten im Wert von geschätzten 500 Milliarden Rupien (ca. 9 Milliarden Euro), die derzeit im Bau oder in Planung sind. Allein im letzten Jahr wurden 80 Postämter sowie 120 Bahnhöfe und 160 Brücken im Land gebaut. In Delhi wurden 140 Busstationen und 12 neue Depots errichtet. Natürlich gingen alle 80 Postämter, ob in den Stammesgebieten von Madhya Pradesh oder in den schneebedeckten Bergen Ladakhs, auf die Standardentwürfe der Regierung zurück. Sie sehen alle gleich aus, ohne Rücksicht auf Besonderheiten der Lage, des Klimas und der Vegetation. Gerichtsgebäude sehen aus wie Feuerwehrwachen, Schulen wie Krankenhäuser und Krankenhäuser wie Gerichtsgebäude.
In unserem Zeitalter der Stilkopien, der schnellen Akzeptanz und Ablehnung, der Langeweile gibt es in Indien nur wenige Versuche, öffentliche Bauten als einprägsame Orte zu gestalten, die für die lokalen Gegebenheiten charakteristisch sind. Hat eine bestimmte Brücke sich einmal als erfolgreich erwiesen, wird sie überall im Land immer wieder gebaut, über jeden Kanal, jede Schlucht und jedes Flussbett, bis alles gleich aussieht.
Uns bleibt nichts, was einen dauerhaften architektonischen Wert besitzt. Nichts, was sich lokal entwickelt hat, von heutigen Händen und im Rahmen unseres eigenen Lebens innerhalb unserer Zeit geschaffen wurde, entstand in einem Augenblick des Stolzes. Immer, wenn Mike Woolridge von BBC vor dem India Gate seinen Bericht abliefert, bin ich von stillem Zorn erfüllt. Nicht, weil hier ein Engländer vor einer englischen Landmarke in meiner Stadt steht. Nein. Sondern weil ich mich frage, warum wir in den 70 Jahren seit dem India Gate immer noch kein architektonisches Symbol produziert haben, das einer Darstellung wert ist. Etwas, das Bürgerstolz entstehen lässt.
Was als neue Ikone für Delhi in Frage kommt, sind die Kilometer von Wohnsiedlungen, sich selbst finanzierende Projekte, die verfallen, abblättern, bröckeln und verschmutzen, gelbe Zitadellen, die sich auf Brachland unendlich bis zum fernen Horizont erstrecken. Sie definieren das neue öffentliche Bild Indiens. Es sind genau diese Bilder, die im Gedächtnis bleiben werden.
Inwieweit symbolisiert das heutige Erscheinungsbild Indiens die Identität einer jungen Nation und einer alten Kultur? Spielt Architektur eine Rolle in der kollektiven Identität eines Volkes? Tragen Bauwerke dazu bei, unser Selbstwertgefühl zu stärken?
Wann begann der indische Traum zu schwinden? Gab es je einen indischen Traum? Oder war unsere Baukultur stets auf Anleihen angewiesen? Der Weg von Mohenjo-Daro und Fatehpur Sikri nach New Jersey ist lang. Doch wir sind genau dort angekommen, vielleicht ein wenig müde nach der langen Reise, ein wenig erschöpft durch die Überquerung von Kontinenten und Jahrhunderten – aber es war die Sache wert. Jedes neue Geschäft in der Stadt – ob in Ahmedabad, Delhi, Bombay oder Bangalore – hat nun eine glitzernde Granitfassade, ein Glanz, der ein Jahrhundert der offiziellen Pastellfarben und Monsunflecken sofort beseitigt. Im Innern einer Shopping Mall wird der suburbane amerikanische Traum wahr, werden Dritte und Erste Welt unterschiedslos. Aber wen kümmert es? Schließlich gibt es keine bessere Alternative für Freizeit und Vergnügung als frei nach Gusto die Symbole des suburbanen Amerika zu plündern.
Endlich begegnen sich Kommerz und Architektur in einer globalen Umgebung. Es könnte Kairo sein oder Rio oder Delhi; nur die Gesichter sind brauner, und es gibt rote Betel-Spucke in den Ecken und einen Staubschleier auf dem Granit. Doch Architektur spielt nur eine geringe Rolle. Sie überspielt das sterile Gesicht der Bauten mit ihrer eigenen Kultur der Zerstreuung, passt sich den Wünschen an und prägt kurzlebige, häufig missverstandene Identitäten.
Nach den vereinheitlichenden Stilen der Mogul-Kaiser und den axialen Stadträumen des kolonialen Delhi spricht die neue Stadt nun eine zusammenhanglose Sprache. Reines Geschwätz. Ein Spektakel der Oberflächen. Eine unverschämte architektonische Praxis – und ein kollektives Signal für schrille Effekte ohne Methode. Die neue Stadt ist ein Ort der kurzfristigen Versuchung, nicht des vergnüglichen Schlenderns. Sie hat Platz für das Fast-Food-Restaurant, nicht jedoch für den duftenden Mogul-Garten.
Natürlich wäre es töricht, eine Rückkehr zu den Werten und Räumen der Vergangenheit zu fordern. Es lohnt sich tatsächlich wenig, den gegenwärtigen fehlgeleiteten Reichtum des Landes in Frage zu stellen oder abzulehnen: die wenigen materiell Reichen streben nicht gerade nach Veränderungen. Doch angesichts von Armut, falsch angewendeter Technologie und ineffizienter Ausnutzung bestehender Einrichtungen und Ressourcen sollte vielleicht eine rationalere Programmatik den Entwurfsprozess öffentlicher Räume bestimmen.
Vor dem Hintergrund der extremen Situation mit anhaltender ländlicher Armut, Landflucht, Obdachlosigkeit und städtischem Elend ist eine radikale Position erforderlich. Die unvorstellbar großen Unterschiede in der Lebensqualität, der Würgegriff der Baugesetze und die Überbevölkerung zwingen zu fantasievollen Lösungen beim Entwurf von Orten für Wohnen, Arbeit, Freizeit und Unterhaltung.
Wie sähe die städtische oder ländliche Umwelt aus, wenn wir einen anderen Kurs eingeschlagen hätten? Lebten wir ein anderes Leben, wenn sich andere Ideen im Bauen, in der Planung, im Urbanismus und im Design ausgedrückt hätten? Ist es möglich, aus Fehlern zu lernen und jetzt eine neue Orientierung zu finden, unsere Wahrnehmung der Stadt und ihrer öffentlichen Orte mitsamt ihrer Einzelbauten zu ändern? Oder ist es zu spät?
Für den Beitrag verantwortlich: ARCH+
Ansprechpartner:in für diese Seite: Anh-Linh Ngo