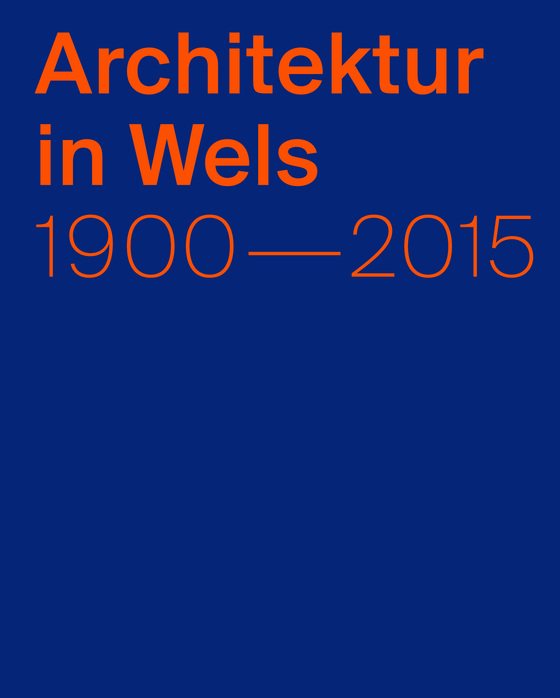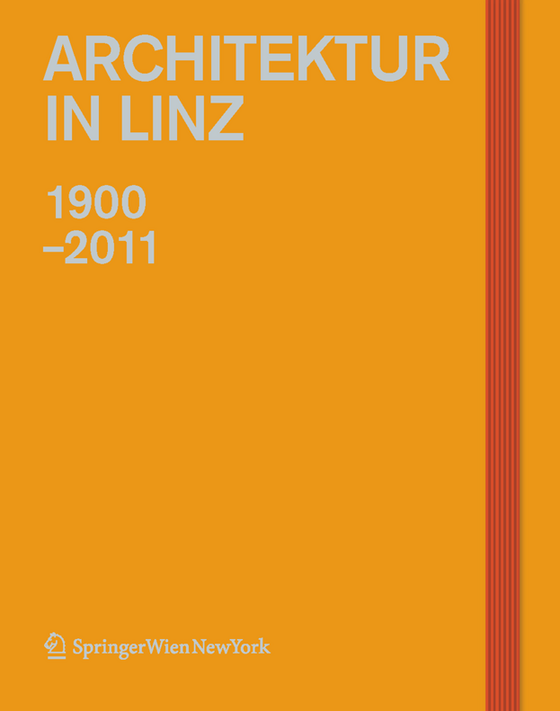Artikel
Kommunalbau: Wichtige Impulse für lebendige Orte setzen
Die Gemeinden sind im Wandel - Kommunalbauten sind architektonische Vorbilder.
Kindergärten, Horte, Altenheime, Bauhöfe, Feuerwehren, Pflichtschulen und Turnhallen, aber auch Kulturzentren, Veranstaltungssäle, Plätze oder Friedhöfe gehören neben der kommunalen Infrastruktur und den eigentlichen Stadtämtern zu den vielfältigen Bauaufgaben, die Gemeinden bei aktuell oft engen Haushalten bewältigen müssen.
Lebendige kleine Dörfer und Gemeinden mit landwirtschaftlicher Prägung, das war einmal. Viele Orte sind heute Schlafdörfer für Pendler aus den Ballungsgebieten. Dazu gehört die Verhüttelung durch Einfamilienhäuser, geschlossene Gasthäuser, Läden und Schulen.
Die Ortskerne sind in Folge nicht mehr die Orte des Gemeinwesens. Stattdessen hat sich an den Rändern der Ortschaften ein Drive-In aus verschiedenen Angeboten entwickelt, mittlerweile befindet sich dort nicht nur der übliche Supermarkt oder die Werkstatt sondern auch die Bäckerei, die Apotheke oder der Arzt. Damit verlassen viele Nutzungen die Ortszentren, die vormals die Lebendigkeit der Zentren prägten.
Viele Gemeinden haben erkannt, dass ein lebendiges Ortszentrum wichtig ist und neben der Versorgung auch Identifikations- und Kommunikationsaufgaben leistet. Dort sollten die wichtigsten Einrichtungen fürs tägliche Leben zusammenkommen. Dabei geht es nicht darum, das Dorf neu zu erfinden, sondern eigene Potenziale zu erkennen. Seit rund zehn Jahren hat so eine kleine Renaissance der Ortskerne stattgefunden. Was können Kommunen dafür tun? Wesentlich sind raumplanerische Zugänge, Verkehrslösungen und eine Attraktivierung der Zentren durch viele koordinierte kleine Maßnahmen.
Einen wichtigen architektonischen Baustein stellen die vielerorts errichteten neuen Kommunalbauten dar, die scheinbar unübliche Nutzungen und Räumlichkeiten oft unter einem Dach kombinieren. Diese Hybride aus Amtshaus, Trauungssaal, Musikschule und Musikproberaum beispielsweise setzen nicht nur gestalterisch einen Impuls, sondern schaffen auch eine zeitgemäße und lebendige Nutzung der Ortszentren.
Beispiele dafür gibt es genug. Das 2008 fertiggestellte Gemeindezentrum in Weißkirchen an der Traun vereint Bürgerservice, Büros der Gemeinde, Trauungssaal, Musikraum und eine Hausmeisterwohnung. Von Anfang an ging es darum, aus den verschiedenen Einzelanforderungen einen Mehrwert für den Ort zu schaffen. Formal als kompaktes, einheitliches Volumen gestaltet, besteht das Haus aus ineinander geschobenen Nutzungen mit verschiedenen Eingängen.
Multifunktionale Zentren
Die 2010 und 2014 fertiggestellten neuen Stadtzentren in Meggenhofen (Two In A Box Architekten) bzw. Haid/ Ansfelden (Architektin Christa Lepschi) sind ähnlich gestrickt: Sie sind multifunktional, sind Impuls für eine nachhaltige Ortsentwicklung und schaffen einen neuen Ortsplatz. In Meggenhofen kommt noch ein Bürgerbeteiligungsprozess und die sorgfältige Nutzung wertvoller Altbauten dazu. Das Gleiche ist in Wels der Fall: Mit dem denkmalgeschützten Herminenhof wurde ein wertvoller Leerstand inmitten der Stadt revitalisiert, Musikschule, Bibliothek, Archiv und Volkshochschule ergeben neue Synergien und Raum für Jung und Alt.
Im 2013 fertiggestellten Gemeindeamt in Ottensheim (Sue Architekten) verschmelzen ebenfalls flexibel gestaltbare Veranstaltungssäle, Bürgerbüro, Verwaltung und Marktplatz bzw. Innenhof zu einem offenen Raum.
In Wallern wird mitten in der Ortschaft mit einem Veranstaltungszentrum auf engstem Raum verdichtet und ein Identifikationsort geschaffen (Schneider&Lengauer Architekten), in Sarleinsbach (Heidl Architekten) wird neben neuen Räumlichkeiten (Bibliothek, Musiksaal, Verwaltung) auch gleich die Verkehrssituation am Platz gelöst.
Alle Beispiele zeigen deutlich, dass über Architektur zwar keine strukturellen Probleme gelöst werden können, Bauobjekte sehr wohl aber spürbare Impulse für die Entwicklung von Gemeinden, deren Gemeinschaftssinn und Identifikationskraft setzen.
Reicht Grün in der Mitte?
Der erste Bauabschnitt des Wohnprojekts „Grüne Mitte“ wurde gerade fertiggestellt, die ersten Bewohner ziehen ein. Drumherum sind Kräne und Baustelle. Bis 2016 entstehen hier – auf dem Areal des ehemaligen Frachtenbahnhofs – insgesamt 800 Wohnungen.
Rechnet man die zahlreichen Bauvorhaben auf den angrenzenden Brachen dazu, werden in den nächsten Jahren in diesem Stadtteil insgesamt rund 1500 Wohnungen geschaffen. Geschätzte 4500 Menschen werden dann hier leben.
Sicher also die größte, zusammenhängende Linzer Wohnbauentwicklung seit der Solar City. Die Lage und das Umfeld sind zwar schwierig, aber besser als es scheint. Doch schon jetzt lassen sich städtebauliche Schwächen erkennen.
Hier entsteht eine Kleinstadt
Bereits seit 2001 arbeitet die Stadt Linz gemeinsam mit den ÖBB an der Entwicklung dieses Gebiets unter dem Arbeitstitel „Trendzone Linz-Mitte“. 2005 wurde das 86.000 Quadratmeter große Areal um 7,65 Millionen Euro von der Stadt angekauft. Im darauffolgenden Jahr erfolgte ein städtebaulicher Wettbewerb, dessen Ergebnis eine ausgedehnte Blockrandbebauung vorsieht. Ein 14.000 Quadratmeter großer Park in der Mitte soll die Lage an der lauten Westbahn und Lastenstraße kompensieren.
Die Entwicklung dieses Areals ist ein wichtiger Schritt in Richtung Verdichtung und inneres Wachstum der Stadt Linz. Autos wurden konsequent aus dem Quartier rausgehalten. Große begrünte Terrassen und Balkone versprechen zwar noch keine „hängenden Gärten“, aber doch weit mehr Grün als im sozialen Wohnbau üblich. Wettbewerbe wurden ausgelobt, um zu Projekten zu kommen. Die Ausführung ist insgesamt über dem gewohnten Durchschnitt, und die Anstrengung, etwas Besonderes zu machen, ist spürbar.
Gerade wegen der Größe der Entwicklung gibt es aber deutliche Kritikpunkte: Gab es ein fundiertes Gesamtkonzept in Hinblick auf ein lebendiges und funktionierendes Quartier? Nein. Wurden die Wohnungstypen und Größen untereinander abgestimmt? Nein. Gibt es Erdgeschoßzonen für Gewerbe und Büros? Kaum. Wurde zumindest durch höhere Erdgeschoßzonen für die spätere Möglichkeit gesorgt? Nein.
Gibt es billige Starter-Wohnungen, Kleinstwohnungen oder Sonderformen im Sinne einer sofortigen und zukünftigen Durchmischung? Nein. Weil von billig die Rede ist: Ist einer der Bauten ein Experimentalbau mit dem Ziel wirklich billig zu bauen? (Beispiel Architekten Lacaton & Vassal in Mulhouse) Nein. Wird eine Schule gebaut bzw. Fläche dafür freigehalten? Nein.
Sind Miete, Mietkauf und Eigentum gut gemischt im Sinne einer sozialen Durchmischung? Leider nein. Wurden kleinere Parzellen für kleine Bauträger oder Baugruppen zur Verfügung gestellt? Nein. Wurden in Anbetracht der Größe des Vorhabens (rund 45.000 m² Wohnnutzfläche) andere Disziplinen wie Soziologen, Mobilitätsexperten oder Wohnbauforscher beigezogen? Nein. Apropos: Wurden neuere Modelle der Mobilität, des Carsharings oder Poolings bzw. der Reduktion von Stellplätzen auf zum Beispiel nur einen Platz pro 100 Quadratmeter (und nicht pro Wohneinheit) umgesetzt? Nein. Warum wurde nicht der alte Bahnhof als identitätsstiftendes Merkmal (z. B. für den Kindergarten) belassen? Zu kompliziert ...
Innovativere Prozesse
Gute Chancen bestehen, dass sich das Areal gut in die Stadtstruktur eingliedert. Das Musiktheater und die angrenzende Landstraße sind fußläufig erreichbar. Im Idealfall wird dies in Zukunft quer durch den St.-Barbara-Friedhof möglich sein. Die zweite Straßenbahnachse wird darüber hinaus den Standort immens aufwerten.
Das neue Quartier steht und fällt aber mit der eigenen grünen Mitte. Gelingt dieser Raum als städtischer Erholungsraum, ist die Architektur drumherum zweitrangig. Vergleicht man die Konzeption der „Grünen Mitte“ mit Projekten wie Tübingen Südstadt, Stockholm Hammerby oder der Entwicklung am ehemaligen Nordbahnhofgelände in Wien, wird deutlich, dass Linz dringend städtebaulich innovativere Prozesse und Entwicklungen braucht. Vor allem Tübingen zeigt, dass neue Stadtviertel lebendig, durchmischt und dicht sein können, indem ein paar einfache Spielregeln befolgt werden.
Wesentlich sind die Kleinteiligkeit, die Durchmischung (Miete, Eigentum, sozial, Baugruppe, Genossenschaft usw.) und gewerblich genutzte Erdgeschoße. Eigeninitiative Baugruppen spielen bei fast allen geglückten Neustadtvierteln in Europa eine gewichtige Rolle. Bestes aktuelles Beispiel ist „Wohnen mit Alles“ in Wien. Als Heim deklariert, in Form einer Baugruppe entstanden, setzt dieses Projekt architektonisch aber vor allem sozial und gesellschaftspolitisch Maßstäbe. Alles keine Hexerei, auch in Linz mit entsprechendem Willen leicht möglich.
Linzer Tabakfabrik ist großes Theater
Mit der Besiedelung von Bau 2 der Linzer Tabakfabrik ist es wieder Zeit, hinter die Kulissen zu schauen.
Von außen ist kaum etwas zu sehen. Gerade einmal die neue, hofseitige Rampe zwecks barrierefreiem Zugang sowie die Lichter am Abend sind Indiz dafür, dass etwas passiert ist. Seit Sommer 2012 wurde geplant, ab März 2013 gebaut. Vorige Woche wurde feierlich eröffnet, zumindest im obersten Stock, bei den Architekten Kleboth, Lindinger und Dollnig.
Zur Erinnerung: Die heutigen Mieter (Kleboth Lindinger Dollnig, die Firma Netural und Heinz Hochstetter) sind schon sehr früh initiativ mit einem Konzept und konkreten Wünschen zur Nutzung für genau diesen Bauteil an die Entwicklungsgesellschaft herangetreten. Dabei gab es weder einen Call für die Nutzung noch einen Wettbewerb für die Planung.
Nach rund eineinhalb Jahren Gesprächen und Verhandlungen hat die Stadt Linz schließlich fünf Millionen Euro in die Hand genommen und den Bau komplett saniert (Entwurf und Planung erfolgte durch das mietende Architekturbüro), um die 3000 Quadratmeter nun langfristig an das Konsortium zu vermieten. Die Geschichte dazu wurde schon ausführlich im Februar 2013 in den OÖNachrichten beleuchtet. Heute geht es nur um das Ergebnis.
Haus im Haus
Um bauphysikalische, denkmalpflegerische und gestalterische Anforderungen unter einen Hut zu bekommen, wurde das gemacht, was schon bei der Van Nelle Fabrik in Rotterdam (Architekt Wessel de Jong) erfolgreich war: Eine nach innen verlegte zweite Glashaut, die alle nötigen klimatischen Kriterien erfüllt, ohne die denkmalgeschützte Substanz angreifen zu müssen.
Im neuen doppelten Boden wurden Elektrik und Lüftung verlegt. Heizung und Kühlung wurden in eine abgehängte Decke gepackt, die auch schallschluckende Funktion aufweist. Ein Nachteil dieser Einbauten ist, das im Inneren der Box von der originalen Substanz nur mehr wenig erlebbar bleibt.
Zu spüren bleiben nur die betonummantelten Stahlsäulen und die Außenwände mit den Fensterbändern im „Linzer Blau“, die dafür gut in Szene gesetzt sind. Ein großer Vorteil der Haus-im-Haus-Konstruktion liegt darin, die originale Substanz weitgehend unverändert belassen zu können. Bestes Beispiel dafür sind die filigranen Fenster, die von der Metallwerkstätte Pöttinger nur ertüchtigt, d.h. in ihrer Funktion wieder hergestellt wurden. Die neue innenliegende, gebogene Glasfassade lebt offensichtlich von der sorgfältigen Planung und dem Know-how der ausführenden Firma GIG aus Attnang-Puchheim.
Aber: An Details, wie den lieblos geführten Kabeltassen, der etwas angestrengten Konstruktion der Zwischenwände oder der aufwändigen Haustechnik ist ein grundsätzliches Ringen zwischen Architektur und Technik sowie Vorschriften zu spüren.
Ein behutsamer Umgang mit dem 80 Jahre jungen Meisterwerk steht im Konflikt mit standardisierten, vermeintlichen Anforderungen (eines Neubaus). Mehr Ausnahme und weniger Norm hätten dem Umbau gut getan. Der Aufwand ist spürbar hoch – eine gewisse Coolness geht ab.
Ein mittlerweile bekanntes Beispiel für eine lässige Haltung und Herangehensweise ist das Wiener Hotel Daniel (Atelier Heiss Architekten) nahe dem neuen Hauptbahnhof. In ein ehemaliges – ebenfalls denkmalgeschütztes – Bürogebäude, wurden 2011 sehr entspannt Zimmer eingebaut. Ja, es gibt vielleicht Einbußen bezüglich des Komforts im Vergleich zu einem Neubau, aber das Flair des Hotels ist dadurch und nur dadurch einzigartig.
Bauteil 2 als Studienobjekt
Insgesamt konnte in der Tabakfabrik im nun abgeschlossenen Umbau des Bauteils 2 dank des hartnäckigen Einsatzes vor allem der Architekten und des Denkmalschutzes viel erreicht werden.
Ob der Umbau als Vorbild und Prototyp für Bauteil 1 Sinn macht, bedürfte einer offenen und mutigen Diskussion. Welche Rolle bei weiteren Schritten die Stadt selbst einnehmen soll, müsste wohl Teil der Diskussion sein.
Aber auch die Vorgehensweise insgesamt, die „Auswahl“ der Mieter, die Umbaustrategie, die Vergaben, die tatsächlichen Gesamtkosten und der Zeitplan wollen plausibel und nachvollziehbar erklärt werden.
Mehr als ein Prototyp, kann der Umbau als Studienobjekt genutzt werden: An diesem Versuch kann Gelungenes und weniger Gelungenes erkannt werden. Zum Copy & Paste taugt es sicher nicht. Dafür ist jeder Bauteil der Tabakfabrik zu unterschiedlich und bedarf jeweils seiner eigenen Lösung.
Totgesagte leben länger
er Lehar-Steg in Bad Ischl wurde mit Herz und Hirn für Schloss Parz repariert.
Aufgrund des jahrzehntelangen exzessiven Einsatzes von Streusalz und mangelnder Pflege war das Bauwerk am Ende. Ein Schrotthaufen, der lebensgefährlich ist und schnell weg muss. Gefahr in Verzug. Es geht um Sicherheit. Dagegen kann niemand etwas haben!
Zwar steht die Brücke selbstverständlich unter Denkmalschutz, aber das hat nichts zu bedeuten, wenn Sicherheit und Wirtschaftlichkeit oberstes Gebot sind. Gegenstimmen, auch von Fachleuten zählen nicht. Es zählt der Blick nach vorne. Über vergossene Milch sollte man nicht jammern, stattdessen aber tatkräftig in die Zukunft blicken.
Wir befinden uns aber nicht in Linz, sondern in Bad Ischl, der Kaiserstadt zwischen Tradition und Moderne, wie die Werbung verspricht. Bei der Brücke handelt es sich um den 114 Jahre alten „Lehar-Steg“, 52 Meter lang, 2,5 Meter breit, 2,7 Meter hoch und nur 30 Tonnen Material. Der Abriss der filigranen, genieteten Stahlfachwerkkonstruktion erfolgte 2012.
Nachdem der Denkmalschutz (um-)gefallen war und den Weg für die Demontage freigemacht hat, wurde an gleicher Stelle ein Neubau geplant. Dieser wurde in formaler Anlehnung und mit Verwendung der historischen Geländer (Hurra, ein Detail gerettet!) errichtet. Von Weitem sieht die rekonstruierte Brücke wie die alte aus, aus der Nähe aber offenbart sich der Schwindel. Die Form und Tragwerksart aus dem 19. Jahrhundert in aktueller Fertigungstechnik (Schweißen) herzustellen ist nicht stimmig, zeigt aber auch die Mutlosigkeit für eine Neugestaltung. Bei einem „Entwerfen“ an der Universität gäbe es dafür ein glattes „nicht Genügend“. Ohne Diskussion und zu Recht.
Schlosser trifft Schlossherr
Ab da nimmt die Geschichte einen originellen Lauf. Anstatt die Brücke einfach irgendwie zu zerstückeln und als Stahlschrott zu verwerten, wird sie auf Anraten von Metallrestaurator Christian Reisinger vorausschauend gezielt durchtrennt und zwischengelagert. Und zufällig, also gar nicht zufällig, trifft Herrn Reisinger auf die richtige Person, nämlich Georg Spiegelfeld, der gerade einen neuen Steg für sein Wasserschloss Parz (Grieskirchen) plant. Spiegelfeld lässt den „Schrott“ von Fachleuten untersuchen, schweißtechnisch prüfen und statisch rechnen, um ihn dann für 5000 Euro zu kaufen.
2000 Stunden Arbeit
Anschließend wird das gute Stück von der Metallwerkstatt Pöttinger aus Taufkirchen mit fünf Mitarbeitern in 2000 Stunden Arbeit repariert, händisch entrostet, gebürstet, geschliffen, neu grundiert, Hohlräume ausgespritzt und neu lackiert. Kosten der Stahlarbeiten inkl. Stützen, Geländer und Boden: 160.000 Euro.
Gesamtkosten des neuen barreriefreien Zugangs zum Schloss inklusive der Fundamente, Zufahrt und Transport: 210.000 Euro. Kosten des Neubaus in Bad Ischl: 320.000 Euro.
Die reparierte Brücke ist vergleichbar mit einer neuen und zumindest 20 Jahre wartungsfrei. Bei der Instandsetzung wurden nur zehn Prozent des Originalmaterials ausgetauscht. Die Wertschöpfung ist dabei zu 100 Prozent in der Region erfolgt.
Da Arbeitskosten 80 Prozent der Gesamtkosten ausmachen, geht ein Großteil davon (in Form von Sozialabgaben) zurück an die öffentliche Hand. Im Fall eines industriell gefertigten Bauwerks verhält es sich genau gegenteilig.
Auch die CO2 Bilanz der reparierten Brücke ist unvergleichlich besser als die des Neubaus.
Angenommen, die Eisenbahnbrücke in Linz würde 100 mal so viel Arbeit machen (die unbedingt in situ passieren müsste) dann sprechen wir von 200.000 Arbeitsstunden und Kosten für den Stahlbau in Höhe von elf Millionen Euro. Dazu kommen Hebezeug, die Ertüchtigung der Pfeiler, Konsulenten und die Beläge.
Und die Eisenbahnbrücke?
Angebote um 24 Millionen Euro gibt es. Vorausgesetzt der politische Wille ist vorhanden, stellt die Reparatur zu diesen Kosten, das bestätigen vielfache Aussagen von Experten, kein Problem dar. Gerade in Oberösterreich und in der Stahl- und Kulturstadt Linz.
Black Box, White Cube, Schaulager?
Ein Angerlehner Museum in Thalheim zeigt, wie Kunst kommuniziert werden kann.
Wir kennen das beispielsweise aus Amerika, Deutschland und der Schweiz: Industrielle oder Unternehmer sammeln Kunst, zum Teil strategisch, zum Teil ganz nach persönlichen Vorlieben. Wenn der Platz nicht mehr reicht oder die Sorge um die Werke steigt, bauen sich diese ihr privates Museum.
Oft geschieht das gleich direkt am Ort ihres Wirkens, da, wo man in der Regel kein Museum erwarten würde. In Österreich gibt’s davon eine Handvoll: die Sammlung Essl in Klosterneuburg, das Museum Liaunig in Neuhaus (Kärnten); aber auch das Artemons Kunstmuseum in Hellmonsödt beispielsweise. Nun ist ein solches – ein herausragendes noch dazu – an einem erneut überraschenden Ort dazugekommen.
Heinz Angerlehner, Gründer und Eigentümer des Welser Industrieanlagenbauers FMT, ist dabei gründlich vorgegangen. 16 Architekturbüros wurden zum Wettbewerb geladen, darunter so bekannte wie das von Dietmar Feichtinger aus Paris, Carl Pruscha aus Wien, Wolfgang Pauzenberger und Michael Hofstätter (pauhof) aus Wien/Linz und Weber Hofer aus Zürich.
Gewonnen hat aber überraschend das junge Büro Wolf Architektur aus Grieskirchen. Sie konnten die ebenfalls bestens besetzte Jury (u. a. Elke Meissl, Gerhard Sailer und Peter Baum) durch eine schlichte, aber raffinierte räumliche Konzeption überzeugen.
Geschickt organisiert
Aus einer bestehenden, ehemaligen Maschinen-Produktionshalle ist ein Museum neuen Zuschnitts entstanden. Neben gut gewählter Materialien haben die Architekten vor allem geschickt organisiert. Vom Eingang wird bereits der komplette Überblick aufs Innere gewährt. Ganz hinten leuchtet der angrenzende kleine Wald, unmittelbar links sitzt das verglaste und komplett einsehbare Depot. Schräg hinten lockt die große, hohe Halle. Die sichtbare Treppe zieht den Besucher ins obere Geschoß. Dort befinden sich vier kleinere, unterschiedlich ausgeprägte Räume. Sie wurden in die bestehende Halle eingeschoben. So konnte die Größe der Halle (20 x 60 m) erhalten bleiben. Alle Übergänge sind fließend. Die Nutzung ist für ein Museum unüblich offen – fast wie eine multifunktionale Produktionshalle.
Zu Fuß gut erreichbar
Farblich wurde im Museum Angerlehner in Thalheim bei Wels sehr reduziert, aber stringent gearbeitet. Die Bestandshallen als Grundstruktur wurden mattschwarz gestrichen.
Weiß ist den neuen Museumsräumen vorbehalten. Natürliches Licht kommt durch gut gesetzte Fenster und Öffnungen in der Decke. Die Hülle des Museums – ganz in Schwarz – gibt sich geschlossen und wirkt wie eine geheimnisvolle, etwas entrückte Blackbox in dieser charmant unordentlichen Umgebung.
Das Ineinandergreifen von Empfang, Veranstalten, Ausstellen und Lagern ist Programm. Der Sinn und Zweck eines neuen Museums moderner Kunst wird damit leicht verständlich.
Noch nicht einwandfrei
Peter Assmann, der Leiter des Museums, hebt hervor, dass dies in Österreich eine prägnante museale Position darstellt. Er spürt dies in seiner täglichen Arbeit: „Noch nie konnte ich so viele Menschen von moderner Kunst überzeugen wie in den vergangenen Monaten. Das ist auch der Architektur, die hier vermittelt, zu verdanken.“
In der aktuellen Ausstellung spielen Hängung und Architektur noch nicht einwandfrei zusammen. Werke an den Außenseiten der eingeschobenen Boxen (in der großen Halle) haben dort nichts verloren. Die Wand wird dadurch beliebig, die Box verliert in Folge ihre Bedeutung. Die Wirkung aus dem Wechselspiel aus großer Halle und kleinen „Implantaten“ wird empfindlich geschwächt. Abgesehen davon ist der Betrachtungswinkel von allen Seiten ungünstig.
Auch die Außenraumgestaltung bleibt hinter der klugen Architektur zurück. Zäune (wozu eigentlich?!), biedere Oberflächen und Details sowie die parkenden Autos wirken ernüchternd. In den nächsten Jahren könnte das Museum Angerlehner sich noch einmal des umliegenden Freiraums widmen und diesen in der gleichen Qualität wie die Architektur herstellen.
Mit den neuen Verbindungen über den Aiterbach und die Traun – Steg und Brücke, beide entworfen von Erhard Kargel – wurde die gestalterische Latte ja ebenfalls schon sehr hoch gelegt.
Die Finanzierung, gemeinsam durch Land, Stadt und Heinz Angerlehner, ist dabei vorbildhaft. Schon jetzt können Besucher dank dieser Abkürzung direkt aus der Welser Innenstadt ins Museum spazieren.
Super legale Häuser am Froschberg
Wildwuchs, und fast alle machen mit – auch die Architekten.
Natürlich könnte auch von jeder anderen „besseren“ Wohngegend in Linz die Rede sein. Am Froschberg ist der Wildwuchs großer Bauten aber aktuell gut zu erläutern. Die Siedlungsstruktur ist gewachsen und kleinteilig, Einfamilienhäuser aus den 1930ern bis heute dominieren die Straßen. Grundstücke sind rar, der Druck auf restliche Flächen groß.
Das Bauvorhaben Schultestraße 18 wurde trotz Einsprüchen der Anrainer auch vom Gestaltungsbeirat genehmigt. Der Entwurf (F2 Architekten, Schwanenstadt) verspricht ein extrovertiertes, interessantes Haus. Offensichtlich in formaler Anlehnung an das Meisterwerk „Fallingwater“ des amerikanischen Architekten Frank Lloyd Wright stapelt es zueinander versetzte, weit auskragende Terrassen übereinander. Stiegen verbinden diese. Klingt gut und ist sicher auch ein Wohnerlebnis. Leider fehlt – im Gegensatz zum Original – die dramatische Topografie, die umliegende Natur, schlichtweg einfach der Platz. Stattdessen wurde das Haus auf einer nur 500 Quadratmeter kleinen (aus einem größeren Grundstück herausgezwickten) Parzelle errichtet.
Angrenzende Nachbarn sind nachvollziehbar nicht bereit, das Haus als spektakuläre, moderne Architektur für einen innovativen Unternehmer und als Zugewinn für die Gegend wahrzunehmen. Sie fühlen sich vom minimalen Abstand, der Höhe und der Dominanz des Bauwerks beeinträchtigt.
Wie ist es möglich, derartige Kubaturen in Linz genehmigt zu bekommen? Im vorliegenden Fall gab es einen Uraltbebauungsplan von 1969 mit offener Bauweise, maximal zweigeschossig und nur äußerer Baufluchtlinie.
Pseudokeller
Das Haus wurde auf dieser Grundlage in Kombination mit den seit Jahren in ganz Linz geltenden Richtlinien betreffend einer Hangbebauung genehmigt. Dabei ist nicht das bestehende Gelände maßgeblich, sondern ein zukünftiges (!). Dies ist in Wirklichkeit eine Aufforderung zur Geländeveränderung, um vollwertige Geschosse als Keller zu definieren und damit nicht zur maximalen Geschossflächenzahl zu rechnen.
Diese Pseudokeller treten aber talseitig als Vollgeschoss (hier in Summe vier, das heißt ca. 14 Meter hohe Fassadenfronten) in Erscheinung. Der mittlerweile erneuerte Bebauungsplan von 2012 nimmt Rücksicht auf das genehmigte Einzelprojekt und ermöglicht jetzt gleich für Dreiviertel des Bebauungsplanes eine Dreigeschossigkeit und „dank“ verbindlicher Richtlinien zwei und mehr solcher „Kellergeschosse“.
Dazu kommt, dass in einigen kürzlich erneuerten Bebauungsplänen jede Art von schriftlich dargestellter, städtebaulicher Zielsetzung gestrichen wurde. Damit wird der für den Froschberg bisher geltende Maßstab aufgelöst.
Ein Versehen? Wohl nicht. Investoren und finanziell potente Bauherren bekommen eine Spielwiese und eine regelrechte Anregung, die (dadurch auch wiederum wertgesteigerten) Grundstücke auszuquetschen.
Sicher wird auch in Zukunft versucht werden, jegliche rechtlichen und baulichen Möglichkeiten (dies gerade bei derart hochpreisigen Grundstücken) auszuschöpfen. Es liegt an der Stadt, ihren Juristen und ihren städtebaulichen Instrumenten, dies zu steuern, Tricksereien nicht zu tolerieren oder gar indirekt zu fördern, sondern eine Vision für ein Viertel im gesamtstädtischen Gefüge zu formulieren.
Im Fall des Froschbergs müssen einfache Regeln auch die absolute Hauptgesimshöhen (bezogen auf Bestand und Straßenniveau) beinhalten.
Gegen Partikularinteressen
Eine städtebauliche Leitlinie, auf die jederzeit zurückgegriffen werden kann, ist nicht nur notwendig, sondern eigentlich selbstverständlich. Aber auch die Architekten, weil Urheber und weil sie die Gestaltungskompetenz haben, stehen massiv in der Verantwortung. Diese endet nicht bei der Grundstücksgrenze und dem Auftraggeber!
Kleine, große, feine Box für die Toten
Die Aufbahrungshalle in Gutau ist ein moderner Raum der Kontemplation.
Eingebettet in den Bestand, zwischen der alten gotischen Pfarrkirche und einem benachbarten Bauernhof, steht auf dem Friedhof von Gutau (Bezirk Freistadt) die relativ neue, 2009 fertiggestellte Aufbahrungshalle. Geschlossen wirkt die weiß gekalkte Box schlicht und unauffällig, fast wie ein Nutzbau.
Es sind die knapp sechs Meter hohen, innen und außen mit Kupfer beschlagenen Tore, die dem Gebäude eine Monumentalität verleihen. Erst ihr Öffnen offenbart die räumliche Qualität im Inneren. Von diesem Wechselspiel aus offen und geschlossen, von Außen- und Innenraum lebt dieser einfache Schrein für Tote.
Geladener Wettbewerb
2008 gab es einen kleinen geladenen Wettbewerb. Schneider & Lengauer Architekten aus Neumarkt im Mühlkreis konnten diesen mit einem ihrer gewohnt pragmatischen als auch poetischen Entwürfe für sich entscheiden. Das Ergebnis ist ein kompromisslos moderner Bau in einem sensiblen, gewachsenen dörflichen Gefüge.
Die Topografie wurde geschickt genutzt, das Volumen steht satt eingebettet wie ein Passstück. Die simple Erscheinung schafft keine Konfrontation, sondern stärkt den Ort. Bis auf die längsseitig angeordneten Sitzbänke ist die 55 Quadratmeter große Halle leer. Ein einzelnes Oberlicht erhellt den Innenraum. Ursprünglich überhaupt ohne Fenster vorgesehen, wurde auf Empfehlung der Jury ein schmaler Schlitz nach Osten gesetzt. Dieser schafft Bezug nach Außen und lässt die Morgensonne herein. Die Wände sind weiß gekalkt, die Stirnseite mit Tannenstäben verkleidet, schlichte Leuchten hängen von der Holztramdecke.
Das reduzierte, von Holz und Kupfer geprägte Innere gibt den Toten und Trauernden ihren konzentrierten und würdigen Raum. Schlupftüren im Tor verschaffen schnellen Zutritt. Im ganz geöffneten Zustand wird die Halle zum überdachten Außenraum und der leicht ansteigende Vorplatz zum offenen Auditorium. Gekonnt hinter dem Gebäude und einer Stützmauer versteckt, befinden sich die nötigen Nebenräume sowie ein öffentliches WC.
Die Kosten beliefen sich auf 420.000 Euro brutto. Das ist für 117 Quadratmeter Nutzfläche ein relativ hoher Preis, der aber mit dem großen Volumen und der hochwertigen Ausführung (Tore, Materialien, Kühlraum) leicht zu erklären ist.
Früher war das Abschiednehmen inklusive Waschung und Andacht ein lebendiger Teil der Familie und (Dorf-)Gesellschaft. Dies fand zuhause in der Stube statt. Die Säkularisierung und die Tabuisierung des Todes hat den Prozess der Verabschiedung heute zu einem distanzierten, professionalisierten Vorgang werden lassen. Wegen des mittlerweile weit verbreiteten Wunsches zur Verbrennung der Toten ist die Verabschiedung zusätzlich in ihrem Ablauf unterbrochen. Das bedeutet, dass der finale Moment des Sarghinablassens und Zuschüttens abhanden kommt.
Spirituelle Stationen
Aufbahrungshallen wie diese sind demnach umso wichtigere spirituelle Stationen und Räume in einem sich auflösenden oder ändernden Ritual der Abschiednahme.