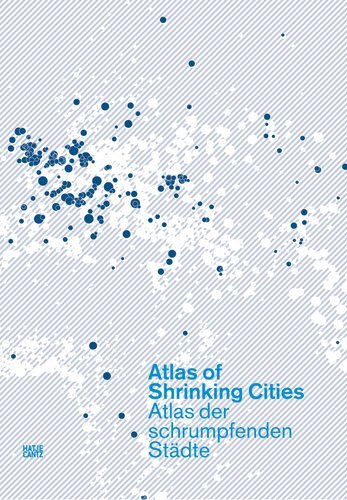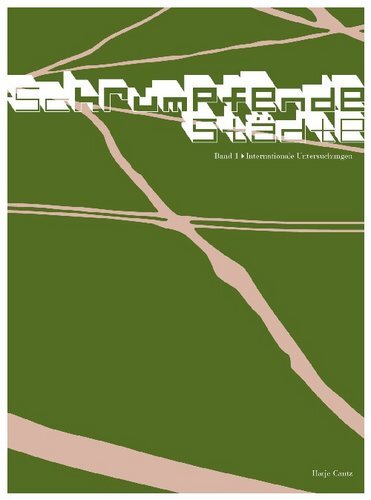Artikel
Rekonstruktion und Utopie
Das Unbehagen in der Moderne
Es wäre ein völliges Missverständnis, Rekonstruktionen in Architektur und Städtebau heute als etwas Konservatives zu sehen. Die heutigen Rekonstruktionsvorhaben sind etwas absolut Modernes. Die Kulturpraxis des Rekonstruierens von Bauwerken gibt es, wie Wilfried Nerdinger es in seiner Ausstellung am Architekturmuseum in München gezeigt hat, schon fast so lange wie das Bauen selbst. Aber sie ging bis zu Beginn der Moderne immer mit Aneignung und damit auch mit einer Aktualisierung einher. Die heute präferierte Form der Rekonstruktion, die fotografisch exakte Reproduktion der einstigen äußeren Erscheinung, stellt etwas sehr Spezifisches dar, das sich aus der Moderne entwickelt hat und erst durch das Aufkommen der technischen Bildmedien möglich geworden ist. Dies wird anhand des Berliner Schloss-Projektes sehr deutlich.
Rekonstruktion
Rekonstruktion ist heute eher eine fotografische als eine architektonische Praxis. Als Architekt der Rekonstruktion des Berliner Schlosses fungiert weder Andreas Schlüter (der Hauptarchitekt des Ursprungsgebäudes) noch Franco Stella (der mit der Rekonstruktion im Jahr 2009 beauftragte Architekt), sondern Albrecht Meydenbauer. Der Architekt Meydenbauer hatte ab Mitte des 19. Jahrhunderts die Möglichkeiten der Fotografie für die Dokumentation des baulichen Erbes erforscht. Resultat seiner Arbeit war die Erfindung der Photogrammetrie, welche sich inzwischen zu einem sehr wichtigen Arbeitsgebiet entwickelt hat. Meydenbauer entwickelte die photogrammetrischen Methoden und die Geräte hierzu und überzeugte den Preußischen Staat, das nationale bauliche Erbe durch photogrammetrische Dokumentation zu sichern. 1885 wurde dafür die Preußische Messbildanstalt eingerichtet, die in den folgenden 35 Jahren 2.600 Gebäude in über 20.000 photogrammetrischen Aufnahmen dokumentierte. Die photogrammetrischen Aufnahmen, oft im Format von 40 x 40 cm in sehr guter Auflösung, haben eine exakt definierte Geometrie, so dass man an Hand der zweidimensionalen Aufnahme die dreidimensionale Geometrie des Gebäudes kalkulieren und rekonstruieren kann. In den Jahren 1916-21 führte Meydenbauer die Dokumentation der Museumsinsel einschließlich des Berliner Schlosses durch, von dessen Fassaden etwa 45 Aufnahmen existieren.
Bei dem sogenannten „Wiederaufbau“ des Berliner Schlosses werden aus diesen Fotografien mit Hilfe von Computerprogrammen dreidimensionale Daten generiert, die dann als physische Objekte realisiert werden. So gesehen ist die Rekonstruktion des Schlosses kein architektonisches Projekt, sondern das Plotten von sechs Fotografien. Die Plots werden in Stein ausgeführt und haben eine Dicke von einem Meter.
Auf den Plänen der prämierten Wettbewerbsarbeit von Franco Stella ist dies deutlich erkennbar. Die „historischen Fassaden“ sind zeichnerisch anders dargestellt und wirken wie in ein anderes Gebäude hineincollagiert. Musterschülerhaft setzte Stella die politischen Vorgaben um und füllte das Gebäude hinter den geforderten Fassaden mit den vom Bauherrn gewünschten Funktionen. Aber es formuliert keine Lösung für das architektonische Problem, wie aus den sechs geplotteten Fassaden und den Innenräumen ein architektonisches Objekt entstehen kann.
Vor ein uninspiriertes Inneres ohne architektonischen Gedanken oder Idee sind bezugslos die ein Meter tiefen Fassadenplots montiert. Am offenkundigsten wird das Problem im Schlüterhof. Dort gibt es die Fassaden der einst wunderbaren, ausgesprochen dreidimensional-skulptural gestalteten Treppenhäuser. Bei Schlüter waren die Fassaden die äußere Erscheinung der dreidimensionalen Komposition der Treppenhäuser. Bei Stella befinden sich hinter dem äußeren Abbild der historischen Treppenhausfassade willkürlich irgendwelche Funktionsräume wie Lager- und Büroräume, Besprechungsräume und eine Mitarbeitercafeteria.
Das Ganze ist eine mediale Architektur und insofern sehr modern: eine Geburt der Architektur aus der Fotografie. Und dieses Bauwerk wird dann vornehmlich wieder zur Erstellung neuer medialer Bilder dienen. Dies könnte an sich ein interessanter Prozess sein, wenn er als eine intellektuelle Herausforderung und künstlerisch-gestalterische Aufgabe verstanden wird, wie wir es beispielsweise im Kontext der Kunst bei Thomas Demand in exemplarischer Weise finden. Aber der Vorgang wird beim Berliner Schloss nicht als kulturelle Aufgabe verstanden, sondern als technische, die man Ingenieuren überlässt. Es ist die Utopie einer Architektur ohne Architekten.
Der Wettbewerb für das Bauvorhaben war insofern sehr erfolgreich, als eine Person gefunden wurde, die formal gesehen die Position des Architekten bekleidet, aber de facto nicht als Architekt agiert. Insofern war die rechtliche Auseinandersetzung von Hans Kollhoff mit dem Bauherren und Stella für das architektonische Problem symptomatisch. Denn tatsächlich erfüllt Stella nur in sehr reduzierter Form die juristischen und repräsentativen Aufgaben des Architekten. Als entwurfliche Autorität ist er weitgehend abwesend. Architektur ist auch gar nicht gefragt, eben so wenig eine Handschrift, sondern die Abwesenheit einer Handschrift. Insofern diente der Wettbewerb zum Berliner Schloss dazu, einen Nichtarchitekten zu finden, was in bemerkenswerter Weise gelungen ist.
Das Berliner Schlossprojekt stellt dabei kein Einzelfall dar, sondern nur ein prominentes Beispiel einer umfassenderen Entwicklung. Inzwischen gibt es bei ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) ein internationales Komitee für die digitale Dokumentation des baulich-kulturellen Erbes. Die Objekte werden mit Laser eingescannt. Damit entsteht wie bei der Fotografie ein zeitlich eingefrorenes Stück Information. Zusammen mit der Technik des digitalen Plottens in Stein, die u.a. von chinesischen Unternehmen angeboten wird, ist es inzwischen möglich, in großen Quantitäten frühere Zustände von Bauten automatisiert zu reproduzieren oder zu vervielfältigen.
Utopie
Für die klassische Phase der Moderne in den 1920er-Jahren war Utopie die Vision von einer anderen, besseren Zukunft. In Berlin der letzten 20, 30 Jahre entwickelte sich ein anderes, rückwärtsgewandtes Konzept von Utopie. Die Utopie adressiert nicht mehr die Zukunft, sondern die Vergangenheit. Es bestand der Wunsch nach einer anderen Vergangenheit. Am liebsten würde man Dinge ungeschehen machen, was angesichts der Deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert eine verständliche Sehnsucht ist. Da dies unmöglich ist, versucht man den Anschein zu erwecken, als hätten sich Dinge nicht ereignet. Anders als bei den Utopien der klassischen Avantgarde geht es nicht darum, dass Alltagsleben und die Lebenspraxis zu verändern. Vielmehr will man bestehende Spuren und Repräsentationen der Vergangenheit auslöschen und durch neue Repräsentationen ersetzen. Diese neuen Geschichtsbilder und Narrative sollen das Identitätsverständnis der Gesellschaft verändern. Dabei ist die imaginierte andere Vergangenheit fiktional. Insofern handelt es sich durchaus um etwas Neues und auch um etwas Utopisches. Man will das 20. Jahrhundert – die eigentlich prägende Epoche für die Stadt – symbolisch auslöschen und mit dem 21. Jahrhundert direkt ans 19. Jahrhundert anknüpfen. Seit den 1970er-Jahren hat diese Haltung die Architekturentwicklung in Berlin mehr und mehr geprägt und sich dabei zunehmend radikalisiert. Das Ganze erinnert an die Schizophrenie einer gespaltenen Persönlichkeit, die sich vom eigenen Ich mehr und mehr entfernt und versucht, eine künstliche, neue Identität anzunehmen. Berlin ist offenkundig unfähig, zu sich selbst zu finden.
Nation
Traditioneller Weise dienten Monumente dazu, Machtverhältnisse darzustellen: Das Schloss, die Kirche, das Gericht. Im alten Berlin vor Beginn der Moderne gab es zwei große Monumente in der Stadt: Das Schloss als Repräsentation des irdischen Herrschers und der christliche Dom als Repräsentation des himmlischen Herrschers. Das war eine sehr klare und verständliche Visualisierung der Machtverhältnisse.
Heute hingegen wird Macht oft bewusst nicht veranschaulicht, gerade wirtschaftliche und politische Macht. Exemplarisch hierfür stehen die Hauptverwaltungen von Daimler Chrysler in Sindelfingen und von Microsoft in Seattle. Bei beiden sind die Gebäudemassen pavillionartig zergliedert und haben fast eine dorfartige Anmutung. Die Architektur bemüht sich, die tatsächlich vorhandene Macht nicht in Erscheinung zu bringen, sie zu verniedlichen. Die Architektur verfolgt ein Konzept der Tarnung.
Dem gegenüber steht die Monumentalisierung kultureller Einrichtungen. Kultur ist unverfänglich, niemand hat etwas gegen Kultur einzuwenden. Und gerade weil Kultur machtlos ist, wird sie heroisiert. Kulturbauten sind die Monumente der Gegenwart geworden.
Was bedeutet dies nun im Kontext der Berliner Debatte? Das Vorhaben einer Kunsthalle am Humboldthafen möchte der Oberbürgermeister als zeitgenössischen Monumentalbau à la Guggenheim Bilbao realisieren. Eine Option, welcher am Schlossplatz für die Entscheider nie in Frage kam. Der Schlossplatz ist ein politischer Ort, kein kultureller. Es ist ein Projekt zu der Frage, wie Deutschland als Staat, als Nation repräsentiert wird.
Die Rekonstruktion dient als Mantel, als Fiktion der Nichtsetzung: ein Rückgriff auf die Geschichte, der die Gegenwart scheinbar von einer Entscheidung entlastet. Die Rekonstruktion ist angeblich ein technischer Vorgang, kein kultureller. Der Architekt ist ein Toter (Schlüter) bzw. quasi ein Nichtarchitekt (Stella).
Natürlich ist die Rekonstruktion kein mechanischer Vorgang. Sie erzeugt eine moderne Architektur, sehr, sehr zeitgenössisch. Sie ist auch eine geschichtspolitische Setzung (und durchaus heroisch), die aber in der Camouflage einer unschuldigen Reparatur, einer mechanischen Reproduktion, einer gestalterischen Nichtentscheidung daherkommt. Für die Politik scheint dies die perfekte Lösung für die von ihr gewünschte Repräsentation des Nationalen heute zu sein.
Der Beitrag basiert auf dem Vortrag, den Philipp Oswalt anlässlich der Ausstellung „Nationalgalerie“ von Thomas Demand am 6.1.2010 in der Berliner Neuen Nationalgalerie gehalten hat. Hintergrund der Ausführungen ist sein Engagement in der Debatte um den Abriss des Palasts der Republik und der Rekonstruktion des Berliner Schlosses.
Berlin – eine Schlafstadt
Berlin lebt auf Pump. Das hier ausgegebene Geld wird andernorts verdient. Als der Kalte Krieg zu Ende ging, musste West-Berlin, die Stadt der Rentner, Wehrdienstverweigerer, Studenten und linken Lebenskünstler, nicht mehr durch hohe Subventionen des Westen als Bollwerk gegen den Kommunismus gehalten werden; und die DDR verschwand gleich ganz, nachdem sie 40 Jahre lang ausgeblutet wurde, um in Ost-Berlin einen Vorzeigekommunismus zu finanzieren. Doch auch 20 Jahre nach der Wiedervereinigung ist Gesamtberlin weiterhin von staatlichen und privaten Transferleistungen abhängig.
Paris, London, München, Frankfurt, Zürich, Wien – überall sind es die Zentren, die die Peripherie nicht nur kulturell, sondern auch wirtschaftlich mit versorgen. Üblicherweise dominiert in der Stadt die Arbeitswelt, gelebt wird vorwiegend im Umland. Berlin hingegen ist die Inversion einer Großstadt: Hier wohnt man in der Stadt und arbeitet andernorts.
Der russische Kunsttheoretiker und Philosoph Boris Groys bezeichnet die Stadt in einem Interview mit der Zeitschrift Lettre in ihrer Ausgabe zum Mauerfall-Jubiläum als „Jurassic Park des realen Sozialismus“. Darin führt er aus: „Strukturell gesehen ist Berlin eine Oase des Sozialismus in der Mitte Deutschlands, weil es alle Merkmale des Sozialismus aufweist: Staatliche Subventionierung, wenig Arbeit, allgemeine Stagnation und sehr viel Freizeit.“ Was Groys damit meint: Die Stadt ist arm, aber es lebt sich gut in ihr. Paradoxerweise ist eben genau ihre wirtschaftliche Erfolglosigkeit ihre Erfolgsformel. „Arm aber sexy“ kommentierte diesen Befund der durchaus zu Glamour neigende Berliner Oberbürgermeister Klaus Wowereit im Jahr 2004. Zynismus ist ihm aufgrund dessen vorgeworfen worden, und dies nicht ganz unberechtigt. Denn für die armen bildungsnahen Schichten sind die Möglichkeiten doch erheblich sexier als für die bildungsferne Bevölkerung – Migranten, Wendeverlierer und Langzeitarbeitslose –, die in der Peripherie – etwa im Märkischen Viertel, in Marzahn oder Hellersdorf – ohne Perspektive leben. Und doch trifft Wowereits Formel auch einen Nerv der Stadt.
Berliner, so hat eine im Januar 2010 von der Bertelsmann-Stiftung über die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt veröffentlichte Studie ergeben, haben ein besonders hohes Armutsrisiko. Knapp 200 von 1.000 Einwohnern sind hier auf staatliche Hilfen angewiesen, in Bayern und Baden-Württemberg sind es nur etwas mehr als 50 Bürger. Auch beim Einkommen liegen die Berliner mit 24.800 Euro je Einwohner in der Schlussgruppe, dafür ist die Pro-Kopf-Verschuldung mit 17.000 Euro dreimal höher als anderswo und mit 67 Erwerbstätigen je 100 Einwohnern im erwerbsfähigen Alter liegt Berlin auf dem fünftschlechtesten Platz.
Nun sagen diese Zahlen nichts darüber, wie viele Wissenschaftler, Medienleute, Künstler, Schauspieler, Filmschaffende, Schriftsteller und bildende Künstler, schließlich auch Lebenskünstler durch Arbeitslosengeld oder Hartz IV finanziert werden. Ganze Generationen Kreativer und Intellektueller halten sich mit staatlichen Zuwendungen über Wasser. Sie bilden den Nährboden für das, was Berlin so attraktiv macht: Die Mischung von Sub- und Hochkultur, bei gleichzeitig gänzlichem Verzicht auf gesellschaftliche Codes oder Statussymbole, wie sie sich üblicherweise in jahrhundertealten Städten mit ausgeprägtem Stadtbürgertum herausbilden. Das mag manch einer bedauern, der eine gewisse Eleganz wertschätzt oder zivilisierte Umgangsformen, die auch durch den Zuzug urbaner Einwohner nur äußerst langsam oder gar nicht Eingang in die städtische Kultur finden.
Dafür bietet die Stadt, das ist hinlänglich bekannt, die Möglichkeit zum Experiment. Vergleichsweise billiger und attraktiver Wohnraum – etwa in Neukölln oder im Wedding – ist genügend vorhanden und die Stadt bleibt aufgrund ihrer zahlreichen durch Krieg und Sozialismus eingeschriebenen Wunden immer noch offen – im mentalen wie im konkreten Sinn. So sind die sozialen Leistungen fulminant. Als Arbeit suchend gemeldete Eltern können ihre Kinder schon im Babyalter in einer staatlichen Einrichtung – Tagespflegestelle oder Kita – unterbringen, so gut wie kostenfrei. Betreuungsplätze sind reichlich vorhanden. Auch gibt es gigantische öffentliche Bibliotheken, deren Benutzung weitgehend umsonst ist. „Für den Beginn meiner Karriere als Schriftstellerin war Berlin ideal“, erzählt Chloe Aridjis. Sie ist Mitte dreißig, ihre Eltern sind mexikanische Diplomaten und leben in Paris. Nach Jahren in den USA und in London ist Chloe nach Berlin gekommen, weil es hier billig, international und irgendwie auch introvertiert ist. Ganz abgesehen von den vielen historischen Spuren, von denen sie in ihrem „Book of Clouds“ erzählt und damit international Aufmerksamkeit erhalten hat.
So wie Chloe handhaben es aber auch ganze Kohorten aus Schwaben, Nordrhein-Westfalen oder Hessen, ebenso wie Spanier, Italiener, Amerikaner usw. Junge Architekten, Künstler und Journalisten ziehen nach Berlin und gründen hier ihre Familien. Oft haben die Eltern ihnen eine gut ausgestattete Eigentumswohnung finanziert – und mit Hilfe der staatlichen Subventionen und familiären Zuwendungen werden hier die schwierigen Jahre der Etablierung und Selbstausbeutung alimentiert. Unvergessen ist uns die Begegnung mit einem Berliner Jungkünstler, dessen Vater uns nach einem nett im Zug verplauderten Nachmittag großzügig ein Gemälde des Sohnes schenken wollte, weil der ja ohnehin nichts verkaufe, von ihm aber komplett finanziert werde. Der Sohn lebte mit seinen drei kleinen Kindern in der eigenen geräumigen Atelierwohnung unweit des beliebten Hackeschen Marktes – luxuriös eingerichtet mit neu verlegtem Parkett und einer teuren Edelstahlküche.
Wer wirklich Geld verdienen will oder muss mit Jobs, die abseits der Kulturindustrie und des Tourismus liegen, kann nicht in Berlin bleiben. Die Stadt hat keinerlei wirtschaftliches Umland und dort, wo an anderen Orten die Suburbs wuchern, ist hier schon wieder eine entgegengesetzte Tendenz zu beobachten: Zurück in die City. Denn in Berlin wird nicht gearbeitet, sondern gewohnt. Ein „Central Business District“, wie Geographen das wirtschaftliche Herzstück von Großstädten nennen, existiert nicht: Ob Friedrichstraße, Unter den Linden, Kudamm, Alexanderplatz oder Potsdamer Platz: Allerorts dominieren Konsum und Repräsentation.
So ist Berlin vor allem die Stadt der Pendler. Für sie ist Berlin wenig mehr als eine Wohn-, Schlaf- und Freizeitstadt, in der sich die Doppelverdienerpaare am Wochenende in ihrer 150 qm großen Wohnung zum schönen Leben treffen. Ausgehen, chillen, Kultur konsumieren. Etwas anders gehen damit die Familien um. Oft verdient ein Familienteil ein rentables Einkommen in einer gerade noch halbwegs erreichbaren europäischen Stadt, der andere bleibt wohnungshütend, ggf. Nachwuchs versorgend und von den sozialen Möglichkeiten profitierend mit einem deutlich weniger einträglichen Job zurück. So sind die aus Berlin nach Westen fahrenden Züge in den Morgenstunden am Wochenanfang übervoll mit gut ausgebildeten Berufstätigen. Ob Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter von Hochschulen in Braunschweig, Halle, Kassel oder Hamburg, ob Designer bei Volkswagen in Wolfburg, ob leitende Mitarbeiter von Theatern in Kassel und Hamburg, von dem Umweltbundesamt in Dessau oder selbst dem Landesverwaltungsamt oder der Bundeskulturstiftung in Halle: Alle schwärmen aus Berlin aus, um ihr Geld zu verdienen und möglichst schnell wieder an den geliebten Wohnort zurückkehren zu können.
In Wolfsburg, Braunschweig und Kassel-Wilhelmshöhe leert sich der Zug, denn die Architekturfakultät der dortigen Universität lebt vom Berliner Brain Drain – vom akademischen Personal, das hier seine Di-Mi-Do-Wochen abarbeitet und dann kollektiv Donnerstagabend wieder in die Hauptstadt zurückreist. Den Trend spiegelt der Fahrplan der Bundesbahn: Die letzte Verbindung etwa von Kassel nach Berlin ist erst um 21:13 Uhr, während man aus Berlin Richtung Kassel schon um 19:37 Uhr aufbrechen muss, um sein Ziel noch am gleichen Abend zu erreichen. Wer, wie die Kunstprofessorin A., nach Stuttgart pendelt, bucht lieber Billigflüge. Und dann ist da noch G., der in einer ostdeutschen Provinzstadt eine wichtige Kulturinstitution leitet und die freiberuflich arbeitende Frau quasi alleinerziehend mit drei kleinen Kindern in Berlin zurücklässt. G.s Kinder empfinden diesen Zustand als normal. Fast alle Väter ihrer Klassenkameraden arbeiten – wenn überhaupt – an anderen Orten: in Dresden und Leipzig, Magdeburg oder Cottbus. Mit ihren Steuern halten diese Erwerbstätigen den Haushalt der Hauptstadt aufrecht. Berlin seinerseits bietet ihnen dafür ein Refugium, gewissermaßen Sanatorium. Noch einmal Boris Groys: „Solange alles stagniert, kann man gut leben, sich geschützt fühlen, nachdenken, träumen, Wein trinken, sich gut fühlen … Je länger Berlin unter den gegebenen Umständen stagniert, desto besser geht es allen, dort und rundherum.“
Eine etwas elegantere Form des Transfers gelingt einer Reihe von Selbständigen in den „Creative Industries“: Das Büro in Berlin, die Auftraggeber meist in Westdeutschland und im Ausland. Nach diesem Modell arbeiten Architekten, Werbeagenturen oder Webdesigner. So kann man vorwiegend in Berlin arbeiten und hier auch junges, preiswertes Personal anheuern, die Aufträge kommen von außerhalb. Einziges Problem: Man muss ständig zu den Auftraggebern fahren, und auch dies zerrt an den Nerven der Familien. So überlegt der befreundete Landschaftsarchitekt mit seinen vier Kindern von Berlin-Treptow nach Hamburg zu ziehen: Während er stets quer durch die Republik unterwegs ist – Mannheim, Wuppertal, Hamburg, Ingolstadt, Kassel usw. –, haben seine Hamburger Kollegen den Vorteil, vorwiegend Aufträge in ihrer Region realisieren zu können. Andererseits muss er dort deutlich mehr verdienen, um einen ähnlichen Lebensstandard halten zu können …
Doch nicht nur die, die nach Berlin gezogen sind, halten die Hauptstadt auf Pump am Leben. So manch Auswärtiger hat einen Koffer in Berlin, wo die Immobilien immer noch billig sind. Eine kleine Wohnung können sich die Verlagsmitarbeiterin aus Stuttgart, die Theaterproduzentin aus Wiesbaden oder das Kieler Arztehepaar im Ruhestand locker leisten, von polyglotten Ausländern gar nicht erst zu sprechen. So verbringt man das ein oder andere Wochenende in der Hauptstadt mit ihren mehr als 175 Museen, mehr als 350 Kunstgalerien, 11 staatlichen und 33 privaten Theatern. Oder kümmert sich als Pensionär um die Enkelkinder, während deren Eltern ihren „Migrantenjobs“ nachgehen.
Viel Kultur und ein billiges Preisniveau – das ist es wohl auch, was die zahlreichen Touristen so anzieht, die die Stadt wie keine andere Industrie sonst mit frischem Geld versorgen. Seit dem Mauerfall strebt Berlins Beliebtheit langsam dem Unendlichen entgegen, was nicht immer gut erträglich ist. Nicht nur im eigenen Land, sondern in der ganzen Welt begegnet einem ehrfurchtsvolles Raunen bei der Erwähnung, man lebe in Berlin. Fast jeder war schon da oder kennt andere, die schon da waren. Und hin oder wieder hin will sowieso jeder. Der Tourismus boomt. Mit knapp 18 Millionen Übernachtungen in den so genannten Übernachtungsbetrieben liegt Berlin deutschlandweit an der Spitze. Wer in das frisch restaurierte Neue Museum auf der Museumsinsel will, muss vorher im Internet ein Zeitfenster buchen, will er nicht stundenlang draußen in der Kälte anstehen. Teilbereiche zwischen Reichstag, Brandenburger Tor, Holocaustdenkmal und Kollwitzplatz sind ohne Angst, von einer begeisterten (spanischen) Touristenmasse niedergetrampelt zu werden, kaum mehr zu betreten. Ganze Straßenzüge – wie etwa die Oranienburger Straße – erleben mit ihren bis zu 500 Gäste fassenden Großrestaurationen eine Ballermannisierung. Doch es ist nicht nur der Billigflug- und Vulgärtourismus, der das schnelle Geld in die Stadt schwemmt, auch der Luxustourismus boomt.
Als in Berlin Lebender wundert es beinahe, mit welcher Penetranz diese Stadt bundesweit und international gefeiert wird. Kein Intellektuellen-Magazin ist mehr zu lesen, das nicht dem Hype um Berlin eine Darstellungsfläche gibt. Da lässt die Januar-Ausgabe von „Literaturen“ Schriftsteller ihr Berlin beschreiben (darüber herrscht Einigkeit: die Stadt ist extrem heterogen) und sieht Berlin in einer „stetig wachsenden Zahl von Romanen als neues Zentrum einer hyperaktiven Gegenwart.“ Und was lesen wir nicht andernorts alles von der Stuttgartisierung des Prenzlauer Bergs, wo die letzten Einheimischen von gebärwütigen süddeutschen Mittelstandstussis verdrängt werden, die Mieten ins Unbezahlbare steigen und inzwischen sogar die Hundehaufen vom Trottoir verschwunden sind – hier flackern immer mal wieder ideologische Auseinandersetzungen zwischen Ost und West auf, die sonst kaum eine Rolle spielen. Und dann ist da noch der Neuköllner Bürgermeister Heinz Buschkowsky, der auf das Integrationsproblem in seinem „Problemkiez“ verweist und dort Parallelwelten zwischen Deutschen und Migranten feststellt.
Im Alltag kommt die Berliner Mittelschicht in der Tat kaum mit den arabisch-türkischen Migranten in Berührung, auch wenn alle ganz selbstverständlich in den zahllosen kleinen Lebensmittelläden einkaufen, die es in den Innenstadtbezirken an jeder Ecke gibt (im Westen freilich mehr als im Osten). Letztlich lebt es sich in Berlin extrem unaufgeregt.
Unlängst kehrten wir von einem Parisausflug in unser vertrautes Berlin zurück. Dort, in der französischen Hauptstadt, hatten elegante Menschen auf den Boulevards an kleinen runden Tischen im Freien gesessen und Kaffee getrunken. Der Vorortzug zum Flughafen war übervoll mit schwarzafrikanischen Menschen, die in den Vorstädten nach und nach ausgestiegen waren. Im Landeanflug auf unser präsibirisches Provinznest sah man aus dem Flugzeugfenster vereinzelte kleine Lichtpunkte, dann waren die Schneeverwehungen neben der Landebahn erkennbar, Außentemperatur -15° C verkündete der Captain, local time 9 pm. Der Flughafen war wie ausgestorben, alle Läden geschlossen. Wegfliegen wollte jetzt niemand mehr.