
Landwirtschaftliche Berufs- und Fachschule Otterbach
St. Florian am Inn (A) - 2005
Architekturzentrum Wien
Architekturstudium an der TU Wien
Seit 1993 freischaffende Architektin in Linz
Seit 1995 Architekturkritiken für die OÖ Nachrichten und Beiträge über Architektur in verschiedenen Medien
2007 – 2021 Lehrtätigkeit an der HTL1 Goethestraße, Linz
2015 – 2021 Abteilungsvorstand Hochbau/Holzbau an der HTL1 Goethestraße, Linz
2001 – 2004 Vorsitzende des Fachbeirates für Architektur und Denkmalpflege im OÖ Landeskulturbeirat
2004 – 2006 Vorsitzende des architekturforums oberösterreich
2006 – 2015 Vorsitzende des Diözesankunstvereines der Diözese Linz
2010 – 2012 Vorsitzende des Fachbeirates für Architektur und Denkmalpflege im OÖ Landeskulturbeirat
2004 »Architektur in Oberösterreich seit 1980« Verlag Anton Pustet
2012 Kunstwürdigungspreis der Stadt Linz für Architektur
2003 Kulturpreis des Landes Oberösterreich für Architektur
2003 Oberösterreichischer Holzbaupreis (Auszeichnung für Landwirtschaftliche Fach- und Berufsschule Otterbach)
1998 Journalismuspreis der Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten für Oberösterreich und Salzburg 1998
Oberösterreichischer Holzbaupreis 2003, Preisträger, Landwirtschaftliche Berufs- und Fachschule Otterbach
Fußläufig vom Stadtzentrum liegt der Campus der Hochschule der Diözese Linz mit dem erneuerten Studentenheim – Wiesen ringsum erinnern an die bäuerlich geprägte Vergangenheit des Stadtrandes. Heute würde man solche Flächen wohl nicht mehr umwidmen und versiegeln. Oder?
Ein Spaziergang über den Campus der Privaten Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz führt von der Kapuzinerstraße abzweigend den Salesianumweg hinauf. Vorbei an dem 1970 bis 1975 nach den Plänen von Franz Riepl und Othmar Sackmauer errichteten Hauptgebäude gelangt man zu zwei schlichten Häusern aus den 1960er-Jahren, die ein zur Jahrhundertwende errichtetes, heute als Praxismittelschule genutztes Gebäude flankieren. Der talseitige der beiden vom langjährigen Baureferenten der Diözese Linz, Gottfried Nobl senior, baugleich errichteten Trakte dient heute dem Hochschulbetrieb. Der Hangbau wird noch als Studentenheim genutzt. Der Linzer Architekt Klaus Leitner hat ihn generalsaniert und lädt uns mit dieser Sanierung auf eine Zeitreise ein.
Diese Reise erlaubt uns nicht nur, die weite Strecke zu ermessen, die unsere Baukultur in den vergangenen 60 Jahren zurückgelegt hat. Sie regt auch an, über die Zukunft des Bauens nachzudenken. Denn ein erheblicher Anteil des weltweiten CO2-Ausstoßes ist bei nach wie vor steigender Tendenz auf Gebäude zurückzuführen. Trotzdem oder gerade deshalb lautet das Gebot der Stunde nicht: „Viele schöne neue Passivhäuser bauen“, sondern: „Reparieren, was an Substanz noch reparabel ist.“ Dazu gehört mehr als die bauphysikalische Ertüchtigung eines Hauses und das Nachrüsten mit zeitgemäßer haustechnischer Ausstattung. Ebenso wichtig und wesentlich schwieriger ist es, die Vorzüge einer längst abgeschriebenen Anlage zu erkennen und sie für unsere Augen wieder sichtbar zu machen. Das von Klaus Leitner vorgefundene Bauwerk mochte zwar mit der Ökonomie seines Grundrisses und seiner Kubatur punkten. Doch die von leicht zurückgesetzten Fensterbändern gegliederten Fassaden zeigten ebenso wie sein aus Sichtbeton und Sichtziegelmauerwerk komponiertes Stiegenhaus, dass bei aller Sparsamkeit gestalterische Überlegungen nicht bedeutungslos waren. Das ist viel mehr, als die meisten „Zweckbauten“ unserer Tage von sich behaupten können.
Architektursprache nicht gebeugt
Klaus Leitner verzichtete folglich darauf, die Architektursprache des Hauses nach derzeitigen Vorstellungen zu beugen, und achtete darauf, heutige Anliegen in dieser Sprache korrekt auszudrücken. Den beiden Längsfassaden blieb ihre horizontale Bänderung trotz der Wärmedämmung erhalten. Und der Haupteingang an der Ostseite führt, wie eh und je von einem vermutlich Rudolf Kolbitsch zuzuschreibenden Beton-Glas-Bild flankiert, in das zwar brandschutztechnisch ertüchtigte und barrierefrei umgeformte, in seinem Charakter jedoch unveränderte Stiegenhaus. Auch den organisatorischen Aufbau des Studentenheims übernahm Klaus Leitner, wie er ihn vorfand: Ein Nord-Süd-orientierter, ausreichend breiter, an seinen Enden belichteter Gang erschließt zwei Reihen von Zimmern. Doch teilen sich dort, wo früher drei Zimmer Platz fanden, zwei Räume eine Nasszelle, die sie in die Mitte nehmen. Nächtliche Wanderungen der BewohnerInnen in die gemeinschaftlich genutzten Waschräume und WC-Anlagen gehören somit der Vergangenheit an. Diese zweifellos als Verbesserung einzustufende Änderung untermauert zwar die Behauptung, dass früher noch jeder technologische Fortschritt nicht zur Verringerung des Energieverbrauchs, sondern zur Erhöhung unseres Lebensstandards geführt hat; doch zieht man im konkreten Fall in Betracht, dass die bisher in jedem Stockwerk untergebrachten Wohnungen für Betreuungspersonal Gemeinschaftsräumen gewichen sind, erkennt man: Die Begriffe von Komfort haben sich in 60 Jahren zwar verschoben, der Verbrauch räumlicher Ressourcen je Bewohner ist jedoch nicht überbordend gewachsen. Die „Betreuung“ des Studentenheimes ruht nun auf einer funktionstüchtigen Schließanlage.
Einbaumöbel vom Tischler
Ein weiteres Verdienst der Sanierung liegt darin, mit den Ansprüchen an die Ausstattung des Heimes auf dem Boden einer Grundeinstellung geblieben zu sein, die der Intelligenz deutlich mehr Gewicht beimisst als dem Materialeinsatz. Zimmer und Nasszellen sind klein, jedoch ordentlich belüftet und belichtet und in ihrem Zuschnitt genau auf ihre Nutzung abgestimmt. Die von Klaus Leitner entwickelten Einbaumöbel, darunter ein Hochbett, das zusätzlichen Stauraum mit einem optimierten Blick aus dem Fenster verbindet, bringen seine Haltung auf den Punkt: Das Ausgangsmaterial, mitteldichte Holzfaserplatten, ist nicht teuer, Planung und Fertigung der Möbel durch den Tischler generieren jedoch einen hohen Wert.
Auch den Ausstattungselementen wurde gebührender Wert beigemessen, sodass alles Brauchbare erhalten blieb: die großen Terrazzoplatten in den Gängen etwa oder die Türzargen der Zimmer. Ihre gut gemeinten, aber nicht praktikablen Oberlichten wurden mit Holzfaserplatten verschlossen. Von der gleichen ruhigen Hand bei genauem Blick auf die von Licht und Ordnung begründeten Qualitäten eines Raumes erzählen die Bereiche an den Stirnseiten der Obergeschoße. Koch-, Ess- und Lesezonen sind um je einen mittig angeordneten, von einer Holzsitzbank umfangenen Stauraum gruppiert, in dem den BewohnerInnen ein Spind zugeteilt ist. Nach Süden orientierte Loggien ergänzen die Gemeinschaftsräume um attraktive Freibereiche.
Im Erdgeschoß liegen in unmittelbarer Nähe des Haupteinganges die Verwaltungsräume, ein Seminarraum und ein Café. Nur für Letzteres hat Klaus Leitner die Kubatur des Bestandes geringfügig vergrößert. Es greift mit einem durch seine abgesetzte Holzdecke als Erweiterungsbau erkennbaren Volumen um die Breite einer Tischreihe in den Außenraum. Nach Süden und Westen großzügig geöffnet und von einer Terrasse umgeben, unterstreicht das Café die besondere Lagegunst des Studentenheims. In fußläufiger Reichweite des Linzer Zentrums liegt der Campus an den nach Westen hin ansteigenden Hang des Freinbergs geschmiegt. Hier halten von Hecken und kleinen Baumgruppen gesäumte Wiesen die Erinnerung an die bäuerlich geprägte Vergangenheit des westlichen Linzer Stadtrandes lebendig. Heute würde man Flächen wie diese wohl nicht mehr als Bauland widmen und versiegeln. Nicht wahr?
Behutsam wiederbelebt: wie ein Haus aus dem 16. Jahrhundert mit heterogener Bausubstanz gefühlvoll revitalisiert wurde. Das einstige „Löwenwirtshaus“ in Neuhofen, Oberösterreich – ein Bekenntnis zur Arbeit mit Vorgefundenem.
Wir haben längst genug gebaut in Österreich. Zahllose Gebäude stehen leer und harren einer angemessenen Nutzung. Dennoch profilieren wir uns nach wie vor europaweit als Spitzenreiter in der Baulandwidmung und alsbaldigen Versiegelung fruchtbarsten Bodens. Der Schaden an der Umwelt, der Lebensqualität und der Versorgungssicherheit aller ist kaum noch auszublenden. Dass allmählich auch außerhalb der seit Jahrzehnten warnenden Fachkreise Problembewusstsein aufkeimt und seitens politischer Entscheidungsträger gute Vorsätze publiziert werden, stimmt vorsichtig optimistisch. Viel mehr Hoffnung aber machen Projekte wie die Revitalisierung eines historischen Gebäudes im Zentrum von Neuhofen an der Krems. Dessen über mehrere Jahre von den in Linz ansässigen Moser und Hager Architekten betriebene Erneuerung ist nun in ihrer ersten Stufe abgeschlossen.
Bis vor wenigen Jahren wurde im Haus Marktplatz 9 ein Gasthaus geführt. Seine urkundlich belegte Geschichte reicht bis ins 16. Jahrhundert zurück. Das Haus wurde mehrmals umgeformt und erweitert. Eine der wesentlichsten Veränderungen erfolgte vor etwa 200 Jahren durch den Anbau eines zweigeschoßigen Traktes mit einem 100 Quadratmeter großen Wirtshaussaal, der allerdings in den 1980er-Jahren durch den Einbau von Kleinwohnungen und Fremdenzimmern bis zur Unkenntlichkeit zugestellt wurde. Mit ihrer Wiederbelebung dieser technisch und ästhetisch völlig heterogen gewachsenen Bausubstanz haben sich Moser und Hager Architekten auf einen ungewöhnlichen, ja abenteuerlichen Planungsprozess eingelassen. Mit jeder Bauetappe wurden verborgene historische Elemente freigelegt und wiederhergestellt. Der Entwurf reagierte auf das Entdeckte und war somit einer beständigen, an den Bauablauf gekoppelten Veränderung unterworfen.
Der geschlossenen Häuserfront des Marktplatzes wendet das einstige „Löwenwirtshaus“ nun wieder eine dreigeschoßig erscheinende symmetrische Fassade zu. Eine überwölbte Durchfahrt in der Mitte des Erdgeschoßes wird von zwei breiten Rundbogenfenstern flankiert. Der Haupteingang liegt etwas zurückgesetzt in der Durchfahrt. Während der größte Teil des Erdgeschoßes noch einer Nutzung zugeführt werden muss, haben Moser und Hager Architekten in dem Gewölbe rechts der Durchfahrt eine Filiale ihres Büros eingerichtet. Gleich dahinter steigt eine gewendelte Stiege hinauf in das Erdgeschoß, das, von kleinteiligen Einbauten befreit, nun wieder als Wohnung dient. Nach und nach wurden Bögen, Gewölbe und alte Wandöffnungen freigelegt. Jahrhundertealte Bodendielen, aber auch ein Holz-Kork-Gussboden traten zutage. Sie wurden trotz des staunenden Kopfschüttelns der am Bau beschäftigten Professionisten erhalten und repariert. Die vorgefundenen Kunststofffenster wurden durch neue Kastenfenster aus Holz ersetzt. Der Komfort, den man heute von Wohnräumen erwartet, erforderte eine umfassende haustechnische Ertüchtigung des Gebäudes. Die Heizung erfolgt nun zentral über einen neuen Pellets-Heizkessel, die Elektro- und Sanitärinstallationen wurden erneuert. Auch hier wurde der historischen Substanz gebührender Tribut gezollt: Die Wärme wird nicht über die Fußböden, sondern von Heizkörpern abgegeben, und die Leitungen werden nicht in den Wänden, sondern in bodenebenen Schächten geführt, deren Verlauf durch die Verwendung eines kontrastierenden Belags sichtbar geblieben ist. Denn so wenig es Moser und Hager Architekten bei dieser Revitalisierung um eine Rückführung des Gebäudes auf einen möglichst weit zurückliegenden „Originalzustand“ ging, so wenig ließen sie das große Potenzial des Hauses aus den Augen: seine lange Geschichte und die vielen Lebensentwürfe, die ihm eingeschrieben sind. Die formale Ausbildung ihrer klar im Heute verankerten Eingriffe ist denn auch durchwegs als Antwort auf die historische Substanz von dieser inspiriert.
Einen wichtigen Anker setzt der ehemalige Wirtshaussaal, der nun wieder als multifunktionaler Wohnraum genutzt wird. Insbesondere die an der Decke entdeckte und fachgerecht restaurierte Malerei dient in ihrer Farbigkeit, aber auch in der gehäuften Verwendung des Kreises als Leitmotiv der Gestaltung: Die tiefen Türschwellen in der Wohnung etwa tragen ebenso den in der Decke angeschlagenen Rotton wie der Belag der Kochinsel, während der Kreis vom Zuschnitt zweier verspiegelter Schränke variiert wird. Die deutliche Ablesbarkeit ihrer Interventionen erreichen Moser und Hager Architekten jedoch nie auf Kosten eines harmonischen Ganzen. Die als eigenständige Objekte in einen Raum gesetzten Köper einer Nasszelle und eines Abstellraumes sind mit ihrer politierten Holzoberfläche auf den Korkgussboden abgestimmt. Auch die freigestellte Kochinsel ist in ihrer Materialität eine Fortsetzung des im Saal vorgefundenen Fichtenholzbodens. Selbst die häufig eingesetzten Materialien des Glases und der Spiegelung dienen nicht der Inszenierung des Zeitgenössischen, sondern haben die Aufgabe, Bestehendes zur Geltung zu bringen. Das Bekenntnis zur Arbeit mit dem Vorgefundenen umfasst auch Bauteile neueren Entstehungsdatums, deren ästhetischen Wert man als überschaubar einstufen könnte. Der in den 1980er-Jahren an den historischen Saal gefügte Wintergarten wurde als nützlich befunden, folglich erhalten und um eine in den Hofgarten hinunterführende Stiege aus Cortenstahl ergänzt.
Die Ablagerungen des längst Vergessenen, von Moser und Hager Architekten im skulptural verschnittenen Gewölbe einer einstigen Nagelschmiede oder den impressionistisch anmutenden Schichten übereinanderliegender Wandmalereien aufs Liebevollste konserviert, schenken den Räumen etwas, das so schnell nicht zu erzeugen ist: Unverwechselbarkeit. Vieles spricht dafür, der Revitalisierung von Gebäuden den Vorzug vor Neubauten auf der grünen Wiese zu geben: die Erhaltung bestehender Siedlungsräume, die Nutzung bereits vorhandener Infrastruktur, die umfassende Schonung von Ressourcen. Doch bekanntlich folgt unser Handeln nicht der Ratio allein. Gerade bei Entscheidungen in einem so stark von Technologie, Wirtschaftlichkeit und Funktionalität bestimmten Bereich wie dem Bauen spielt die Emotion eine nicht zu unterschätzende Rolle. Dem Gefühl aber bieten Häuser wie jenes in Neuhofen eine Heimat – vor allem auf lange Sicht.
Kraftwerk Zwenewaldbach: wie ein kleines Objekt Technik, Wirtschaftlichkeit und Baukultur in sich vereint – und ein Dorf erfolgreich um dezentrale Versorgungshoheit mit erneuerbarer Energie gekämpft hat. Nachrichten aus Osttirol.
Es ist nicht alles gut gelaufen im vergangenen Jahr, obwohl viele ihr Bestes gegeben haben. Erfolge und Fehlschläge im Kampf gegen ein Virus, viel Empörung, einiges an Hoffnung und eine unüberschaubare Menge an Ratschlägen, wie man die Krise besser hätte meistern können, haben 2020 geprägt. Und hier ein weiterer Beitrag: Die rechtzeitige Durchdringung unseres Lebens mit den Werten der Baukultur hätte den Umgang mit der Krise zumindest leichter gemacht. So wäre es beispielsweise die nobelste Aufgabe jedes Wohnungsbaus, der die Bezeichnung „sozial“ im Namen führt, das enge Zusammenspiel von Einkommen und Lebensqualität im Falle umfassender Ausgangsbeschränkungen zumindest zu lockern. Doch auch jenseits der guten Gestaltung privaten Wohnraums bietet Architektur zahlreiche Chancen zur Verbesserung jeder, folglich selbst einer pandemieüberschatteten Lebenslage.
Sobald wir an größere Menschenansammlungen und die daraus erwachsenden Gefahren denken, tritt auch die Ausgestaltung der dafür vorgesehenen Räume in unser Bewusstsein. Wie viele Generationen von Lehrern und Schülern haben nicht schon in der mit Treibhausgasen gesättigten Atmosphäre gängiger Klassenräume nach Sauerstoff gerungen! Doch erst seitdem andere Viren in den Aerosolen hängen als die für Schnupfen, Brechdurchfall und Seitenstrang-Angina zuständigen, sind gut durchlüftete (Unterrichts)Räume ein Thema, das sogar Minister zu den Mikrofonen greifen lässt. Es gibt sie schon lange, die Bildungsbauten, in denen sich bei guter Luftqualität konzentriert lernen lässt. Das von Karl und Bremhorst Architekten geplante Bildungszentrum Pregarten etwa ist seit dem Schuljahr 2014/15 in Betrieb. Es zeigt uns, wie befreiend und pädagogisch inspirierend das Zusammenspiel klugen Städtebaus mit innovativer Grundrissorganisation und sensibler Raumgestaltung im Alltag wirkt. Doch obwohl im Bereich der Bildung – von Kindergarten bis Universität – die vorbildlichen Beispiele vergleichsweise dicht gesät sind, ist die gewaltige Überzahl der Gebäude so gemacht, dass in Zeiten wie diesen nicht viel anderes übrig bleibt, als sie zu meiden.
Technologie, Funktionalität, Ästhetik
Auch in anderen Branchen hätte das Heranführen der breiten Basis des Gebauten an die kulturellen Standards der Spitzen manches erleichtert. Alten- und Pflegeheime mit überschaubaren Strukturen wie das von Gärtner Neururer Architekten in Gaspoltshofen geplante; der festlich gestimmte Bewegungsraum einer Tanzschule, von Luger & Maul der ehemaligen Reithalle der Welser Dragonerkaserne eingeschrieben; die Neufassung, mit der Jabornegg & Palffy ein Baudenkmal, das Linzer Schauspielhaus, an zeitgemäße Vorstellungen von Komfort herangeführt haben: Sie stehen für das in der Architektur verwirklichte Zusammenspiel von Technologie, Funktionalität und Ästhetik, das unsere Welt auch aus hygienischer Sicht besser macht. Es ist, obwohl es Vitruv schon vor 2000 Jahren in seinen Büchern beschworen hat, noch immer nicht zur Selbstverständlichkeit geworden. Das hätte man Ihnen früher sagen sollen? Die gerade aus einer Fülle möglicher Beispiele ausgewählten wurden allesamt im „Spectrum“ der „Presse“ und/oder in „Architektur Aktuell“ besprochen. Hoffen wir einfach, dass wir uns tatsächlich gerade auf einem guten Weg aus der Pandemie bewegen. Wie aber lauten die drängendsten Fragen der Zukunft? Die Klimakatastrophe hält keineswegs den Atem an. Eine Wende zu gelebter Nachhaltigkeit wird nötig sein, wenn wir überleben wollen. Aus unserer derzeitigen misslichen Lage lernen wir: Es gibt Meilensteine wie Impfungen und viele kleine Schritte bis zum Ziel. Das Bekenntnis zur Baukultur ist einer dieser Schritte, die wir alle jederzeit setzen können.
Das Krafthaus Zwenewaldbach, das Schneider & Lengauer Architekten 2017 in Hopfgarten im Osttiroler Defereggen geplant haben, ist ein schönes Beispiel dafür, wie ein kleines Objekt nicht nur Themen wie Technik, Wirtschaftlichkeit und angemessenes Bauen im Landschaftsraum in sich vereint. Es steht auch für den Wert dezentraler Versorgung mit erneuerbarer Energie und schließt eine schöne Erzählung von direkter Demokratie und mutigem Widerstand mit ein. Der Bau eines Kraftwerks am Zwenewaldbach wurde gleich nach Ende des Zweiten Weltkriegs von der Gemeinde Hopfgarten in Angriff genommen und von praktisch allen Gemeindebürgern durch Robotleistungen mitgetragen. Der in den 1960er-Jahren gegründeten Elektrowerkgenossenschaft Hopfgarten, die das Kraftwerk von da an betreiben sollte, traten nahezu alle Abnehmer des Stromes bei. Sie waren es, die sich im gleichzeitig geführten Kampf der Übernahme der Stromversorgung durch die übermächtige Tiroler Wasserkraft AG widersetzten. Den erforderlichen Neubau nun nicht einfach einem spezialisierten Unternehmen, sondern einem Architekturbüro anzuvertrauen, erscheint da fast schon als Selbstverständlichkeit. Tatsächlich aber ist das kleine Osttiroler Bergbauerndorf auch in seiner Rolle als Bauherrschaft ein weit leuchtendes Vorbild.
Passgenau gearbeitetes Werkstück
Das Kraftwerk erhebt sich in einer kleinen Aufweitung des Tales am Ufer des Zwenewaldbaches. Wie ein passgenau gearbeitetes Werkstück haben Schneider & Lengauer das Haus in den knapp bemessenen Bauplatz gefügt. Es reagiert mit seinem abgewinkelten Körper auf die gegebenen Zufahrten und wahrt so die Möglichkeit zur Anlieferung von Turbinen und Transistoren. Auch der schräge, mit Metall belegte Einzug der Fassade, der auf den in der Innenecke geschützten Mitarbeiterzugang zuläuft, die Überhöhung des Daches über dem Knick zur Aufnahme von Lüftungsöffnungen, das eine große Fenster, mit dem die Turbinenhalle den Fluss überblickt, und auch die gebäudehohen Portale an den Stirnseiten des Baukörpers sind allesamt dem reibungslosen Arbeitsablauf geschuldet. Gleichzeitig ergeben sie in ihrer Gesamtheit ein plastisch durchgeformtes Bauwerk, das sich mit größerer Selbstverständlichkeit in die Landschaft fügt als manches mit vermeintlich alpin-ländlichen Applikationen versehene Objekt. Das feine Schalungsbild des Sichtbetons, der Umsicht des Poliers zu verdanken, hält Schritt mit der sorgfältigen Planung der Gesamtanlage. Im Selbstbewusstsein seiner Funktionstüchtigkeit und der Qualität seiner Komposition stellt sich das Kraftwerk dem Dialog mit der Natur, dem rauschenden Wasser, den steil aufragenden Felswänden, dem dunklen Nadelwald.
Der gewonnene Kampf eines Dorfes um seine Versorgungshoheit und ein gelungenes Beispiel der Verbindung von Technik, Landschaft und Baukultur machen weder eine „Energiewende“ noch lösen sie die Strukturprobleme des ländlichen Raumes. Doch gerade in der Überschaubarkeit ihres Maßstabes sind Leistungen wie der Neubau des Kraftwerks am Zwenewaldbach vorbildhaft und richtungsweisend.
Wann entsteht Baukunst? Zum Beispiel wenn die Gestaltung lebendiger Siedlungsräume ein Herzensanliegen von Architekten ist – und die Diskussion mit dem Bundesdenkmalamt so bereichernd wie die Zusammenarbeit mit Künstlern. Besuch im oberösterreichischen Freistadt.
Die Raiffeisenbank an der Freistädter Linzer Straße stammt von 1994, als in (Ober)Österreich die Epigonen der Postmoderne noch in vollem Saft standen. Die Dinge sind, wie sie sind. Doch ihre Verbesserung ist möglich, wie die von Pointner Pointner Architekten geplante Erweiterung der Bankstelle zum Raiffeisen-Kompetenzzentrum Freistadt zeigt. Häufig brauchen Objekte dieser Art ja nicht nur im Auftritt eine heilende Hand. In den meisten Fällen erweisen sie sich auch hinsichtlich ihrer Funktionalität als korrekturbedürftig.
Das Haus wird im Erd- und im ersten Obergeschoß von der Raiffeisenbank genutzt. Der zweite Stock und der Dachraum bergen Büros, eine Ordination und Wohnungen. Um die Wege der unterschiedlichen Nutzer zu entflechten, haben Pointner Pointner Architekten den straßenseitigen Eingang zu den beiden oberen Geschoßen an die äußerst linke Kante des Hauses verlegt. Von hier führt der Weg zum unverändert belassenen Erschließungskern in der Mitte des Gebäudes. Der Haupteingang zur Bank wiederum wurde um zwei Achsen nach rechts verschoben, sodass zur Linzer Straße hin genügend Raum für einen von Autostellplätzen frei gehaltenen Vorplatz mit einem barrierefreien Zugang blieb. Der Haupteingang führt in das geräumige Foyer mit dem Kundenempfang. Dahinter führt eine aus dem Bestand übernommene interne Stiege in den ersten Stock. Pointner Pointner Architekten haben die Grundrissorganisation, aber auch Oberfläche, Möblierung und Beleuchtung der Bankfiliale behutsam aufgefrischt. Eine Fotoinstallation von Kurt Hörbst, die dem Kompetenzzentrum zugeordnete Orte in ungewöhnlichen Ausschnitten zeigt, wurde in die Raumteilungen integriert. Auch der goldfarbene Metallschirm zur Betonung des Kompetenzzentrums Richtung Linzer Straße ist keine reine Verschönerungsmaßnahme. Er erfüllt den guten Zweck des Sonnen- und Sichtschutzes. Gold, Diskretion und physische Verschlossenheit werden ja auch in Zeiten digitaler Geldflüsse mit der Institution Bank in Verbindung gebracht.
Die Verwandlung der Bankfiliale Linzer Straße in das Kompetenzzentrum Freistadt wird in einem Gebäudeteil abgebildet, den man im Vorbeifahren kaum sieht. Pointner Pointner Architekten haben über der in den Hang geschobenen Garage in der östlichen Hälfte des Grundstückes einen multifunktionalen Veranstaltungssaal errichtet, der die gestalterische Bilanz der Gesamtanlage weit ins Positive verschiebt. V-förmig ausgebildete Stützen aus Schleuderbeton und eine massive Betonplatte heben den freigestellten Holzbau des Saales auf die Ebene des zweiten Obergeschoßes. So bleibt auf dem Dach der Garage ein witterungsgeschütztes Parkdeck erhalten. Die Form der Stützen ergibt sich keineswegs aus dem Bedürfnis, originell zu wirken, sondern erleichtert es, die Lasten über die bestehende Konstruktion der Garage abzuleiten. Auch die leichte Schrägstellung der Westfassade des Saals ist der Notwendigkeit geschuldet, den vorgeschriebenen Lichteinfall für den Bestand zu erhalten. Das Pultdach des Zubaus ist nach Westen geneigt, seine nach Osten orientierte Außenwand folgt dem Verlauf der Grundgrenze mit einem Knick. Aus diesen Antworten auf das Vorgefundene entsteht ein plastisch durchgeformter Baukörper, der seiner Lage in der zweiten Reihe einen selbstbewussten Auftritt entgegensetzt. An das Stiegenhaus des Bestandes ist der Saal mit einer verglasten Brücke angebunden, die in eine Foyerzone mündet. Das Foyer setzt sich in einem Balkon mit daran schließender Fluchttreppe fort, sodass die Nutzung des Saales auch abgekoppelt vom Weg durch den Altbestand möglich ist. Während der Saal von einer goldfarbenen Metallfassade umhüllt wird, zeigt sich der konstruktive Holzbau innen als fein gearbeitete Schatulle, in der die Vorzüge des Baustoffes zur Geltung kommen. Mit handwerklicher Sorgfalt wurden die zarten Profile der Wand- und Deckenverkleidung zwischen die tragenden Rahmen gefügt und verbinden so die vertraute Anmutung des Holzes mit großer Eleganz. Nach Süden hin öffnet sich der Saal dem Blick über die allmählich in den Landschaftsraum verrinnende Vorstadt, während im Osten der dichte Baumbestand des Nachbargrundstückes einen nicht unwesentlichen Beitrag zur außergewöhnlichen Stimmung des Ortes leistet.
Der unaufgeregte Umgang mit vorerst wenig befriedigenden Situationen und die Fähigkeit, bisher verborgene Vorzüge eines Ortes durch Architektur erfahrbar zu machen, sind eine Konstante im Werk der Pointner Pointner Architekten. Eine wichtige Quelle ihrer Inspiration liegt in der Hinwendung zum Gegenüber. Sie arbeiten mit ihren Auftraggebern auf Augenhöhe zusammen, was ihnen Glaubwürdigkeit und Überzeugungskraft verleiht. Seit mehr als zwanzig Jahren stellen sie ihr Können in einer Vielzahl gelungener Arbeiten unter Beweis. Helmut und Herbert Pointner, die Gründer der Pointner Pointner Architekten, haben in Wien Architektur studiert. Während Helmut Pointer das Büro in Wien betreut, kehrte sein Bruder Herbert in die Heimatstadt Freistadt zurück, wo er die oberösterreichische Niederlassung leitet. Engagement für gutes Bauen ist hier wie da vonnöten. Hier wie da werden die Projekte gemeinsam entwickelt, geht es nicht um vordergründig schöne Bilder, sondern um Nachhaltigkeit.
Ihr Einsatz für den konstruktiven Holzbau ist eine Facette dieser Haltung, ihre Affinität zum Bauen im Bestand eine weitere. Pointner Pointner Architekten empfinden die Diskussion mit dem Bundesdenkmalamt als ebenso bereichernd wie die Zusammenarbeit mit bildenden Künstlern. Die Gestaltung funktionstüchtiger, lebendiger Siedlungsräume ist ihnen ein Herzensanliegen. Insbesondere der historische Kern von Freistadt verdankt Helmut und Herbert Pointner neben dem anlässlich des Landesausstellungsjahres 2013 neu geordneten Hauptplatz eine Vielzahl revitalisierter historischer Bauten: von ihrem ersten, mit Christian Hackl und Josef Ullmann bearbeiteten Projekt, dem zum Kulturzentrum umgedeuteten Salzhof, über wiedergewonnene Wohngebäude wie das Haus am Böhmertor bis zur alten Lateinschule, in der nun neben Büros und Wohnungen auch das Freistädter Atelier der Pointner Pointner Architekten untergebracht ist. Helmut und Herbert Pointner werden heuer mit dem Kulturpreis des Landes Oberösterreich in der Sparte Architektur ausgezeichnet.
Urbanität im Zwischenraum: Auf dem Campus der Johannes Kepler Universität zeigt die Stadt Linz anhand zweier Erneuerungsprojekte, wie es aussieht, wenn Raum Bewegung inspiriert.
Kaum etwas hebt das Selbstwertgefühl einer Stadt so sehr wie das Bewusstsein, Universitätsstadt zu sein. Als solche ist die oberösterreichische Landeshauptstadt Linz recht jung. Die Gründung der Johannes Kepler Universität, kurz JKU, im Jahr 1962 hat ebenso wie die Präsenz der kleineren Universitäten viel dazu beigetragen, das Image der Stadt zu verändern: Aus der Industriestadt mit der schlechten Luft ist längst ein Ort mit einem breiten und häufig als erfrischend weltoffen empfundenen kulturellen Angebot geworden.
Aus städtebaulicher Sicht allerdings hat sich in Linz nach der gelungenen Anstrengung des Kulturhauptstadtjahres 2009 eine deutlich spürbare Behäbigkeit eingestellt, der die Weiterentwicklung des öffentlichen Raumes weniger wichtig zu sein scheint als die Zufriedenheit allfälliger Investoren.
Und wieder geht die JKU der Stadt mit nachahmenswertem Beispiel voran. Sie wurde in den 1960er-Jahren als Campus-Universität auf dem Areal des ehemaligen Schlosses Auhof errichtet. Die damals von einer Architektengruppe unter der Leitung von Artur Perotti geplanten Gebäude sprechen eine der Moderne verpflichtete Sprache, in der die wechselnden Moden der verstreichenden Jahrzehnte allerdings ihre Spuren hinterlassen haben.
Die mit dem Wachsen der Universität einhergehenden funktionellen Änderungen fordern mittlerweile ebenso ihren Tribut wie die heute völlig veränderte Sicht auf Themen wie Barrierefreiheit oder Umgang mit endlichen Ressourcen. Doch ist es die immer noch – oder endlich wieder? – spürbare Aufbruchstimmung der Universität, die in ihren gebauten Anlagen nach Ausdruck drängt. Der seit 2012 stetig wachsende, von Caramel entwickelte Science Park im Osten des Campus ist ein Kapitel für sich.
Rege Bautätigkeit ringsum
Seit 2015 ist Meinhard Lukas Rektor der JKU. Mit seinem Amtsantritt hat auch auf dem ursprünglichen Campusgelände rege Bautätigkeit eingesetzt. Das Architekturbüro Luger & Maul hat mit der Renovierung des Rektoratsgebäudes und mit der Errichtung des multifunktionalen Teichwerks den Anfang gemacht. Auch die von Luger & Maul geplante Sanierung des sogenannten Uni-Centers und des Keplergebäudes sind mittlerweile abgeschlossen, der Neubau des „Zirkus des Wissens“ im Hof des ehemaligen Schlosses Auhof steht kurz vor der Fertigstellung.
Rechtzeitig vor Beginn des Wintersemesters fertiggestellt wurde auch das große, seitens der Bundesimmobiliengesellschaft, kurz BIG, ausgeschriebene Erneuerungsprojekt für den Campus der JKU. Riepl Riepl Architekten haben den Architekturwettbewerb gewonnen und die Revitalisierung des Campusgeländes in Zusammenarbeit mit DnD Landschaftsplanung umgesetzt. Die veränderten Raumanforderungen der Universität werden von vier Gebäuden erfüllt. Davon sind zwei, das Open Innovation Center und das Somnium – wir haben an dieser Stelle bereits berichtet –, schon seit etwa einem Jahr in Betrieb. Die beiden anderen, der Neubau der Kepler Hall und der Erweiterungsbau der Bibliothek, wurden vor Kurzem eröffnet.
Zwischen diesen vier Häusern ist der Campus der JKU nun wieder als eine Gesamtheit aufgespannt, die den Freiräumen ebenso hohen Wert beimisst wie den Gebäuden. Viele seiner Qualitäten zeigt der Campus schon seit seiner Errichtung: die freie Mitte in Gestalt des historischen Teiches etwa, die mächtigen, ebenfalls aus dem Schlosspark erhaltenen Bäume und die Nähe der bewaldeten Hügel des Mühlviertels, an die das Universitätsareal im Norden grenzt. Es galt nur, sie unter den Schichten der Achtlosigkeit, die sich mit der Zeit eingestellt hat, freizulegen und aufs Neue in den Blick zu nehmen: das Dickicht vor dem Keplergebäude zu lichten, der Hauptachse davor eine Bresche nach Westen zu schlagen oder den Teich durch die Anlage eines schmalen Strandes zu würdigen. Riepl Riepl Architekten und DnD Landschaftsplanung haben Beläge, Bepflanzung, Beleuchtung und Möblierung der Freiräume überarbeitet und manche bisherige Brache des Geländes – häufig und mit Bedacht multifunktional – nutzbar gemacht.
Doch auch die Gebäude stehen nicht abgeschlossen für sich, sondern in lebhaftem Dialog mit dem Landschaftsraum. So schwebt der weiß glänzende Erweiterungsbau der Bibliothek an der nördlichen Kante des Campus hoch oben zwischen den Kronen der alten Bäume über dem von Riepl Riepl Architekten in seinem postmodernen Auftritt beruhigten Bestand. Von schlanken Stützen getragen, beschirmt er einen vielfältig nutzbaren Platz und ist zusätzlich zur barrierefreien Erschließung im Inneren des Gebäudes über eine geschwungene Freitreppe zu erreichen.
Die Treppe mündet in das begrünte Atrium im Zentrum des neuen Learning Centers. Mit seiner Vielfalt an unterschiedlichen Raumsituationen bietet es den Studierenden ein Lernumfeld, das neben dem stillen Studium der Bücher vor allem den lebhaften Austausch mit anderen ermöglicht. Der dank der umsichtigen, zusätzliche Beschattungsmaßnahmen obsolet machenden Planung der Fassaden ungehinderte Ausblick ins Grüne ist ein wichtiges Gestaltungselement des unter hohem Detailierungsaufwand „einfach“ gestalteten Learning Centers.
Mit der anstelle eines Parkplatzes errichteten Kepler Hall im Süden des Campusgeländes hat die Universität erstmals ein Eingangsgebäude bekommen, das gleichzeitig Informationsstelle, Aula und auch Standort des Universitätssportinstitutes ist. Die Architektur der Kepler Hall ist folglich beides: repräsentativ und robust. Ihr Betonsockel stellt einen lang gestreckt rechteckigen Platz in das Gelände. Er wird von einem mächtigen Dach, dessen Holzkassetten auf einer umlaufenden Reihe von Betonstützen ruhen, beschirmt. Die gläserne Hülle des Innenraums liegt hinter der Tragkonstruktion, sodass ein gedeckter Umgang und eine großzügige gedeckte Vorzone entstehen.
Empfang mit Informationsstelle
Das Innere der Kepler Hall wird von einem dem Haupteingang im Osten zugeordneten Erschließungskern aus Sichtbeton geteilt, der eine Empore trägt. Hier ist auch der Empfang der JKU mit der Informationsstelle untergebracht. Weiter im Westen erweitert sich der Raum nach unten zu einer multifunktionalen (Sport)Halle mit Zuschauertribünen. Die Konstruktion der Kepler Hall ist dunkel und tritt so hinter das Geschehen zurück, das sie umfängt. Raumhoch verglast lenkt die Hülle dieses Torgebäudes unseren Blick in die inspirierende Fülle von Frei- und Zwischenräumen, die den Charakter des Campus prägen.
Die JKU unter Rektor Meinhard Lukas und die BIG als Bauherrschaft haben es bewiesen: Architektur bringt das Kunststück zuwege, auch Banales in ein überzeugendes Ganzes zu betten. In ein Ganzes, das Kommunikation nicht zwangsläufig mit Konsum verbindet, in einen Raum, der Bewegung nicht eingrenzt, sondern inspiriert. Auf dem Campus der JKU zeigt Linz, wie es sein könnte. Wie praktisch ist es doch, Universitätsstadt zu sein!
„Aus alt mach neu“ statt „Abreißen!“: Kann dieses Vorhaben gelingen? Es kann. Ein Beispiel: Hort und Kindergarten Hauderweg in Linz-Ebelsberg – Gebäude, die sich wie selbstverständlich in den Garten einfügen.
Architektur hält ewig. Leider trifft das auch auf Bauten zu, die man nicht als Werke der Baukunst bezeichnen würde. Was aber soll man mit Gebäuden tun, die noch einen guten Teil ihrer technischen Lebensdauer vor sich haben, während sie funktionell längst verschieden sind? Wie verhält man sich an einem Ort, der von Planungsentscheidungen geprägt ist, die man heute nicht mehr verstehen, geschweige denn vertreten kann? Richtig: Man macht das Beste aus der Situation. Und manchmal wird dieses Beste sogar richtig gut.
Als das in Linz ansässige Büro Mia2 Architektur eingeladen wurde, einen von der Bauherrschaft, der ILG Immobilien Linz GmbH, selbst erstellten Vorentwurf zur Sanierung einer Kinderbetreuungseinrichtung am Hauderweg im Linzer Stadtteil Ebelsberg weiterzuführen, fand es sich mit einem Bestandsgebäude aus dem Jahr 1990 konfrontiert, das mit drei sowohl im Grundriss als auch in der Dachausbildung abgeschrägten Körpern ins Auge sticht. Während ein weniger auffällig anmutender Trakt aus der unmittelbaren Nachkriegszeit weiter im Osten des Grundstückes abgebrochen werden musste, war der zweigeschoßige Westtrakt zu erhalten. Anstatt sich nun von den Fehlern der Vergangenheit möglichst weit zu distanzieren, hat sich Mia2 Architektur an die wesentlich schwierigere Aufgabe der Reparatur gemacht. Diese umfasst nicht allein die Sanierung des Westtraktes, dem das Architektenbüro mit einigen sparsam gesetzten Interventionen Tageslicht und die Funktionalität eines kindgerechten Umfeldes einhaucht. Während in dem als Kindergarten genutzten Gebäudeteil die Bauarbeiten noch im Gange sind, ist der im Osten anschließende Neubau des Hortes bereits fertiggestellt. Ihn hat Mia2 Architektur in einer Weise mit dem Vorgefundenen verknüpft, die über die physische Verbindung der beiden Trakte hinausgeht. So wurde der Beweis erbracht, dass auch baulich wenig geglückte Situationen durch die Einbindung in ein schlüssiges Gesamtkonzept doch deutlich verbessert werden können.
Der Neubau nimmt das Motiv der schrägen Schnitte in Grundriss und Dachform auf und nutzt den viel zu häufig eingesetzten Formalismus zur Verbesserung der neu geschaffenen Räume. Der Anschnitt des Bestandsgebäudes an der Straßenseite im Osten wird vom ebenfalls zweigeschoßig angelegten Neubau gespiegelt. So entsteht eine zurückgesetzte und somit geschützte, von einem Vordach beschirmte Eingangszone, die den Haupteingang des Horts und einen Nebeneingang des Kindergartens erschließt. Aus dem Übergang zum Hauderweg ergeben sich unregelmäßig fünfeckige Bodenfelder, deren additive Fortsetzung im Inneren des Hortes die Entstehung eines wie selbstverständlich fließenden Raumes begünstigt. Aus dieser in das Obergeschoß geöffneten und über runde Dachflächenfenster zusätzlich belichteten Halle gelangt man in die rechtwinkelig angelegten Hortgruppenräume. Die giebelige Dachlandschaft des Bestandes wiederum übersetzt Mia2 Architektur in mehrere parallel nebeneinander aufgereihte Satteldächer, die den winkelförmig an den Kindergarten geschobenen Hort abschließen. Da die Räume der Hybridkonstruktion aus Holz und Stahlbeton bis unter die keineswegs stereotyp gleich ausgebildeten Dächer reichen, ergibt sich aus dieser Faltung im Obergeschoß des Hortes eine abwechslungsreiche Raumlandschaft, deren Wirkung nicht dem Zufall, sondern sorgfältiger Planung geschuldet ist. Die Fähigkeit, Entwurfsentscheidungen nicht nur hinsichtlich ihrer Funktionalität, sondern auch mit Blick auf ihre räumlichen Folgen kritisch zu beurteilen, gehört zu den grundlegenden Voraussetzungen, unter denen Architektur überhaupt entstehen kann. Der Wille, diese Fähigkeit auch einzusetzen, wenn es dafür angesichts steigenden Arbeitsaufwandes bei gleichbleibendem Honorar keine pekuniären Anreize gibt, ist ebenfalls unerlässlich. Und nicht zuletzt bedarf es einer Bauherrschaft, die im Vertrauen auf die Kompetenz des von ihnen beauftragten Architekturbüros die Planung umsetzen lässt. Dann hat man sich ein Ergebnis wie die Kinderbetreuungseinrichtung am Hauderweg redlich verdient.
Nutznießer sind neben der Stadt in erster Linie die Kinder und das Betreuungspersonal; sie verbringen ja einen großen Teil ihres Lebens in diesen Räumen. Der bereits fertiggestellte Hort empfängt sie mit einem hellen, multifunktionalen, über die gesamte Gebäudehöhe offenen Eingangsbereich, der dank großzügiger Verglasungen mit dem Grünraum in Verbindung steht. Auch die Gruppenräume wenden sich mit großen Fensterelementen nach draußen. Sie werden allerdings durch schmale Zwischenbereiche von den Erschließungsflächen getrennt. In diesen etwas niedrigeren Zonen finden sich neben Stauräumen und Teeküchen Bereiche, die mit teppichbelegten Sitzstufen zum Rückzug einladen. So entsteht ein gewisses Maß an Konzentration und Intimität, ein Gefühl der Verbundenheit mit der jeweiligen Gruppe, wenngleich überall im Haus die Qualität des zusammenhängenden Ganzen spürbar bleibt.
Auch das Mobiliar des Hortes wurde von Mia2 Architektur entwickelt oder ausgesucht. Neben der daraus gewonnenen Ordnung der Räume, die sich etwa auf die diskrete Leitungsführung der haustechnischen Anlagen erstreckt, ist es der kluge Umgang mit Licht, Material und Farbe, der das Haus zu einem Ort macht, in dem man gerne lernt, spielt oder arbeitet. Die Räume sind hell, aber ihre Oberflächen blenden nicht; der Baustoff Holz wird gezeigt, aber bleibt im Hintergrund; die Farben sind sanft und sorgsam aufeinander abgestimmt. Selbst den rötlich braunen Ton der mit Hanf gedämmten verputzten Fassade hat Mia2 Architektur aus der Färbung des vorgefundenen Daches abgeleitet, die nun als Zeichen erdiger Naturverbundenheit gelesen werden kann. So wird das Haus in seiner augenzwinkernd verspielten Körperhaftigkeit zu einem Teil des Gartens, aus dem es sich erhebt. Alte Bäume und vorsichtig in die Topografie eingefügte Bereiche mit Spielgeräten, einem Sandhaufen oder einem Rodelhügel halten die Freibereiche in austarierter Balance zwischen „natürlicher“ Anmutung und vielfältiger Nutzbarkeit. Es ist nicht leicht zu erklären, wo Architektur beginnt. In der Kinderbetreuungseinrichtung Hauderweg jedenfalls lässt sie sich schon in jungen Jahren als ebenso robustes wie inspirierendes Gehäuse des Alltags erleben.
Der neu gefasste Teil des denkmalgeschützten Winklerbaus in Linz konnte gerade noch vor der großen Sperrstunde eröffnet werden. Der kulturelle Wert der historischen Konstruktion wurde gewahrt, eingezogen ist der Auftraggeber – ein Geldinstitut.
Was erwarten wir von einer Stadt? Dichte, Vielfalt, Innovation, Wirtschaft, Kultur . . . Die Idee der Stadt ist jahrtausendealt. Dementsprechend lang wäre eine Liste der Begriffe, die man mit ihr in Verbindung bringt. Mindestens so ergiebig ist die Frage, wie man Städte richtig baut. Die täglichen Staumeldungen aus den Einfallstraßen, Leerstände in ehemals besten Lagen oder Viertel, in die sich die Polizei nicht mehr hineinwagt, legen nahe, dass wir zuletzt nicht immer die richtigen Antworten gefunden haben. Stadt ist Veränderung. Wir bauen weiter, was im Lauf der Jahrhunderte entstanden ist. Wenn wir klug sind, gelingt es uns dabei, einmal geschaffene Qualität nicht zu zerstören.
Der Linzer Architekt Hans Feichtlbauer hat in den Jahren 1931/32 in der Linzer Landstraße Nummer 15 ein Wohn- und Geschäftshaus errichtet, das mit kraftvoller Plastizität die Flucht der Nachbarhäuser fortsetzt und der Stadt gleichzeitig eine über den Straßenraum hinausreichende Tiefe verleiht. Somit gehört der nach seinen Bauherren benannte Winklerbau zu jenen städtebaulichen Glücksfällen, die eine durchaus intensive Nutzung ihres Bauplatzes mit der gestalterischen Bereicherung des Stadtraumes verbinden. Seine südwestliche Stirnseite hält der Winklerbau mit einem nur dreigeschoßig ausgebildeten Baukörper besetzt, der durch über Eck geführte Fensterbänder in den beiden Obergeschoßen der Einmündung der Bethlehemstraße in die Landstraße Raum und Ansehen gibt.
Dieses Kopfgebäude des Winklerbaus hat nun die Raiffeisen Landesbank Oberösterreich zu ihrem baulichen Flaggschiff gemacht. Hertl.Architekten aus Steyr haben als Gewinner eines geladenen Architekturwettbewerbes den Umbau des Gebäudes geplant, der im März, gerade noch vor der großen Sperrstunde, eröffnet werden konnte. Dem Straßenraum wendet der denkmalgeschützte Winklerbau nach der Reparatur einiger früherer Eingriffe ein vertrautes Antlitz zu. Die Kastenfenster der Obergeschoße wurden unter Wahrung ihrer ursprünglichen Erscheinung bauphysikalisch an heutige Vorgaben angepasst, dem zu großflächigen Auslagen aufgerissenen Erdgeschoss sein verputztes horizontales Fassadenband zurückgegeben. Die bis zum Boden reichende Verglasung darunter wahrt nun dank ihrer den Rhythmus der historischen Fenster aufgreifenden Sprossen wieder den Charakter einer zwar durchlässigen, aber ernst zu nehmenden Gebäudehülle.
Offenheit, Transparenz und Blickbeziehung sind Begriffe, die der Bauherrschaft im Zusammenhang mit der Gestaltung ihres Hauses am Herzen lagen. Der Entwurf von Hertl.Architekten entspricht dem Wunsch nach lebendiger Kommunikation innerhalb des Gebäudes und nach Präsenz des Unternehmens im öffentlichen Raum, ohne jene Leistungen zu vernachlässigen, die man von einem Bankhaus jedenfalls erwartet: Sicherheit und Diskretion. Dabei kommt der klugen Nutzung des Bestandes besondere Bedeutung zu. Das dreigeschoßige Kopfgebäude des Winklerbaus gilt als erster Eisenbeton-Skelettbau der Stadt, seine Decken ruhen auf massiven Betonpfeilern. Durch das Öffnen der beiden mittleren der zwölf dreischiffig angeordneten, annähernd quadratischen Deckenfelder stehen nun alle Ebenen des Hauses in Verbindung zueinander. Betritt man von der Landstraße her kommend die Bank in der Mittelachse des Ecktraktes, reicht der Blick weit in die Höhe und Tiefe des Gebäudes. Die Wand linker Hand – das nördliche Drittel wird im Erdgeschoß von einem anderen Unternehmen genutzt – ist mit Moosfeldern begrünt. Im Hintergrund ragt ein massiver, an seiner Stirnseite von fließendem Wasser verkleideter Körper, der Liftschacht, in die Höhe. Aufmerksamkeit und Emotion werden somit nicht ausschließlich über Werbegrafik und Bildschirme generiert. Von oben fällt Sonnenlicht in die Halle, denn Hertl.Architekten haben im zweiten Stock, nach Westen zur Landstraße hin, ein begrüntes Atrium aus der Kubatur des Hauses geschnitten.
Wir haben es also mit einem Denkansatz zu tun, der weniger an der Maximierung der Nutzfläche denn an der optimalen Nutzung des Volumens interessiert ist. Dieses Konzept geht auf: Mögen die unterschiedlichen Funktionsbereiche hier auch dichter gepackt sein als anderswo, so erhält doch jeder Raum neben den unmittelbar auf seine Bestimmung abgestellten Eigenschaften die Qualität der Großzügigkeit. Von ihr profitieren Mitarbeiter und Kunden gleichermaßen, nicht zuletzt durch den erleichterten Kontakt zwischen den beiden Gruppen, zu dem die Architektur hier animiert. Einen prominenten Platz in dem zu Geschäftszeiten um den Selbstbedienungsbereich vergrößerten Foyer nimmt ein Informationsstützpunkt ein, der die Firmenfarbe Gelb in der von Weiß und lichtem Grau geprägten Stimmung mit freundlicher Selbstverständlichkeit trägt. Daneben liegen, textil gedämpft und durch grün bedruckte Gläser vom Straßenraum abgeschirmt, Kojen zur diskreten Abwicklung von Bankgeschäften. Zum Höchstmaß gesteigert wird das Gefühl der Sicherheit in dem Raum gleich neben dem Eingang, aus dem man mit dem Banksafe im Keller in Verbindung tritt. In den Büros und Besprechungsräumen der über den Lift oder das nahezu unverändert belassene Stiegenhaus erreichbaren Obergeschoße schwingt das Pendel der Stimmung wieder in Richtung Kommunikation und Transparenz. So wird die Bankstelle als Gesamtheit zum hellen Gehäuse professioneller Geschäftigkeit, das über die Fensterbänder und das Atrium mit dem Stadtraum in Beziehung steht.
Nur wenige Schritte vom Winklerbau entfernt öffnet sich an der Adresse Promenade 14 eine schmale Passage, die wesentlich mehr Urbanität ausstrahlt, als es neuere, von poliertem Stein und buntem Licht erstrahlende Geschäftsstrecken vermögen. Schaufenster und die Öffnung in das eine oder andere kleine Lokal machen den Weg, der nach Norden bis zum Hauptplatz führt, kurzweilig und interessant. Doch auch in dieser jüngst renovierten Passage ist es der Blick nach oben, der dem Raum seine Qualität verleiht. Drei rechteckige Glasdächer geben ihm Rhythmus und erhellen ihn mit Tageslicht. Der in Wien ansässige Bauingenieur Karlheinz Wagner hat den kulturellen Wert ihrer historischen Konstruktion erkannt und sie in Zusammenarbeit mit einem von ähnlicher Liebe zur Technikgeschichte beseelten Schlosser vor der Zerstörung gerettet. Die Unterkonstruktion der Dächer besteht aus Eisenbahnschienen, die Sprossenprofile aus erfinderisch gekanteten Blechen. In akribischer Handarbeit vom Rost befreit, gereinigt und wieder zusammengebaut, hat die Konstruktion in experimentellen Lastversuchen ihre Tragfähigkeit ebenso unter Beweis gestellt wie die Haltbarkeit eines nach wie vor empfehlenswerten ästhetischen Konzepts: dem effizienten Einsatz verfügbaren Materials mit festem Blick auf seine bestmögliche Form.
Was braucht es, um ländliche Abwanderung zu reduzieren? Glasfaserinternet, eine echte Raumordnung – und die Dorfgemeinschaft. Für die Weiterentwicklung Letzterer ließ die Gemeinde Leisach, Osttirol, benötigte Räume nachhaltig und umsichtig errichten – in einem neuen Gemeindehaus.
Es klingt ein wenig antiquiert, wie es Heinrich Hübsch, Architekt, Hochschulprofessor und großherzoglich badischer Beamter, im Titel seiner 1828 veröffentlichten Schrift formuliert hat: „In welchem Style sollen wir bauen?“ Dennoch: Heute, da technisch alles möglich und gestalterisch alles erlaubt ist, ist die Frage nach dem „richtigen“ Bauen womöglich noch schwerer zu beantworten. Die Ansätze, die Architekturtheoretiker seit der Antike dazu entwickelt haben, sind höchst unterschiedlich. Sie haben aber auch vieles gemeinsam. Funktionalität, Konstruktion, Material, Proportion, Schönheit sind Fixsterne am Firmament der europäischen Baukunst.
Allerdings sind die Sterne auch in klaren Nächten nicht überall gleich gut sichtbar. An Lichtquellen, neben denen sie verblassen, herrscht bei uns kein Mangel. So ist ein kleines Dorf in Osttirol vielleicht der richtige Ort, um über angemessenes zeitgenössisches Bauen nachzudenken. Die 700-Seelen-Gemeinde Leisach liegt am südwestlichen Ausgang des Lienzer Talbodens unweit der Lienzer Klause, wo Tiroler Freiheitskämpfer 1806 eine aus dem Süden heranrückende napoleonische Übermacht am Weitermarsch durch das Pustertal hindern konnten. Als Revanche für den Widerstand ließ der französische General vor seinem Abzug noch zehn Dörfer, darunter Leisach, niederbrennen. Man steht hier also auf geschichtsträchtigem Boden. Leisach ist aber auch eine moderne, wirtschaftlich und kulturell funktionstüchtige Gemeinde, die mit den gleichen Problemen kämpft wie fast jede Landgemeinde Österreichs außerhalb der stetig wachsenden Speckgürtels: vor allem mit der Abwanderung der Jungen, Gebildeten in die Ballungsräume mit ihren attraktiven Arbeits-, Freizeit- und Konsumangeboten. In Leisach bleibt man optimistisch. Man hofft auf den oft versprochenen Anschluss an das Internet per Glasfaser, man schmiedet Allianzen mit Nachbargemeinden, um eine Raumordnung zu verwirklichen, die den Namen verdient. Und man pflegt die Dorfgemeinschaft, indem man ihr die Räume zur Verfügung stellt, die sie für ihre Weiterentwicklung braucht.
Nach einem moderierten Diskussionsprozess kam man vor fünf Jahren überein, einen baufälligen Hof nächst der Pfarrkirche abzubrechen und durch einen Neubau zu ersetzen. Ein Gutachterverfahren zur Vergabe der Planung brachte die Entscheidung für die im oberösterreichischen Neumarkt im Mühlkreis ansässigen Schneider & Lengauer Architekten. 2017 wurde das Gemeindehaus Leisach fertiggestellt, das nun neben dem Gemeindeamt die Administration der Pfarre, einen Mehrzwecksaal sowie Proberäume für den Singkreis und die Musikkapelle beherbergt. Dass sich der Neubau trotz des umfangreichen Raumprogramms mit großer Selbstverständlichkeit in den Kern des Dorfes fügt, ist zunächst der Entscheidung zu verdanken, sein Volumen in zwei Körper aufzuteilen, die mit einem Erschließungskörper verbunden sind. Die fast beiläufige Unaufdringlichkeit des Gemeindehauses ist allerdings auch einer mutigen Entwurfsentscheidung geschuldet: Schneider & Lengauer Architekten haben die Gestaltungselemente des Gebäudes bewusst aus dem Fundus gewählt, den das Umfeld bietet. Massive verputzte Lochfassade, Satteldach mit moderatem Dachvorsprung, rechteckige Holzfenster. Keine Ironie, keine Symbolik, keine Abstraktion. So baut man, wenn man sich traut, Normalität pur. Nur wer genauer hinschaut, erkennt, dass hier ebenso versierte wie sensible Gestalter am Werk waren, die sich jedes Details angenommen haben. Von außen betrachtet sind es wohl die Fenster, deren unregelmäßige Setzung und Teilung in einen breiten und einen auffallend schmalen Flügel nicht den Sehgewohnheiten entsprechen. Doch auch wenn sie jenes Salzkörnchen sein mögen, das dem Ganzen subtile Würze verleiht, ist ihre Lage und Form an jeder Stelle ihrer Funktionalität geschuldet.
Betritt man das Gemeindehaus durch den Haupteingang über den Platz kommend, verstärkt sich der Eindruck, es mit einem Gebäude zu tun zu haben, das andere als die geläufigen Qualitätsmaßstäbe setzt. „Gediegenheit“ ist ein Ausdruck, der sich angesichts der weiß verputzten Mauern, des warmen Farbtons des Holzes und der hellgrünen Natursteinböden anbietet. Als Bauherrschaft hat sich die Gemeinde hier Verdienste erworben, deren Bedeutung für die Entstehung qualitätsvoller Architektur gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann: Einer der wichtigsten Beschlüsse des Gemeinderates im Zusammenhang mit dem Neubau war jener, sich bei der Ausschreibung der einzelnen Gewerke zu hochwertigen heimischen Baustoffen und regionaler Wertschöpfung zu bekennen.
So erhebt sich das Gemeindehaus Leisach nun mit drei monolithisch gemauerten Geschoßen aus dem nach Osten abfallenden Gelände. Den Platz an der Hangoberseite flankiert es mit einem Geschoß. Hier findet sich rechts vom Haupteingang der große Mehrzwecksaal mit einem ebenfalls vom Platz her zugänglichen Nebenraum. Sein Volumen reicht bis unter das Satteldach, die Wände sind mit Lärchenholz verkleidet. Drei Fenster schauen ins Tal, ein aus fünf Fenstern zusammengesetztes Band richtet den Blick nach Süden, in den Ort. Die Landschaft ist in allen Räumen als Gestaltungselement präsent. Links vom Haupteingang sind die Büros des Gemeindeamtes um einen Nebenraumkern angeordnet. Auch hier haben Schneider & Lengauer Architekten unter Verwendung von weißem Putz, grünem Travertin und rötlichem Lärchenholz eine Folge von Räumen komponiert, die zeigen, dass Funktionalität und Schlichtheit keineswegs um den Preis gestalterischer Banalität erkauft werden müssen.
Folgt man der einläufigen Treppe im gläsern zum Tal hin geöffneten Erschließungstrakt ein Geschoß nach unten, gelangt man zu den Räumen der Pfarre und einem Sitzungszimmer. Auf dieser Ebene stellt ein an der Hangkante entlang geführter Steg die Verbindung zum Pfarrheim her. Vom Stiegenpodest aus fällt der Blick über eine Verglasung hinunter in den zweigeschoßigen Proberaum der Musikkapelle, der dank seines Volumens sehr gute akustische Eigenschaften aufweist. Er liegt wie der Proberaum des Singkreises auf der untersten Ebene des Gemeindehauses, die im Sinne der für die Anlage charakteristischen Alltagstauglichkeit über einen Eingang von der talseitigen Straße her zugänglich ist.
Das Bezirksalten- und Pflegeheim Gaspoltshofen in Oberösterreich feiert sein zehnjähriges Bestehen. Gelegenheit, eine Antwort auf die Frage nach der Haltbarkeit seines Baukonzepts zu suchen: der Holz-Hybridbauweise.
Das Bezirksalten- und Pflegeheim Gaspoltshofen ist in die Jahre gekommen. Nach den Plänen der in Vöcklabruck ansässigen Architekten Gärtner + Neururer als konstruktiver Holzbau errichtet, feiert es bald sein zehnjähriges Bestehen. Ein Jahrzehnt mag im Lebenszyklus eines Gebäudes kein allzu langer Zeitraum sein. Um die Frage nach der Haltbarkeit eines Konzepts mit Blick in die Zukunft beantworten zu können, reicht es allerdings aus.
Hinterfragen wir die Nachhaltigkeit der Anlage zunächst aus der Perspektive des Städtebaus, war es klug, einen Bauplatz im Zentrum von Gaspoltshofen zu wählen. In Zeiten der Ausgangssperre ist den Bewohnerinnen und Bewohnern wenigstens der Ausblick in das ihnen vertraute Umfeld geblieben. Auch die Teilung der fast 7000 Quadratmeter großen Nutzfläche auf drei Baukörper, die sich mit drei Obergeschoßen über einem verbindenden Sockelgeschoß erheben, hat sich als richtig erwiesen. So entspricht die Anlage ungeachtet ihrer Größe in Volumen und Ausrichtung dem Maßstab des von kleinen Wohnhäusern geprägten Umfeldes. Die mit der Gliederung erreichte Zonierung der Freiflächen in sorgfältig gestaltete Grünräume und die Entflechtung der Wege und Zugänge haben sich bewährt.
Unverwüstlich ist auch die innere Organisation des Alten- und Pflegeheims. Mit der Dreiteilung der Anlage ist es Gärtner + Neururer gelungen, unmittelbare Präsenz und kurze Wege des Pflegepersonals mit überschaubaren Strukturen für die Bewohner zu verknüpfen. Die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Flügel erleichtert ihnen die Orientierung im Haus, während die der jeweiligen Gruppe zugeordneten Gemeinschaftsräume eine selbstbestimmte Kontaktpflege ermöglichen. Das von Martina Schürz-Neururer entwickelte Konzept verschiedenfärbiger, jeweils zwei Zimmereingänge zusammenfassender Wandmuster verstärkt für die Bewohner das Gefühl, im Heim „daheim“ zu sein. Die Unterteilung der Zimmer in mehrere Wohngruppen und deren Betreuung durch zentral gelegene Pflegestützpunkte sind für die Alten- und Pflegeheime Oberösterreichs mittlerweile Standard geworden. Das Abbilden dieses organisatorisch und menschlich bewährten Konzepts im Auftritt nach außen wird jedoch mittlerweile als unbezahlbar eingestuft, zum städtebaulichen Schaden der kleinen Landgemeinden.
Stellen wir nun die Frage, welchen Grad an Nachhaltigkeit die Entscheidung zum Holzbau, genauer: zur Holz-Hybridbauweise, mit sich gebracht hat. Das Sockelgeschoß steckt zu einem großen Teil im Erdreich und wurde deshalb aus Stahlbeton errichtet. Dass auch die Erschließungsbereiche in den Obergeschoßen Stahlbetonkonstruktionen sind, ist den Vorbehalten der Brandschutzbehörde geschuldet, die vor zehn Jahren noch als unüberwindlich galten. Die Aufenthalts- und Wohnbereiche jedoch werden von Massivholzwänden und -decken umschlossen, von einem Baustoff also, der wie kaum ein anderer für Nachhaltigkeit steht. Zweifellos verbraucht die Verwandlung eines Baumstamms in eine wie immer geartete Holzkonstruktion geringere Ressourcen als die Herstellung einer entsprechenden Konstruktion aus Stahlbeton. Je weniger weit das Holz gereist ist, desto günstiger fällt der Vergleich aus.
Im Alten- und Pflegeheim Gaspoltshofen finden sich etwa 2000 Kubikmeter verbauten Holzes. Da in Österreich etwa 30 Millionen Kubikmeter Holz im Jahr nachwachsen, ist das Ausgangsmaterial für das Heim in etwas mehr als einer halben Stunde entstanden, und das möglicherweise sogar in der Nachbarschaft. Die ausführende Firma jedenfalls liegt keine zwölf Kilometer von Gaspoltshofen entfernt.
Die Tatsache, dass jeder Baum, dessen Holz verbaut und nicht verbrannt wird, einem neuen Baum Platz macht, der wiederum – sofern Klimawandel und Borkenkäfer nicht dazwischenfahren – die gleiche Menge CO2 speichern wird, trägt ebenfalls zum „grünen“ Image des Baustoffes Holz bei. Wie haltbar aber ist das Material? Grundsätzlich hat Holz im Zusammenspiel von Druck- und Zugfestigkeit, Gewicht und Wärmeleitfähigkeit bessere Werte als jeder andere Baustoff. Auch sein Brandverhalten kann zu einem Vorteil werden: Holz schmilzt nicht und tropft nicht, Holzkonstruktionen versagen nicht plötzlich, ihre Tragfähigkeit bleibt berechenbar. Doch nicht nur Feuer, auch Feuchtigkeit, Pilze, tierische Schädlinge und die UV-Strahlung können dem Holz zusetzen. Um die Lebensdauer eines Holzgebäudes ohne den Einsatz giftiger Substanzen zu verlängern, muss man etwas von konstruktivem Holzschutz verstehen. Auf diesem Gebiet stellen mitunter jahrhundertealte traditionell errichtete Holzbauten ein Wissensarchiv unschätzbaren Wertes dar.
Sie weisen uns den Weg zu einer Wertschätzung des Gebauten, ohne die „Nachhaltigkeit“ eine leere Worthülse bleibt. Sie führen uns zu einer Haltung, die dem Glaubenssatz einer vom Konsum getriebenen Gesellschaft – „Neu ist schön“ – widerspricht; die akzeptiert, dass Zeit das Aussehen der Dinge verändert; die Reparatur der Zerstörung vorzieht; die weiß, dass man auch an das Ende denken muss. Hinsichtlich der Errichtungskosten kann eine hinterlüftete Holzfassade mit einem verputzten Vollwärmeschutz nicht konkurrieren. Bürdet man die Kosten für die dereinstige Entsorgung aber nicht einfach nachfolgenden Generationen auf, ist eine Konstruktion aus sauber trennbaren Elementen auch aus Kostengründen den fest zu Sondermüll verklebten Schichten vorzuziehen.
Gerade die sichtbare Veränderung des Holzes unter dem Einfluss von Sonneneinstrahlung, Temperatur oder Luftfeuchtigkeit spricht unsere Sinne ebenso an wie seine gewachsenen Unregelmäßigkeiten. Mit konisch ausgeformten, hellfarbig ausgekleideten Fensterleibungen setzen Gärtner + Neururer die Verwitterung des Holzes als Gestaltungsmittel ein. Auch im Inneren des Hauses nutzen sie die sinnliche Wirkung des Holzes mit Bedacht: für Menschen, die das Riechen und Berühren einer mit Holzschindeln belegten Wand, das langsame Wandern des Blicks über die Maserung einer Holzdecke mit dem Leben verbinden, auch wenn dieses zu einem großen Teil bereits hinter ihnen liegen mag.
Die Architekten Gärtner + Neururer haben zwanzig Altenheime, alle als Gewinner vorgeschalteter Architekturwettbewerbe, geplant. Auf diese Aufgabe fokussiert ist das Büro dennoch nicht. Auch als Holzbauspezialisten möchte es sich nicht bezeichnen, obwohl es vor Kurzem in Kufstein eine Krankenpflegeschule aus Holz fertiggestellt hat und hofft, den zuletzt gewonnenen Wettbewerb, das Gemeindezentrum in Sankt Aegidi, ebenfalls aus Holz zu bauen. Wird der Holzbau den Klimawandel stoppen, die Welt retten können? Wenn er mehr bietet als eine sparsame CO2-Bilanz, wenn er Ort und Nutzer wichtig nimmt, kurzum: wenn Architektur im Spiel ist, wird der Versuch jedenfalls von Nutzen sein.
Ein Kindergarten als Impulsgeber für den Ortskern: Als nach außen ruhig und einfach, in seinem Inneren aber sehr komplex gibt sich der neue Gemeindekindergarten in Schlierbach, Oberösterreich.
Welche Bilder sehen Sie vor sich, wenn Sie „ländlicher Raum“ denken? Fruchtbares Grünland oder überdüngten Boden? Ein idyllisches Dorf oder einen verlassenen Ortskern? Eine liebliche Landschaft oder den Speckgürtel der Großstadt? Ländlicher Raum ist von allem etwas. Vor allem aber ist er ungeachtet des Booms der Großstädte nach wie vor jener Raum, den etwa die Hälfte der Bevölkerung Österreichs Heimat nennt. Ein Alltagsraum, in dem man wohnt, arbeitet und einkauft. Wo man die Kinder großzieht, die Tante Hanni betreut und sich bei der Feuerwehr engagiert, bei der Musik oder im Verschönerungsverein. Man kennt einander. Man kennt auch die Probleme und bemüht sich um Lösungen. Die Folgen einer über Jahrzehnte verkorksten Raumordnung lassen sich zwar nicht über Nacht korrigieren; doch viele Fehler, die man vor ein paar Jahren noch begangen hätte, hat man zu vermeiden gelernt.
In Schlierbach im oberösterreichischen Traunviertel etwa war die Wahl des Bauplatzes für den kürzlich fertiggestellten Neubau des Gemeindekindergartens an der Fürstenhagenstraße nicht unumstritten. Es gab starke Stimmen, die seiner Errichtung „auf der grünen Wiese“ den Vorzug gegeben hätten. Es war Überzeugungsarbeit notwendig, um diese auf den ersten Blick einfachere und billigere Wahl abzuwenden. Aus Sicht der Schlierbacher Bürgermeisterin, Katharina Seebacher, hat sich der Diskussionsprozess gelohnt: Der Kindergarten ist dem Ortskern als wichtiger Impulsgeber erhalten geblieben. Die zu Beginn der Diskussion noch fehlende Vorstellung, wie man dem steil geneigten Abhang eine räumlich ansprechende, barrierefreie Anlage abgewinnen kann, hat die Architektur ergänzt. Eine von Wolf Architektur (Grieskirchen) und Architekt Kienesberger (Wels) gebildete Arbeitsgemeinschaft hat den Architekturwettbewerb zum Neubau des Kindergartens für sich entschieden und wurde mit der Generalplanung beauftragt.
Wolf Architektur/Kienesberger setzten einen geometrisch sehr einfach anmutenden zweigeschoßigen, von einem Satteldach abgeschlossenen Körper so an eine Geländekante, dass seine beiden Ebenen direkt an das Terrain angebunden sind. Die vom schlichten Umriss ausgesendete, leicht lesbare Botschaft „Haus“ ist dem Wunsch der Architekten geschuldet, nichts Ortsfremdes in das zwischen den öffentlichen Gebäuden oben am Hang und den Siedlungshäusern weiter unten aufgespannte Umfeld zu setzen. Es versteht sich von selbst, dass die aus Freiraum wie aus Gebäude komponierte Anlage ruhig und einfach wirkt, aber als Ergebnis einer Vielzahl verschränkter Erzählstränge eine komplexe Angelegenheit ist.
An erster Stelle nach der getroffenen Standortwahl standen die Überlegungen zum reibungslosen Ineinandergreifen der vielfältigen Anforderungen an das Haus: Die Räume müssen auf die Körpergröße und die Fähigkeiten kleiner, im Bereich der Krabbelstube sehr kleiner Kinder abgestimmt sein. Gleichzeitig sind die Bedürfnisse der Pädagogen zu berücksichtigen, die sich etwa mit den allseits beliebten, für sie leider nur auf allen vieren betretbaren Spielhäuschen schwertun. Es soll gespielt, gelernt, gekocht, gegessen und geschlafen werden. Am zeitlich individuell gestaffelten Ende des Tages ist eine geordnete Übergabe der Kinder an die Eltern zu organisieren. Feste wollen gefeiert werden, allerlei Administratives ist auch zu erledigen. Nicht zuletzt muss man jederzeit draußen spielen, aber hurtig das WC aufsuchen können, ohne Schmutz ins Haus zu tragen. Inspiration, Freiraum und Geborgenheit sind ebenso wichtig wie Sicherheit, Hygiene und Kontrolle.
Wolf Architektur/Kienesberger haben die beiden Geschoße zweihüftig angelegt. Der Kindergarten wird auf seiner unteren Ebene an der Westseite von der ruhigen Fürstenhagenstraße und über einen neuen, von der Anhöhe vor dem Stift herabführenden Fußweg erschlossen. Der Haupteingang befindet sich in einem witterungsgeschützten Einschnitt und führt über einen Windfang direkt in den zentralen Erschließungsbereich. Gleich beim Eintreten fällt der Blick in einen Spielhof, der den Gang mit Tageslicht erfüllt. Der Hof belichtet auch den multifunktionalen Raum, in dem die Kinder ihr Mittagessen einnehmen, auf der einen und den Ruhe- und Bewegungsraum auf der anderen Stirnseite des Hauses. Straßenseitig sind links vom Haupteingang die Räume der Krabbelstube untergebracht. Rechts davon reihen sich zunächst das Zimmer der Leiterin, der Personalraum und ein Gruppenraum aneinander. Im Obergeschoß finden sich drei Gruppenräume, die einen Ruhe- und Bewegungsraum in die Mitte nehmen und an der Nordostecke des Hauses von einer großen überdachten Terrasse ergänzt werden. Den Gruppenräumen in beiden Geschoßen sind ebenfalls gedeckte Terrassen vorgelagert, über die man in den Garten gelangt. Spätestens hier verwandelt sich die anspruchsvolle Topografie des Bauplatzes vom Kosten- in einen nicht zu unterschätzenden Gestaltungsfaktor.
Der Bewegung, die aus der Geländeformation in die Anlage hineinwirkt, haben Wolf Architektur/Kienesberger mit einer überaus disziplinierten Ausformung des Gebäudes geantwortet. Dem Außenraum wendet das Haus homogen wirkende Flächen zu, die zwar von Öffnungen und Rücksprüngen strukturiert werden, ihren Zusammenhalt jedoch nicht verlieren. Der souveräne Umgang mit dem Baustoff Holz, im Außenauftritt durch die vertikal gegliederte Fassade aus sägerauem Lärchenholz prominent gezeigt, im Inneren des Kindergartens mit den Böden, den Glasportalen, dem eigens entwickelten Mobiliar und der Untersicht des Satteldaches präsent, beweist, dass eine ökologisch verantwortungsbewusste Haltung in der Wahl der Technologien ohne Einbußen an Eleganz möglich ist. Der Gemeindekindergarten in Schlierbach ist zweifellos funktionstüchtig, robust und wirtschaftlich; er fügt sich nahezu lautlos in sein Umfeld. Doch gerade im Leisen, Unaufgeregten, Sanften liegt die im Wortsinn feine Grenze zur Baukultur.
Mit den Zielen der Nachhaltigkeit geht Baukultur fast selbstverständlich Hand in Hand. Sie gedeiht im Grunde überall, jedoch nur unter günstigen klimatischen Bedingungen. Sie erfordert Mut und Sensibilität, Pioniergeist, Beharrungsvermögen und einen weiten Horizont. Auch sie gehört zum Bild des ländlichen Raums.
Auf dem Campus der Johannes-Kepler-Universität wird fleißig renoviert und adaptiert. Mit dem Innovationszentrum des Linzer Institute of Technology bietet sich ein Raumgefüge, das alles tut, was Raum tun kann, um die Kooperation zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zu fördern.
Die Johannes-Kepler-Universität am nordöstlichen Rand von Linz ist eine Welt für sich. Der Universitätscampus wurde 1966 auf dem Gelände des einstigen, nun als Rektoratsgebäude dienenden Schlosses Auhof angelegt und spricht die Sprache seiner Entstehungszeit: Moderne und Funktionalismus bejahend und klug genug, den städtebaulichen Wert einer freien Mitte erkannt und in der Gestalt des aus dem Schlosspark übernommenen Teichs erhalten zu haben. Gut fünfzig Jahre und einige Ölpreiskrisen nach der Errichtung der ersten Gebäude sind Maßnahmen notwendig geworden, die über eine technische Sanierung hinaus dem veränderten Selbstverständnis der noch als Hochschule für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften gegründeten Universität Raum und Ausdruck verleihen. Den seitens der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) ausgeschriebenen Wettbewerb zur Erneuerung der Anlage hat das Linzer Büro Riepl Riepl Architekten mit seinem Vorschlag für ein neues multifunktionales Eingangsgebäude, die Neugestaltung der Bibliothek und eine Aufstockung des Turms der Technisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät (TNF-Turms) gewonnen.
Während an zwei der drei Vorhaben noch gebaut wird, ist ein weiteres von Riepl Riepl Architekten geplantes Objekt, das Linz Institute of Technology (LIT) Open Innovation Center, bereits in Betrieb. Dieses der Zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft gewidmete Gebäude liegt als schlichter, Nord-Süd-orientierter Quader am südwestlichen Rand des Campus. Den leichten Anstieg des Geländes haben Riepl Riepl Architekten zur Anordnung eines von der Verkehrsfläche im Süden her ebenerdig zugänglichen Untergeschoßes genutzt, in dem ein Supermarkt untergebracht ist. Weiter hinten, im Norden des aus rot durchgefärbtem Beton errichteten Sockelgeschoßes, befinden sich Reinräume für verschiedene Institute der Universität. Über dem Sockel erhebt sich ein zweieinhalb Geschoße hoher konstruktiver Holzbau, dessen an der Fassade liegende Tragstruktur ebenso wie die das Obergeschoß und Teile des Erdgeschoßes beschattenden Holzlamellen in der Farbe des Betons gestrichen sind. Hinter der hohen, das gesamte Gebäude horizontal abschließenden Attika verbergen sich nach Süden geneigte Sheddächer, die den Innenraum blendungsfrei belichten, während ihre mit Fotovoltaikpaneelen bestückten Dachflächen Strom erzeugen.
Das Open Innovation Center (OIC) ist in zwei Bereiche gegliedert: Der nördliche, etwas kleinere Teil birgt eine dreischiffige Fabrikationshalle, die LIT-Factory, eine „vernetzte Lehr-, Lern- und Forschungsfabrik für Smart Polymer Processing und Digitalisierung“. Hier können neue Entwicklungen aus dem OIC auf kurzem Weg in kleinen Serien produziert werden. Der größere Teil des Gebäudes wird von einer Struktur eingenommen, die den Gedanken der fachgebietsübergreifenden Zusammenarbeit von Wissenschaftern und Wirtschaftstreibenden ebenso räumlich fasst wie den hohen Stellenwert von offenem Austausch bei der Lösung intellektuell anspruchsvoller Aufgaben. Es ist ein „Open Workspace“, den Riepl Riepl Architekten als einen von zwei massiven Stiegenhauskernen ausgesteiften Holz-Skelettbau entwickelt haben. Etwas weniger modisch ausgedrückt: Riepl Riepl Architekten haben ein anregend spannungsvolles, großzügiges Raumgefüge geschaffen, das alles tut, was Raum tun kann, um Kommunikation, Kooperation und Inspiration zu fördern. Das wird schon unmittelbar hinter dem Haupteingang spürbar, wo eine breite, aus „normalen“ und Sitzstufen komponierte Treppenanlage auf die obere Ebene führt. Zwei weitere Lufträume, deren einer, das multifunktionale OIC Stufenforum, auch als Hörsaal für 200 Personen eingesetzt werden kann, stärken die Verbindung der Geschoße untereinander zu einem großen Ganzen.
Um in dieser klar als Gehäuse einer Gemeinschaft ausgewiesenen Anlage ein anregendes Arbeitsumfeld zu schaffen, das vielen unterschiedlichen Temperamenten und Aufgaben gerecht wird, haben Riepl Riepl Architekten die Bereiche den ihnen zugedachten Funktionen entsprechend unterschiedlich gestaltet. Das den gesamten Raum fassende Konstruktionsmaterial Holz und das durch die Verglasungen der Sheddächer gleichmäßig gestreute Tageslicht verleihen dem Haus ebenso wie sein gesammelter Auftritt nach außen eine wohltemperierte Gelassenheit, der gelegentliche studentisch-kreative Unordnung ebenso wenig anhaben kann wie die aus Kostengründen sichtbar geführten Haustechnikleitungen.
Wer noch mehr Freiraum sucht, als ihn das OIC bietet, wendet sich, das Haus verlassend, nach links, den Hügel hinauf. Dort haben Riepl Riepl Architekten auf dem höchsten Gebäude des Uni-Geländes, dem TNF-Turm, das Somnium errichtet. Sein Name ist dem Titel eines Textes entlehnt, in dem der große Gelehrte Johannes Kepler eine geträumte Reise zum Mond schildert. Während der Turm in seiner Substanz fast unverändert erhalten und nur durch den Einbau neuer Fenster bauphysikalisch ertüchtigt wurde, ergänzt ihn das Somnium auch um jenes Element, das im Eifer des Fortschritts und des Wirtschaftswachstums gerne vergessen wird: den keiner konkreten Nutzung zugeordneten Zwischenraum.
Die filigrane, von Bollinger+Grohmann Ingenieure berechnete und demnächst noch durch ein Lichtobjekt von Raphaela Riepl Artist erweiterte Stahlkonstruktion bietet zwar ein Foyer, einen weiteren Raum sowie eine große, bei Bedarf von Sonnensegeln beschattete Aussichtsplattform. Den Erwartungen der unmittelbaren Funktionalität vermag es sich dennoch zu entziehen. Wer auf der Ebene des Somniums aus dem Aufzug steigt, erlebt im Ausblick auf die unmittelbar an den Campus grenzenden bewaldeten Hügel des Mühlviertels den Dialog des „natürlichen“ Landschaftsraumes mit der höchst künstlichen „Natur“, die Michael Lin den beiden Räumen hier oben eingeschrieben hat. Dann aber macht man sich auf den Weg, die hölzerne Rampe hinauf, auf die Stadt und die weite, vom Gebirge in der Ferne gesäumte Ebene zu. Das Stahlfachwerk, das die Plattform trägt und den Himmel rahmt, hält den Blick nicht auf. Im Gegenteil: Einer Startrampe für Ideen gleich verweist es auf eine seit Menschengedenken jeder Technik und jeder Erfindung eingeschriebene Sehnsucht: auf die Hoffnung, den Kosmos zu verstehen und so auf den Kanonenkugeln seiner Gesetze zu reiten.
Schöne Landschaft und Tourismus gehen am Attersee Hand in Hand – was nicht immer in fruchtbaren Ergebnissen resultiert. Ein gelungenes Beispiel von Bauen am und um den See: das Café Eiszeit in Seewalchen.
Der Attersee bildet einen der reizvollsten Landschaftsräume in (Ober)Österreich. Schöne Landschaft und Tourismus: Dieses Paar geht hier schon seit mehr als hundert Jahren Hand in Hand. Der Attersee ist allerdings auch uralter Siedlungsraum. Gut dokumentierte Funde jungsteinzeitlicher Pfahlbauten belegen, wie lange Fischer und Bauern schon an seinen Ufern ansässig sind. Bauten wie das Schloss Kammer erinnern daran, dass auch die Reichen und manchmal sogar Schönen nicht auf die Erfindung der Sommerfrische gewartet haben, um sich hier niederzulassen. All diese einander ergänzenden, mitunter auch widersprechenden Formen des Zusammenlebens finden ihren Ausdruck in der Architektur rund um den See.
Gerade am Attersee sind zahlreiche Beispiele dafür zu finden, wie man Aspekte des „Ländlichen“ mit Ansprüchen gehobenen Komforts und „Bodenständigkeit“ mit temporärem Aufenthalt angemessen verbinden kann. Ernst Plischke hat mit seinem Haus Gamerith in Seewalchen ein international bekanntes Beispiel der klassischen Moderne geschaffen; Max Luger und Franz Maul haben mit ihren Arbeiten am Attersee neue Maßstäbe im Verschränken von Landschaft, Architektur und Handwerkskunst gesetzt; namhafte Architekten wie Johannes Spalt, Riepl Riepl Architekten oder Hertl Architekten haben am Attersee für private Bauherren gebaut; und auch öffentliche Auftraggeber haben, wie das von SPS Architekten geplante Gemeindezentrum von Steinbach oder die Revitalisierung des Kindergartens in Unterach von der Architektengemeinschaft Hohengasser Steiner Wirnsberger zeigen, die Bedeutung der Architektur für die Funktionstüchtigkeit eines Ortes erkannt.
Angesichts so vieler guter Beispiele fällt es schwer zu verstehen, warum sich Gemeinden als Baubehörde für die Genehmigung von Projekten hergeben, von deren Errichtung mit Ausnahme des Bauträgers niemand profitiert. Auch von Bauwerken dieser Art gibt es rund um den Attersee eine viel zu große Zahl. Ein Teil dieser in Maßstab und Gestaltung gleichermaßen misslungenen Objekte mag der euphorischen Unkultur des sogenannten Wirtschaftswunders und seiner Fortsetzung im Massentourismus geschuldet sein. Heute ist es das billige Geld auf seiner fieberhaft Suche nach Rendite, das auf den letzten verbliebenen Flecken nicht verbauten Bodens zu „Betongold“ wird. Bei der Vermarktung dieser Objekte brüstet man sich gerne, wie das Beispiel einer derzeit entstehenden Wohnanlage „in erster Reihe“ im Schlosspark von Kammer zeigt, mit unverbaubarem Seeblick. Dass jeder Blick zwei Richtungen hat, dass man selbst einen Beitrag zur Verbesserung des Orts- und Landschaftsbildes leisten könnte oder sich zumindest bemühen sollte, es nicht zu stören, kommt den tüchtigen Projektentwicklern nicht in den Sinn. Der Schaden, den diese auf maximales Bauvolumen ausgelegten Anlagen in mehr als einer Beziehung anrichten, wird von der Allgemeinheit geschultert und ist für ihre Betreiber daher nicht besonders interessant.
Es geht nicht darum zu sagen: „Das Boot“ – diesfalls das Seeufer – „ist voll“, obwohl diese Aussage nicht übertrieben wäre. In jenem Zwickel am Nordufer des Sees etwa, wo unweit des Strandbades Seewalchen die Promenade in die Bundesstraße 151 mündet, hätte man die Existenz eines freien Bauplatzes nicht vermutet. Wohlgemerkt: Das hier errichtete Objekt, ein Café namens „Eiszeit“, liegt angesichts seiner Größe für echte Investoren weit unter der Wahrnehmungsschwelle. Dennoch hat sein Bau eine Veränderung bewirkt. Es ist den jungen, in Linz ansässigen Moser und Hager Architekten zu verdanken, dass diese für den Ort gut ausgegangen ist.
Auf der Suche nach einer angemessenen Formensprache für den eingeschoßigen Pavillon haben Anna Moser und Michael Hager mit ihrem Team auf das Naheliegende zurückgegriffen: den See. Wer will, kann sogar die Geometrie des Grundrisses mit den ausgerundeten Ecken als Analogie zu seinen Buchten sehen. Das Café schließt mit seiner Nordseite unmittelbar an ein Blumengeschäft, das der erwähnten Gabelung von Atterseestraße und Promenade städtebaulich nachvollziehbar einen halbkreisförmigen Vorbau zuwendet. Dieses Motiv der Rundung haben Moser und Hager Architekten mit der parallel zur Promenade verlaufenden südlichen Außenwand des Cafés aufgegriffen, ein wenig deutlicher im Osten, mit kleinerem Radius an der südwestlichen Ecke des Gebäudes. Der Eingang in das Café liegt an der im Osten weiter werdenden Promenade. Er wird durch das Zurückschwingen der Wand hinter die Kante des Dachs betont und gleichzeitig vor der Witterung geschützt.
So werden Passanten in einem logischen Bewegungsablauf in ein Haus gezogen, das als gebaute Interpretation des Außenraums dessen Qualitäten erst so richtig zur Geltung bringt. Der Innenraum des Eiscafés ist in einen Bereich für den Gassenverkauf und in das Café geteilt, die beide zur Promenade hin orientiert sind. Dahinter befinden sich die Sanitäranlagen, der Abgang in den Keller und die Küche. Während der Raum hinter dem einfachen grauen Verkaufspult mit kleinformatigen weißen Wandfliesen und einigen sparsam eingesetzten schwarzen Elementen von Sauberkeit und den italienischen Eisdielen der Kindheit erzählen, spricht das Café eine andere Sprache. Eine Sitzbank, den gesamten Raum in sanfter Kurve umfassend, setzt jenes Zeichen, das für den Befund von „Gemütlichkeit“ so wichtig ist. Das Graublau der lasierten Holzlatten ihrer Rückwand ist wie die Farbe der Polsterung dem Farbspektrum des Sees entlehnt. Die Latten setzen die mit gehobelten Brettern geschalte Betonwand fort und unterstreichen so die „natürliche“ Anmutung dieses außerhalb der Architektenschaft häufig als „kalt“ empfundenen Baustoffes. Die Deckenuntersicht aus hellen Eschenholzlatten wiederum greift das Motiv der Bootsstege auf und belegt mit ihrem im Bereich des Dachvorsprungs ungestört in den Außenraum geführten Fugenbild, wie sorgsam Moser und Hager Architekten dieses Gebäude detailliert haben.
Zwei verspiegelte Lichtbrunnen öffnen die Decke des Cafés zu den Kronen der mächtigen, die Promenade säumenden Bäume und spenden der Zimmerpflanze das nötige Licht. Im Süden weitet sich der Raum über seine vom Eingang bis zur westlichen Außenwand geführten Faltschiebefenster hinaus zum See. In der nördlichen Nische aber haben Moser und Hager Architekten die Wand über der Sitzbank mit Streifen aus Spiegelglas verkleidet. Hier ist er wieder, der Attersee: die Natur und was wir Menschen daraus machen, im wechselnden Licht, gebrochen durch Hunderte von Kanten, ein fragiler, ein bleibender Wert.
Umbauten im Stift Schlägl: Die neue Pforte dient als Rampe und Vorplatz, im Inneren finden sich Klosterladen und Seminarrezeption, das Besucherzentrum der Stiftsbrauerei zeigt sich in neuem Gewand. Gute Gründe für einen Besuch im Mühlviertel.
Es zählt zu den erklärten Zielen Österreichs und der EU, den ländlichen Raum abseits der Ballungsräume attraktiv und lebendig zu erhalten. Zahlreiche Projekte und beträchtliche Fördersummen belegen den Stellenwert dieser Bemühungen. Für ihren nachhaltigen Erfolg sind jedoch starke, in der Region verwurzelte Partner notwendig, deren wirtschaftliches, soziales und kulturelles Gewicht dem wirkungslosen Verpuffen der eingesetzten Mittel entgegensteht.
Die Prämonstratenser-Abtei Stift Schlägl sieht sich, nicht zu Unrecht, als geistlichen Mittelpunkt des oberen Mühlviertels. Sie bekennt sich zu ihren Rollen als einer der bedeutendsten Wirtschaftsfaktoren, als Bewahrerin des kulturellen Erbes und als gesellschaftliche Impulsgeberin der Region. Die Zusammenarbeit des Stifts mit einem Architekturbüro, dessen Selbstverständnis in naturgemäß weit bescheidenerem Maßstab und ebenfalls nicht ohne Berechtigung sehr ähnlich ausgeprägt ist, hat über die Jahrzehnte zu einer höchst positiven Entwicklung mit einem vorläufigen Höhepunkt in der oberösterreichischen Landesgartenschau 2019 geführt.
Josef Schütz, der Gründer des ursprünglich nur in seinem Heimatort Haslach, mittlerweile aber auch mit einer Niederlassung in Linz ansässigen Architekturbüros Arkade, hat seinerzeit das Vertrauen der Chorherren durch den Bau der Bergstation Zwieseltreff im Wintersportgebiet Hochficht gewonnen. Seither wird er mit kleineren und größeren Interventionen am Kloster und den mit dem Stift in Verbindung stehenden Gebäuden beauftragt. Diese Eingriffe reichen von der Wiederherstellung verloren gegangener Qualitäten durch das Entfernen heute nicht mehr nachvollziehbarer Ein- und Zubauten bis zur Neuorganisation ganzer Nutzungsbereiche. So hat das Architekturbüro Arkade beispielsweise die unmittelbar vor dem Kloster gelegene ehemalige Hoftaverne und das benachbarte Stöckl als Sitz der Stiftsverwaltung revitalisiert. Im Auftritt nach außen klar der historischen Substanz den Vorrang gebend, entspricht die Hoftaverne nach dem Einbau einer luftigen, von Tageslicht erhellten und selbstverständlich barrierefreien Erschließungszone nun den Bedürfnissen eines modernen Unternehmens, in dessen Büros Kommunikation ebenso großgeschrieben wird wie das Bewahren von Traditionen. Diese reichen beeindruckend weit zurück, hat man doch im Vorjahr 800 Jahre Stift Schlägl gefeiert. Pünktlich zu diesem Jubiläum wurde ein Projekt fertiggestellt, das die interne Erschließung des Stiftes völlig neu, alltagstauglich und benutzerfreundlich ordnet. Der wegen ihrer Lage am Hang vorher aus dem Stiftshof nur über Stiegen zugänglichen Stiftskirche ist nun ein Gebäude vorgelagert, das gleichzeitig als Aufgang, als Rampe und als Kirchenvorplatz dient. Die damit geschaffenen Räume und auch der Lift, der die barrierefreie Erschließung der Obergeschoße gewährleistet, erleichtern zwar das Leben der Angestellten und Bewohner enorm, treten jedoch für Betriebsfremde gar nicht in Erscheinung. Dringend benötigte Lagerräume und eine neue Zulieferung für die Stiftsküche sind unterirdisch angeordnet. Doch fasst der aus gestocktem Beton geformte, innen sorgsam mit Weißtanne ausgekleidete Körper auch die Stiftspforte, die Rezeption des Seminarzentrums sowie den Klosterladen und verbindet so, für Besucherinnen und Besucher gleich bei ihrem Eintritt in die Anlage sichtbar werdend, die Ebenen der Zeit wie jene des Raumes.
So wie der Masterplan des Architekturbüros Arkade für das „Stift im Landschaftsgarten“ seinen Beitrag zur Auswahl der Marktgemeinde Aigen-Schlägl als Standort der heurigen oberösterreichischen Landesgartenschau geleistet hat, so wirkt die Ausstellung als Motor für Neugestaltungen der stiftseigenen Gebäude. Die mitten im Gelände der Landesgartenschau „Bio Garten Eden“ gelegene Stiftsbrauerei kann ebenso wie das Stift im Rahmen eines Gartenschaubesuchs besichtigt werden. Die damit verbundene Vervielfachung der Besucherzahl erforderte eine neue, kontrollierbare Wegführung durch die Brauerei, die nicht nur eine didaktisch sinnvolle Vermittlung von Informationen unterstützt, sondern auch den Anforderungen der Sicherheit und Hygiene entspricht. Das Architekturbüro Arkade hat diese höchst komplexe Aufgabe ebenso übernommen und mit einem vergleichsweise kleinen, dem Stiftsteich zugewandten Zubau, vor allem aber mithilfe eines schlau durch die bestehende Substanz gefädelten Erschließungsbereichs zur allgemeinen Zufriedenheit gelöst.
Um bei dieser Gelegenheit die Präsentation der Brauereiprodukte zu optimieren, wurde das in Linz und Wien ansässige, auf Innenarchitektur spezialisierte Büro Destilat zur Zusammenarbeit eingeladen. Es entwickelte für das Besucherzentrum der Stiftsbrauerei ein variables Ausstellungs- und Shopsystem, das den hohen Anspruch der Braukultur – die Branche wetteifert ja hinsichtlich der Vielfalt und des Werts ihrer Erzeugnisse längst mit dem Weinbau – in entsprechend hochwertiger Raumgestaltung abbildet. Besucher des „Bio Garten Eden“ gelangen nun über eine kleine Brücke von der Seite her in den Quader aus Stahlbeton, der an der Fuge zwischen dem historischen Speichergebäude und den im 20. Jahrhundert errichteten, immer wieder veränderten Produktionsgebäuden der Brauerei über das ansteigende Gelände ragt. Der lang gestreckte Raum, der sich nach dem Eintritt öffnet, führt in die Tiefe der Anlage und barrierefrei hinauf respektive hinunter in deren unterschiedliche, für Besucher zugängliche Bereiche. Auf seiner westlichen Stirnseite schaut das Besucherzentrum mit einer Loggia in den Landschaftsraum, der nach dem Motto der Landesgartenschau, bewusst informell gestaltet ist.
Der Innenraum wiederum knüpft mit seiner aus hinterleuchteten gläsernen Wandverkleidungen komponierten Farbigkeit an die Grundstoffe des Bierbrauens an: Blau, Braun und Grün stehen für Wasser, Gerste und Hopfen. Das Holz, aus dem das Empfangspult, die Biertheke, die Regale und Stehtische gefertigt sind, stammt, ökologisch korrekt, aus dem stiftseigenen Sägewerk. Die Ausformung der Pulte nimmt unmittelbar auf die Holzstapel Bezug, die das Bild des Sägewerks prägen. Die dunkle Färbung des Holzes aber und die kräftige Dimensionierung der Profile rufen eine gewisse Urwüchsigkeit und nicht zuletzt die Jahrhunderte währende Tradition des Ortes in Erinnerung. So schaut, kostet und kauft man also Schlägler Bier in einem höchst sorgsam aus den unterschiedlichen Zuschreibungen an das Produkt gewirkten Ambiente und sagt sich: sehr geschmackvoll! What else?
Ein Spitalsumbau ist eine heikle Angelegenheit – vor allem bei laufendem Betrieb. Das Büro X Architekten zeigt vor, wie das gelingen kann, und beweist, dass räumliche Qualität kein Luxus sein muss. Zur Sanierung des Landeskrankenhauses Tamsweg.
Gibt es eine Bauaufgabe, die noch anspruchsvoller wäre als der Neubau eines Krankenhauses mit all seinen funktionalen, technischen und logistischen Zusammenhängen, mit seiner Fülle an Vorschriften und Standards? Gewiss: Eine noch größere Herausforderung ist der Umbau eines Krankenhauses bei laufendem Betrieb. Und welchen Stellenwert hat da die Architektur? Es ist wohl – paradoxerweise – den hohen Ansprüchen der Aufgabe geschuldet, dass diese Frage, wenn überhaupt, nur selten gestellt wird.
Mit ihrer noch bis Ende dieses Jahres andauernden Sanierung des Landeskrankenhauses Tamsweg zeigen die in Linz, Wien und Lambach ansässigen X Architekten, wie viel mehr als die zur Bewältigung einer komplexen Aufgabe zweifellos notwendigen technischen und organisatorischen Fähigkeiten die Entwicklung eines angemessen gestalteten Raumgefüges erfordert. Und sie weisen gleichzeitig nach, dass räumliche Qualität niemals Luxus ist – auf keinen Fall aber dort, wo die Nutzerinnen und Nutzer eines Hauses Menschen in Ausnahmesituationen sind.
Nach einem Bewerbungsverfahren im Jahr 2016 mit der Generalsanierung des ursprünglich noch zu Kaisers Zeiten errichteten und seither zweimal erweiterten Krankenhauses beauftragt arbeiten sich die X Architekten über eine geplante Bauzeit von 29 Monaten von oben nach unten fortschreitend durch die Geschoße der unvermindert in Betrieb stehenden Anlage. Erst vor Kurzem wurde der dem Haupteingang nachgeschaltete Empfang mitsamt einem heiter gestimmten Wartebereich vor den Ambulanzen in Betrieb genommen. Andere Abschnitte des Erdgeschoßes sind noch Baustelle. Doch in den weitgehend fertiggestellten Obergeschoßen ist die Grundhaltung der Generalsanierung schon ablesbar und wird auf ihre Alltagstauglichkeit überprüft. Diese Haltung ist ebenso leicht mit einem Satz – mithilfe der Architektur allen den Aufenthalt im Krankenhaus so angenehm wie möglich zu machen – umrissen wie anspruchsvoll in der Umsetzung. Haben ja schon die Nutzerinnen und Nutzer des Hauses, die Patienten, ihre Angehörigen, die Ärzteschaft, das Pflegepersonal, die Verwaltungsangestellten sowie die Instandhaltungs- und Reinigungskräfte, ganz unterschiedliche, einander mitunter widersprechende Vorstellungen eines angenehmen Umfeldes. Allen gedient ist zweifellos mit einem klaren Auftritt der Anlage nach außen, die einer logischen Ordnung der einzelnen Nutzungsbereiche im Inneren entspricht und sich in einer leicht nachvollziehbaren Wegführung und Orientierung im Haus fortsetzt.
Auch wenn die Kubatur der einzelnen Trakte nicht veränderbar ist, so hat sich das Erscheinungsbild des Krankenhauses durch das Begradigen seiner Fassaden und eine unaufdringliche, den Bauepochen folgende Farbgebung zweifellos verbessert. Deutlich von dunklen Fassadenelementen betont sind Haupteingang und Rettungszufahrt, denen im Inneren die kommunikativ gestaltete Empfangs- und Wartezone auf der einen und ein geschützter Erstbehandlungsraum auf der anderen Seite des Ambulanzbereichs zugeordnet sind.
Ein weiteres Zeichen der Verwandlung sind die dunkel gerahmten Körper der „Schaufenster“, mit denen die X Architekten, wo immer es die Funktionsabläufe erlauben, den Innenraum ein Stück weit nach außen stülpen und so mit dem Umfeld verbinden. Tamsweg liegt inmitten einer höchst reizvollen Landschaft, die nun gezielt über neue, großzügige Fensterelemente und die raumseitig in Zirbenholz gefassten Erker zur Steigerung der Raumqualität wahrgenommen wird. Generell wird Holz als ein landläufig mit Gedanken an Natur und Behaglichkeit verbundener Baustoff eingesetzt, wo dies ohne Bedenken hinsichtlich der Hygienevorschriften, etwa zur Rahmung eines Empfangspultes oder einer Sitznische, möglich ist.
In Bereichen, die mit starken Chemikalien gereinigt werden müssen, haben die X Architekten wenig zimperlich auf Holzimitation aus Kunststoff zurückgegriffen. So finden die Betten in den Patientenzimmern nun in einer der Wand vorgesetzten L-förmigen Blende ihren Halt, die zwar alle notwendigen technischen Leitungen und Anschlüsse (ver)birgt, in ihrer Anmutung aber viel eher Möbel als Maschine ist. Die Grundsatzentscheidung, das Krankenhaus seinem hohen Technisierungsgrad und den weitgehend genormten Abläufen zum Trotz nicht als Fremdkörper, sondern als einen in die Lebenswelt der Nutzerinnen und Nutzer integrierten Ort zu begreifen, kommt allen zugute. Denn wenngleich ein Panoramafenster im Operationssaal fehl am Platz wäre, so tut auch einer viel beschäftigten Chirurgin beim Diktieren von Protokollen die Aussicht in ein Gebirgstal wohl.
Der klugen Anordnung der einzelnen Zonen unter der Prämisse, die Wege kurz zu halten und gegenseitige Störungen zu vermeiden, haben die X Architekten naturgemäß große Aufmerksamkeit gewidmet. Da jeder Nutzungsbereich seinen eigenen Spielregeln folgt – eine Geburtshilfestation funktioniert nun einmal anders als der Schockraum in der Ambulanz –, unterscheiden sich auch die einzelnen, über das rein Organisatorische stets hinausführenden Gestaltungsmaßnahmen voneinander. Dennoch geht nie der Blick auf das Ganze verloren, das ja nicht zuletzt durch die Vorstellung einer harmonischen Zusammenarbeit vieler Einzelner eine beruhigende Wirkung entfaltet. Damit kommt jenen Elementen, die im gesamten Haus wiederkehrend eingesetzt werden, große Bedeutung zu. So ist etwa die Formensprache von Anmeldungs- oder Wartebereichen stets eine ähnliche. Wo Ornamente zum Einsatz kommen – im Bereich von Wandschonern etwa oder dort, wo Glasflächen aus Gründen der Sicherheit und zur Wahrung der Intimität teilweise mattiert sein müssen –, werden sie durch Abbilder von Höhenschichtenlinien und stilisierten Gämsen erzeugt. Die Geschoße wiederum unterscheiden sich durch eigene, nach oben hin dunkler werdende Schmuckfarben voneinander, die sich, sparsam und in unterschiedlicher Intensität eingesetzt, selbst in den sorgsam ausgewählten Fotografien an den Wänden wiederfinden.
Wohlüberlegte Raumfolgen, eine mit vielen kleinen Maßnahmen auf die jeweiligen Abläufe abgestimmte Ausstattung, das sorgsam austarierte Gleichgewicht zwischen gebotenem Schutz und offener Kommunikation sowie die deutlichen Bezüge zum Ort Tamsweg schaffen ein angenehmes Arbeitsumfeld für die Beschäftigten. Gleichzeitig stellt die stets auf das Sanfte, Informelle und Vertraute fallende Wahl der Mittel die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten und ihrer Familien in den Mittelpunkt. Denn auch die Angehörigen sind Teil des Lebens im Landeskrankenhaus Tamsweg. In den Palliativ-Zimmern etwa haben sie die Möglichkeit, sich auf einer wie selbstverständlich in den Raum integrierten Liege auszuruhen, wenn sie ihre Lieben in schweren Zeiten nicht allein lassen wollen.
Vier Jugendliche auf der Suche nach einer Werkstätte, ein Wettbewerb – und die Folge: ein „Wohnzimmer“, in dem man Gedanken spinnen und werken kann. Auf dem Gelände der Linzer Tabakwerke: „Le Grand Garage“.Gelungen!
m Anfang der Geschichte standen vier technikbegeisterte Jugendliche auf der Suche nach einer Werkstätte. Eine Garage oder Ähnliches sollte es sein, in Linz, robust und leicht zugänglich, mit Maschinen zum Bau von Prototypen ausgestattet und offen für Gleichgesinnte. Wie die Geschichte weiterging, liest man am besten unter www.grandgarage.eu nach. Nur so viel: Am 28. Februar 2019 wurde im Bestand der Linzer Tabakwerke „Le Grand Garage“ mit einer Fläche von etwa 4000 Quadratmetern eröffnet. Der Name hält zugleich den Ursprung des Projektes und die Dimension fest, die es mittlerweile erreicht hat.
Das Linzer Studio March Gut hat den geladenen Wettbewerb zur Gestaltung dieses „erweiterten Wohnzimmers, in dem man alleine oder in der Gruppe Ideen entwickeln und ausprobieren kann“, gewonnen und mit seinen Maßnahmen das Selbstverständnis der Grand Garage in Raum und Mobiliar übersetzt. Auf der Suche nach einer angemessenen Sprache für diese junge, zukunftsorientierte Formation haben Christoph March und Marek Gut den historischen Bestand der von Peter Behrens und Alexander Popp von 1929 bis 1935 gebauten Tabakwerke weder als unantastbare Ikone noch als lästiges, denkmalgeschütztes Hindernis behandelt. Vielmehr haben sie das Klügste getan, was man, mit einem Meisterwerk konfrontiert, tun kann: Sie haben daraus gelernt.
Redlicherweise sollte man nicht verschweigen, dass gerade das ehemalige Magazin 3, in dem die Grand Garage Unterkunft fand, Teil eines älteren, von Behrens und Popp bereits vorgefundenen und in ihren Fabriksneubau integrierten Bestandes war. Ungeachtet dieses Umstandes und des im Vergleich zu den prominenteren Trakten der Tabakwerke bescheidenen Anspruchs dieses Lagergebäudes finden sich auch hier zahlreiche Zeichen des umfassenden Gestaltungswillens, der das Hauptgebäude der Zigarettenfabrikation, die Pfeifentabakfabrik und das Kraftwerk auszeichnet. Die ebenso alltagstaugliche wie ausdrucksstarke Ausformung von Stützen, Trägern, Stiegenläufen und Brüstungen etwa, die bauphysikalisch höchst fortschrittlichen Fensterkonstruktionen oder die minutiös geplanten haustechnischen Installationen sind ihnen vorbehalten geblieben. Doch die aus der Klarheit der Konstruktion und der ungestörten Längserstreckung des Raumes erwachsende Großzügigkeit ist auch im einstigen Magazin 3 erfahrbar, das auf seinen ersten drei Ebenen nun zur Grand Garage geworden ist.
Betritt man das ehemalige Magazin 3 vom Peter-Behrens-Platz genannten Innenhof der Tabakwerke kommend, führt der Blick aus der Eingangshalle über alle drei der Grand Garage zugeordneten Ebenen in die Höhe. Die beiden ersten Mittelfelder der Deckenkonstruktion über dem Erdgeschoß und dem ersten Stock wurden herausgenommen, um eine direkt erfahrbare vertikale Verbindung innerhalb des räumlich zunächst ja völlig anspruchslosen Lagers herzustellen. In dem so entstandenen, nach wie vor durch quer liegende Träger strukturierten Luftraum findet sich ein erstes Statement zur Grand Garage: An der Rückwand der im Erdgeschoß eingerichteten gläsernen Box ist es als Visualisierung bereits gegenwärtig, alles Weitere liegt noch in der Zukunft. Der 3-D-Drucker, der, von einem Spezialkran getragen, in der Mitte des Luftraumes hängt, wird eine Stiegenskulptur fertigen, an deren Entstehung Techniker unterschiedlichster Fachrichtungen beteiligt sind. Material, Statik, Technologie und Form verbinden sich zu einem Werkstück, das aus sich heraus wächst und so zum Symbol für die in der Grand Garage arbeitende Gemeinschaft wird.
Deren Arbeits- und Kommunikationsprozesse sind in drei Zonen organisiert. Im Erdgeschoß liegen die Büros, Konferenzräume und Räume zur Entwicklung von Projekten. Einen Stock höher ist das Institut für Robotik der Kunstuniversität Linz zu finden. Hier stehen auch die CNC-Fräsen, die Maschinen zur Metallbearbeitung, die Schweißgeräte und die Beschichtungsanlagen. Der oberste Stock ist das Reich der CAD-, CAE- und CAM-Spezialisten. Hier sind die Elektronik, der 3-D-Druck und der Lasercut verortet, hier öffnet sich aber auch auf der Eingangsseite eine großzügige Lounge zum Peter-Behrens-Platz, während an der gegenüberliegenden Stirnseite des Geschoßes ein Forum Präsentationen den nötigen Raum bietet.
Das Motiv der Fabrik ist als Grundierung des Raumgefüges präsent geblieben. Das gilt sowohl für die weitgehend unangetastete Bausubstanz als auch für die Maßnahmen zur Transformation des Magazins zur Le Grand Garage. Christoph March und Marek Gut haben genommen, was da war, und das Vorgefundene gerade so weit verändert, um es weiter gebrauchen zu können. Diese Bereitschaft zu einem gewissermaßen rezyklierenden Design sollte man jedoch nicht mit Gleichgültigkeit hinsichtlich der Ergebnisse verwechseln: March Gut legt großen Wert auf Qualität. So ist die Tragstruktur der eigens für die Grand Garage entwickelten Polstermöbelserie „Profil“ zwar jener von Schwerlastregalen entlehnt, die Polsterungen jedoch sind hochwertig und mit feinem Stoff überzogen. Der Grundgedanke, das Mobiliar in der Werkstätte selbst anfertigen und bei Bedarf adaptieren und nachproduzieren zu können, prägt auch die zweite in der Le Grand Garage eingesetzte Möbelserie namens „Kontur“. Tische verschiedener Bestimmungen und Höhen sowie drei unterschiedliche Hocker wurden mittels CNC aus 30 Millimeter starkem Birkensperrholz gefräst. Ihre Elemente können ohne weitere Verbindungsteile von einer einzelnen Person ohne Werkzeug stabil zusammengesteckt werden. Einfach und robust sind diese Möbel und Lichtjahre von den Produkten lustiger Einrichtungshäuser entfernt, deren wichtigste Eigenschaft ihre Kurzlebigkeit ist.
Wollte man festhalten, worin das Besondere an der Gestaltung der Le Grand Garage liegt, müsste man wohl die Verbindung des Unfertigen, Veränderbaren mit einer sehr genauen, systematischen Arbeitsweise nennen. Farben setzt March Gut – Behrens und Popp nicht unähnlich – ordnend ein. Das Gebäude hält sich schwarz, weiß und gläsern im Hintergrund. Auch Erinnerungen kommen nicht zu kurz: Das einst als Boden-Verschleißschicht genutzte Holz wurde motivisch aufgegriffen und der neuen Funktion entsprechend in den Kommunikationsbereichen verlegt. Bewährtes wie die Klappgestelle von Biertischen oder Garagentore wurden adaptiert und eingesetzt. Überflüssiges wie Oberschränke in der Gemeinschaftsküche hingegen wurden durch eine gelochte Wandverkleidung ersetzt, in die man, wie es sich für eine Werkstätte gehört, bei Bedarf hängen kann, was nötig ist. March Gut vermitteln mit ihrer Architektur eine Atmosphäre von Professionalität und Experimentierfreude bei stark ausgeprägtem Sinn für Gemeinschaft. Besser hätte man die Grand Garage nicht porträtieren können.
Wohnungen, Geschäfte, ein Kindergarten und ein Park beieinander vereint: Das neue Quartier Riedenburg formt aus einer Vielzahl funktioneller und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen einen Ort, zu dem Menschen ein Gefühl der Verbundenheit entwickeln können. Besuch in Salzburg.
Wovon träumen Touristen, wenn sie nach Salzburg kommen? Würden Mozart und die Trapp-Familie vor dem Hintergrund eines rigoros durchgerasterten Häusermeers die gleiche Wirkung entfalten wie in der Getreidegasse und auf dem Domplatz? Man muss nicht Architektur studiert haben, um den spannungsvollen Wechsel der Salzburger Altstadt zwischen Enge und Weite, dem Abbild von Alltag und von Hochkultur, den Bürgerhäusern und den Repräsentationsbauten der Mächtigen zu schätzen. Offensichtlich fällt es Millionen Menschen leicht, sich auf dieser Bühne in Lebensgeschichten hineinzudenken. Das ist sicherlich auch dem Umstand zu verdanken, dass selbst die gut konservierte historische Bausubstanz Salzburgs ursprünglich nicht als Kulisse errichtet wurde, sondern als lebendige Stadt gewachsen ist.
Was aber erwarten Salzburger von ihrer Stadt? Ihre Wünsche sind denen der Touristen wohl ziemlich ähnlich. Mit dem Unterschied, dass es die eigenen Lebensgeschichten sein sollen, die ihre Stadt erzählt. Diese Geschichten mögen in ihrer Gesamtheit nicht besonders spektakulär sein; auch legt noch keine aus zeitlichem Abstand geborene Ungenauigkeit der Wahrnehmung den Schleier romantischer Verklärung über sie. Für die Qualität des Stadtraumes macht das keinen Unterschied. Es ist heute wie immer schon die Aufgabe einer Siedlung, aus einer Vielzahl funktioneller, kultureller und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen einen Ort zu formen, zu dem Menschen ein Gefühl der Verbundenheit entwickeln können. Mit reiner Funktionalität kommt man da nicht weit, man muss auch Emotionen wecken. Vieles kann dazu beitragen: die Bewegung im Raum etwa, Gelegenheiten zur Kommunikation, Ruhezonen, Bereiche, in denen kleine Kinder spielen, Jugendliche sich treffen, alte Leute am öffentlichen Leben teilnehmen können, die Verbindung mit dem Vorgefundenen und der Dialog des Gebauten mit dem Landschaftsraum.
In unmittelbarer Nähe des touristisch geprägten Salzburgs entsteht gerade ein Stadtteil, in dem dank eines mit großer Geduld und einiger Hartnäckigkeit geführten Vorbereitungs- und Planungsprozesses eine Fülle von Überlegungen dieser Art baulich umgesetzt werden konnte. An der westlichen Flanke des Rainbergs, etwa 500 Meter von den Tiefgaragen im Rücken des Festspielbezirks entfernt, werden auf einem annähernd 35.000 Quadratmeter großen Areal rund 330 Wohnungen, Geschäftsflächen, ein Stadtteilzentrum, ein Kindergarten und ein 5000 Quadratmeter großer, öffentlich zugänglicher Park errichtet. Der nördliche Teil der von Neutorstraße, Moosstraße, Sinnhubstraße und Leopoldskronstraße begrenzten Anlage ist seit Herbst in Betrieb. Der südliche Abschnitt ist noch im Bau und wird heuer im Sommer fertiggestellt. Möglich wurde die Aufwertung eines bislang eher vorstädtisch geprägten Viertels durch den Abbruch der ehemaligen Riedenburgkaserne und den Willen der neuen Eigentümer des Areals, mit dem Projekt nicht das Maximum an Rendite zu erzielen, sondern das Bestmögliche an Lebensraum für die Bewohner der Stadt zu schaffen.
Die Gemeinnützige Salzburger Wohnbaugesellschaft und die UBM Development Österreich beauftragten die Sieger des im Jahr 2014 durchgeführten Architektur- und Landschaftsplanungswettbewerbs mit der Planung des Quartiers, dessen Wohnungen zu 75 Prozent den Regeln des geförderten Wohnbaues unterliegen und nur zu 25 Prozent frei finanziert sind. Die in Salzburg ansässige Arbeitsgemeinschaft Schwarzenbacher Struber Architekten und Fally plus Partner Architekten entwickelten das städtebauliche Leitprojekt und einen Großteil der Objekte. Das Grazer Architekturbüro Pucher wurde auf Anraten der Wettbewerbsjury mit der Planung der Gebäude an der Neutorstraße beauftragt. Der Entwurf der Freiraumplanung stammt von Agence Ter aus Karlsruhe, ausgeführt wurde sie vom Büro Freiraum und Landschaft aus Zell an der Pram. Dass diese zahlreichen in den Planungsprozess eingebundenen Persönlichkeiten das Quartier Riedenburg nicht in eine mit guten Ideen gefüllte Wundertüte der Architektur verwandelt haben, ist wohl der Sensibilität und der Ernsthaftigkeit zu verdanken, mit der sie sich ihrer Aufgabe in gut zweieinhalb Jahre dauernder, vom Salzburger Gestaltungsbeirat begleiteter Arbeit gewidmet haben.
Zunächst galt es, dem Stadtteil das bislang von einer Mauer umwehrte und somit dem Raum entzogene Kasernenareal zurückzugeben. Das gelingt durch die offene Anordnung der Gebäude, die abwechslungsreiche, mit dem Umfeld verknüpfte Wege durch das Quartier begleiten. So wird die in die Moosstraße mündende Späthstraße etwa in der Mitte des Bauplatzes durch einen befestigten Freiraum fortgesetzt. Dieser mündet in den Park, der mit seiner sanften Aufwärtsbewegung den bewaldeten Abhang des Rainbergs vorwegnimmt. Die Anhebung des Geländes zur Leopoldskronstraße hin ist dem Schutz des Grünraumes vor dem Verkehrslärm geschuldet, der in allen vier flankierenden Straßen erheblich ist und nur durch ein Bündel von Maßnahmen neutralisiert werden konnte. Dazu zählt die scheinbar zwanglose Positionierung der Gebäude, die jeweils einen eigenen, individuell gestalteten Freiraum umschließen.
Auch in der Höhe sind die Baukörper gestaffelt, was die Anbindung an die kleinteilige Struktur des Stadtteiles erleichtert hat und spannende Außenräume mit abwechslungsreicher Lichtführung und zahlreichen Aus- und Durchblicken mit sich bringt. Um die mit der Gruppierung der Häuser einhergehende Eindeutigkeit der Adressbildung zu unterstreichen, haben die dem Freiraum zugewandten Fassaden kräftige, dem jeweiligen Cluster zugeordnete Farben bekommen.
Die Erdgeschoßzone ist entsprechend ihrer Nutzung gestaltet. So spaziert man, vom Platz an der Neutorstraße kommend, an Geschäftslokalen vorbei, schaut in das eine oder andere Atelier hinein, setzt sich in den Schatten eines Baumes, genehmigt sich einen Kaffee, bevor es Zeit ist, die Kinder aus dem Kindergarten abzuholen, oder schaut auf ein Schwätzchen im Stadtteilzentrum vorbei. Es ist durchaus denkbar, dass die Touristen das Quartier Riedenburg so bald nicht entdecken werden. Viele von ihnen würden in Gedanken an ihre Heimatstädte wahrscheinlich sagen: In Salzburg müsste man sein.
Schulen auf dem Land sind mehr als Bildungsstätten: So werden dort nicht nur Kinder unterrichtet und sozialisiert – sie dienen auch als Zentrum des kulturellen und sportlichen Lebens. Zwei Beispiele aus Oberösterreich.
Sie stehen nicht im Mittelpunkt der Debatte zur österreichischen Bildungslandschaft: jene Schulen des ländlichen Raumes, in denen Unterricht, ja Bildung mit großer Selbstverständlichkeit geboten wird. Dies mag an ihrer überschaubaren Größe liegen oder an der Einbettung in Gemeinschaften, für die sie eine wichtige Rolle spielen. Diese Schulen bergen ja nicht nur den Raum, in dem die Kinder unterrichtet und mit einem neuen sozialen Umfeld bekannt gemacht werden. Sie sind auch als Arbeitsplatz und als Ort kulturellen und sportlichen Lebens von großem Interesse für die Bürger einer Landgemeinde.
Der Neubau einer Schule ist in einer ländlichen Gemeinde immer eine Herzensangelegenheit. Für Architekten bringt das die intensive Diskussion aller Entwurfsentscheidungen mit sich; aber auch den Rückhalt, der aus solch einer Auseinandersetzung erwächst, wenn sie fachlich fundiert verläuft. So hat beispielsweise der von gegenseitigem Respekt getragene Dialog zwischen dem in Grießkirchen ansässigen Büro Wolf Architektur und dem Leiter der Volksschule Wallern einem Schulneubau den Weg geebnet, der aktuelle pädagogische Konzepte mit hohem gestalterischem Anspruch verbindet.
Die Marktgemeinde Wallern an der Trattnach – 3000 Einwohner, zwei Pfarrkirchen – liegt im oberösterreichischen Hausruckviertel. Sie hat trotz des moderaten Zuzugs der vergangenen Jahre ihr landwirtschaftlich geprägtes Gesicht bewahrt. Wolf Architektur hat die Schule in die Mitte des aus frei stehenden Häusern und Gehöften komponierten Ortskernes gestellt und damit dessen grün gesäumtes Netz aus schmalen Gassen und freien Räumen ergänzt. Die drei ineinandergreifenden Körper des Neubaus nehmen den Maßstab ihres Umfelds auf und fassen einen verkehrsfreien Vorplatz, einen Parkplatz und einen geschützten Pausenhof. Gleichzeitig setzen sie das Motiv des spannungsvollen Wechsels von Enge und Weite im Inneren der Anlage fort.
Dem witterungsgeschützt an einen Rücksprung des Erdgeschoßes gelegten Haupteingang liegt eine ebenso geschützte Freiluftklasse gegenüber. Die über einen Windfang erschlossene multifunktionale, auch als Speiseraum genutzte Eingangshalle öffnet sich über ihre gesamte östliche Flanke zum begrünten Pausenhof. Im Westen wird sie von einem Trakt gesäumt, der neben den Räumen für Schulleitung, Lehrerschaft und Personal auch eine Küche fasst. Daran grenzt der Turnsaal mit seinen Nebenräumen. In die Fuge zwischen die beiden Trakte hat Wolf Architektur einen eigenen, vom Lehrerparkplatz erreichbaren Eingang geschoben, der eine vom Schulbetrieb unabhängige Nutzung des multifunktionalen Turnsaales ermöglicht. Auch in dem vom „Kreativ-Cluster“ belegten Trakt an der Südseite der Eingangshalle findet sich ein über die schulische Nutzung hinausweisender Bereich: Die Schulbibliothek wird ebenso als Gemeindebücherei geführt und ist aus dem Windfang über einen separaten Eingang zugänglich. Im Obergeschoß liegt das Herzstück der Schule: die beiden „Lerncluster“. Jeweils vier Klassenräume, ein kleinerer „Differenzierungsraum“ und ein Raum für das Lehrerteam sind um eine „Marktplatz“ genannte Mitte gruppiert. Dieses über eine Lichtpyramide in der Decke und über Glasflächen in den Raumtrennungen erhellte Zentrum ist variabel möbliert und kann in Zonen unterteilt werden. Es erweitert das Raumangebot für den Unterricht, der nun in fließenden Übergängen vom Lernen zum Spielen, von der Konzentration zur Entspannung und von der Betreuung zur Selbstständigkeit unterschiedlichste Formen annehmen kann.
Die aufwendige Vorbereitungsarbeit, die eine solche Freiheit im Unterricht erst ermöglicht, klingt auch in der von Wolf Architektur gewählten Sprache an: Graue Böden und weiße Wände bilden einen stabilen Rahmen für den Schulalltag. Der Sichtbeton der Decke, die sichtbar geführten Lüftungsleitungen, die akustisch wirksamen Deckenfelder aus Holzwolle-Platten, ja selbst die Leuchten erzählen vom unverfälschten Einsatz robuster Materialien; die Planung der Räume voller Gemeinschaftsflächen, Wege, Rückzugsnischen und Sichtbezüge hat ohnedies vorweg alles Grobe und Banale aus diesem Haus verbannt.
Verlassen wir nun das Hausruckviertel, und wenden wir uns einer anderen kleinen Marktgemeinde zu: Reichenau im Mühlkreis. Auch hier wurde der Bau der Volksschule ausführlich und nicht ohne Emotionen diskutiert; auch hier finden sich mehrere Nutzungen – Volksschule, Turnsaal, Hort und Kindergarten – unter einem Dach vereint. Allerdings ist es kein Neubau, sondern eine neue Ordnung der im Lauf der Jahre angesiedelten Funktionen, die dem Linzer Büro TP3 Architekten hier in Reichenau gelungen ist. Die Ausgangssituation: Ein gedrungener, durch zwei Einschnitte an den Giebelseiten aufgespaltener, von Waschbeton und dunklem Holz geprägter Körper aus den 1970er-Jahren bot den Architekten reichlich Gelegenheit, neben organisatorischem Geschick auch gestalterisch Einfallsreichtum zu beweisen. Dank ihres Entschlusses, die notwendige thermische Sanierung des Gebäudes nicht bei einer außen aufgebrachten Schaumstoffschicht bewenden zu lassen, mussten sie überdies den Nachweis außergewöhnlicher Hartnäckigkeit erbringen sowie des Talents, selbst im Lauf eines Dienstlebens hart gewordene Budgetwächter mit Argumenten der Nachhaltigkeit zu überzeugen.
Die Fähigkeit, das Potenzial des Bestandes zu erkennen und mit sparsamen Ergänzungen der Kubatur nicht nur eine saubere Trennung der Funktionen in der nunmehr barrierefreien Anlage zu erzielen, sondern auch den Baukörper zu beruhigen, hat ihnen bei dieser Überzeugungsarbeit wohl geholfen. So präsentiert sich das Schulgebäude nun als klar umrissenes, von einer vertikalen Holzschalung umfangenes Haus, dem eine gewisse Prominenz eignet. Durch die Verlegung des Haupteinganges an die Fuge zum Turnsaal und das Schließen der Einschnitte im Obergeschoß sind an der südlichen Giebelseite der Schule zwei mit großzügigen Fensteröffnungen dem Ort zugewandte Räume entstanden. Somit hat auch die Volksschule von Reichenau „Marktplätze“ bekommen. Sie bereichern die Klassen und Funktionsräume mit einer lichten, vielfältig bespielbaren Mitte für einen Schulalltag auf der Höhe der Zeit.
Seit seiner Errichtung fast bis zur Unkenntlichkeit entstellt, herrschen nun wieder Platz und Lichteinfall vor: zur Generalsanierung des Schwanzer-Traktes der Universität für angewandte Kunst Wien durch Riepl Kaufmann Bammer Architektur.
Sie stammt aus einer längst vergangenen Epoche und hat schon einige Namen getragen: die Universität für angewandte Kunst Wien. Ursprünglich als „Kunstgewerbeschule“ in Symbiose mit dem benachbarten Museum gegründet, könnte sie heute ihren Bedarf an „Anschauungsmaterial“ für den Kunstunterricht wohl kaum mehr aus dessen Beständen decken. Auf eine Qualität kann „die Angewandte“ jedoch nach wie vor zurückgreifen: Ihre Gebäude sind beispielhaft für die Architektur ihrer Zeit.
Dieser Anspruch war schon mit dem ersten eigenen, nach den Plänen von Heinrich Ferstel am Stubenring errichteten Haus verbunden. Doch wie es Perioden gab, die der Architektur des ausgehenden 19. Jahrhunderts keinen künstlerischen Wert abgewinnen konnten, war auch der Respekt vor Bauten der 1960er-Jahre wie dem von Eugen Wöhrle und Karl Schwanzer errichteten Erweiterungsbau der damaligen Akademie nicht immer und überall besonders groß. Oder war es im Fall der Angewandten bloß die schiere Menge der im Lauf der Jahrzehnte irgendwie bewältigten Notwendigkeiten des Alltags, die den Schwanzer-Trakt in seinem Inneren fast bis zur Unkenntlichkeit entstellt haben? Seine von Riepl Kaufmann Bammer Architektur geplante Sanierung jedenfalls knüpft nun an die baukünstlerische Tradition der Angewandten ebenso an wie ihre Umdeutung des auf der anderen Seite des Wienflusses gelegenen ehemaligen Zollamtes zum Universitätsgebäude.
Riepl Kaufmann Bammer Architektur hat, als Sieger eines geladenen Verfahrens mit der Generalsanierung des Schwanzer-Traktes beauftragt, alles konstruktiv Unnötige daraus entfernt und seine klare, an einen Industriebau gemahnende Tragstruktur freigelegt. Der Schwanzer-Trakt erstreckt sich parallel zum Wienfluss. Seine sieben oberirdischen Geschoße sind zwischen zwei stirnseitig gelegenen Stiegenhäusern aufgespannt. Die filigranen, hinter abgehängten Verkleidungen zum Vorschein gekommenen kassettierten Stahlbetondecken werden von jeweils drei Betonstützenreihen getragen. Die lang gezogenen rechteckigen Hallen zwischen den Stiegenhäusern lassen eine Vielzahl unterschiedlicher Raumfigurationen zu. Um diese funktionelle Großzügigkeit auch im Raumeindruck zu erhalten, hat Riepl Kaufmann Bammer Architektur einen Bausatz entwickelt, der die notwendige Variabilität der Grundrisse in einem System verankert: In der Mittelzone ordnet eine abgehängte Decke aus Streckmetall den Verlauf der darüber vage sichtbaren haustechnischen Leitungen.
Quer zu den Längswänden gestellte Trennwände sind undurchsichtig ausgeführt, der Länge nach verlaufende Raumtrennungen transparent, Türblätter opak. Dieses Ordnungssystem setzt die unterschiedlichen Raumfigurationen der Universität um, ohne die Konstruktion erneut zu verschleiern oder Lichteinfall und Blick quer über die Tiefe des Traktes zu verstellen. Der Außenauftritt des Gebäudes ist nahezu unverändert. Lediglich eine im Garten angelegte Rampe verbindet nun ebenerdig die beiden Quertrakte der Anlage.
Hat Riepl Kaufmann Bammer Architektur mit der Generalsanierung des Schwanzer-Traktes also jene Qualitäten des Bestandes herausgearbeitet, die wir heute darin (an)erkennen, lag bei ihrem nach einem zweiten Wettbewerb beauftragten Umbau des ehemaligen Zollamts zum Universitätsgebäude der Schwerpunkt auf der Korrektur eines wesentlichen Charakterzuges des Vorgefundenen. Das um die vorletzte Jahrhundertwende entstandene Bauwerk wendet zwar dem Wienfluss eine reich gegliederte Eingangsfassade zu, hinter der ein repräsentatives Hauptstiegenhaus zeigt, dass man mit Raum wohl umzugehen wusste. Dahinter aber fanden sich in bester Gründerzeit-Manier die Amtsstuben dicht an dicht um drei enge Lichthöfe gepackt: eine für die Bedürfnisse einer Kunstuniversität unhaltbare Situation. Aus diesem massiven Block hat Riepl Kaufmann Bammer Architektur unter Erhaltung der äußeren Raumschicht den Kern herausgeschnitten und den so gewonnenen Raum mit einer neuen, lichterfüllten Mitte besetzt. Eine von Jürg Conzett entwickelte Tragstruktur aus Stahlbeton stabilisiert das Gebäude und bildet ein sechsgeschoßiges Atrium, dessen Galerien mehr leisten als die bloße Erschließung der daran gereihten Räume. Die Decken reichen über die nach oben hin schlanker werdenden Stützen hinaus, die transparenten Brüstungen haben breite, mit einer kleinen Aufkantung versehene Abdeckungen: Dieser Raum lädt zum Verweilen ein und dazu, sich anzuschauen, wie man Variabilität, Offenheit, Intimität, Ruhe oder Bewegung in Architektur umsetzen kann.
An die Stelle des westlichen Lichthofes hat Riepl Kaufmann Bammer Architektur ebenerdig eine zweigeschoßige, multifunktionale Aula gesetzt. Unter dem Saal quert die U-Bahn den Keller des Hauses, was die schalltechnische Entkoppelung der Aula notwendig machte. Darüber ist ein Gartenhof angelegt, der in seinen nun wesentlich besseren Proportionen die Anlage mit einem im städtischen Umfeld kostbaren Freiraum bereichert. Die Aula ist an ihrer dem Atrium zugewandten Westseite zur Gänze öffenbar. Auch die Rückwand im Osten kann zur dahinter liegenden Erschließungszone geöffnet werden, in die über ein Glasdach Tageslicht aus dem Gartenhof fällt. Somit verfügt die Universität für angewandte Kunst erstmals über einen Raum, in dem etwa die jährlichen Präsentationen ihrer Modeklassen stattfinden können.
Während die historischen Räume von Riepl Kaufmann Bammer Architektur in fast spartanisch anmutender Zurückhaltung für die jeweilige Nutzung ertüchtigt wurden, liegt der gestalterische Schwerpunkt der Anlage deutlich auf ihrer neuen Mitte. Der den Gartenhof flankierenden Querspange sind verglaste Räume zugewiesen, die dazu beitragen, das Atrium zu einem lichten Ort spannender Blickbeziehungen zu machen. Eine Cafeteria im Erdgeschoß und der gläsern zum Atrium orientierte Empfangsbereich der Bibliothek unterstreichen den Stellenwert des kommunikativen Zentrums. Sogar die Lesekabinen hoch oben im weitgehend geschlossenen Betonkranz des Dachgeschoßes schauen aus schmalen, in den Fächer ihrer Wandscheiben geschobenen Fenstern hinunter in den Raum, sodass selbst in der Konzentration auf das eigene Anliegen das inspirierende Ganze gegenwärtig ist.
Ausstellungsarchitektur stellt nicht dar und drängt nicht in den Vordergrund – sie lässt den Ausstellungsstücken Raum. „Die Rückkehr der Legion“: zur Gestaltung der oberösterreichischen Landesausstellung in Enns durch Veit Aschenbrenner und Elisabeth Plank.
Architektur ist nicht dazu da, Geschichten zu erzählen. Weil sie aber unseren Alltag, unsere Träume, die Machtverhältnisse und Wirtschaftsleistungen einer Gesellschaft ebenso widerspiegelt wie deren technische Errungenschaften oder den Stellenwert, der etwa der Kultur eingeräumt wird, können wir Architektur dennoch lesen. Ausstellungsarchitektur macht keine Ausnahme: Sie stellt nicht dar, sie funktioniert. Sie respektiert den Raum, in dem sie sich befindet, setzt ihn jedoch in den Hintergrund. Sie selbst drängt keineswegs nach vorne; denn im Rampenlicht stehen die Exponate. Zu ihnen und an ihnen vorbei müssen die Besucherinnen und Besucher unterschiedlichster Körpergrößen, Interessen und Geschwindigkeiten gelenkt werden, unaufdringlich, sicher und barrierefrei.
Das Wiener Büro Veit Aschenbrenner Architekten hat in Arbeitsgemeinschaft mit der ebenfalls in Wien ansässigen Architektin Elisabeth Plank den Wettbewerb zur Gestaltung der heurigen oberösterreichischen Landesausstellung an deren beiden Schauplätzen in Enns gewonnen. Die Ausstellung nimmt unter dem Titel „Die Rückkehr der Legion“ das Erbe der Römer in Oberösterreich in den Blick. Das am Ennser Stadtplatz gelegene Museum Lauriacum vermittelt einen umfassenden Eindruck des einzigen Militärlagers in der römischen Provinz Noricum. Hier, auf dem Boden der ältesten Stadt Österreichs, war die II. italische Legion mit 6000 Soldaten stationiert; hier lebten die Legionäre mit ihren Familien, gingen außerhalb ihres Dienstes zivilen Beschäftigungen nach; hierher zog es Zuwanderer aus dem gesamten Imperium. In seiner Blütezeit zählte Lauriacum 25.000 Einwohner.
Veit Aschenbrenner und Plank ist es gelungen, die Erzählung vom Leben in dieser spätantiken Stadt den wissenschaftlich seriös aufbereiteten Funden zu überlassen, die von ihrer Ausstellungsarchitektur als thematisch wohl strukturiertes Ganzes zur Geltung gebracht werden. Ein immer wiederkehrendes Motiv dieser Architektur, dunkle metallene Platten, mittels zarter Füße vom Boden abgehoben, schneidet plastisch durchgeformte amorphe Zonen aus den Räumen des ehemaligen Rathauses, ohne dessen unterschiedlichen Bauphasen zu verdecken. Diese Zonen weisen den Besuchern den Weg durch die Ausstellung, laden zum Verweilen ein und animieren zu eigenen Entdeckungen. Insbesondere die Entscheidung, keine Rekonstruktionen zu versuchen, sondern die Fundstücke als Einheit mit allenfalls notwendigen grafischen Ergänzungen zu präsentieren, gibt klar der Fantasie den Vorzug vor allumfassender Animation.
Selbst Aufforderungen wie „Testen Sie in der virtuellen römischen Küche Ihre Fähigkeiten als Küchenchefin der Legion“ haben Veit Aschenbrenner und Plank räumlich korrekt und in Zusammenarbeit mit dem Grafiker Gerald Lohninger gestalterisch ansprechend gelöst. Das thematisch bunte Spektrum der Ausstellung reicht von der Organisation der Legion über das Alltagsleben in der geschäftigen Stadt am Limes bis zu Kunst und Kult der sich ihrem Ende zuneigenden Antike und wird durch wichtige Exponate zur Geschichte von Enns ergänzt. Veit Aschenbrenner und Plank haben die Präsentation von Bereichen wie Waffengattungen, Essgewohnheiten, Bestattungsriten oder Handelsgüter in Lauriacum subtil der jeweiligen Aufgabenstellung und ihrer bestmöglichen Rezeption angepasst, ohne den Faden der Gesamtschau zu verlieren. Handwerkzeuge und technisches Gerät werden in einer Art Baugerüst präsentiert, Skelette liegen auf einer gekiesten Fläche, und der Raum mit der Münzensammlung ruft Erinnerungen an Schatzkisten wach. Besonders wertvolle Exponate werden schon von Weitem sichtbar ins Blickfeld gerückt; Bereiche zum Zuschauen, Zuhören oder Ausruhen farblich und haptisch hervorgehoben. Im obersten Geschoß des Hauses wird noch einmal die Verbindung zum Ort geknüpft: mit zwei kleinen Fenstern, die auf den Ennser Stadtturm schauen.
Am zweiten Schauplatz der Landesausstellung, der Basilika St. Laurenz, wird die Architektur zum Exponat. Umfangreiche Ausgrabungen in der Unterkirche der Basilika haben schon in den 1960er-Jahren spannende Ergebnisse gezeitigt: So konnten die Reste einer repräsentativen, mit hohem Komfort ausgestatteten römischen Stadtvilla und einer in deren Ruinen eingebauten frühchristlichen Kirche freigelegt werden. Mit ihrer anlässlich der Landesausstellung vorgenommenen Neugestaltung der Unterkirche lassen Veit Aschenbrenner und Plank die damals ausgegrabenen Steine sprechen. An dem in den 1960er-Jahren betonierten Boden und der damals unter dem Fußboden der Basilika eingezogenen Betondecke wurde nichts verändert. Auch die Betonbrüstung, die längs des Rundganges durch die Unterkirche die Ausgrabungen schützt, ist nach wie vor an ihrem Ort. Ihr wurden jedoch dunkle Metallplatten vorgesetzt, hinter deren Schutz durchgehende Lichtlinien den Weg ausleuchten, während sorgsam gesetzte Lichtquellen das Mauerwerk zur Geltung bringt. Mithilfe der von Manfred Hintersteiner geplanten Lichtregie kann man bei Führungen die unterschiedlichen Bauphasen des Ortes im wahrsten Sinn des Wortes beleuchten. Dadurch gewinnen sogar die mächtigen Betonunterfangungen der Kirchenpfeiler eine über ihre Funktion hinausweisende Monumentalität.
Veit Aschenbrenner und Plank haben die beiden parallel zur Außenwand der Basilika verlaufenden Wege der Unterkirche mit Vitrinen gesäumt, in denen kostbare Fundstücke ausgestellt sind. Sie nehmen einen räumlich etwas aufgeweiteten Bereich in die Mitte, in dem der vom Statthalter der Provinz Noricum gestiftete Altar und eine steinerne Weihetafel einen prominenten Platz gefunden haben. Auch hier erfüllen die dunklen Metalltafeln den Zweck, eine Schale zu bilden, die der Würde der Exponate Raum verleiht. In der dem heiligen Severin, einer Lichtgestalt der Völkerwanderungszeit, gewidmeten Nische bleibt dieser Raum absichtsvoll leer. Am Ende des Weges stehen auf einer kleinen gekiesten Fläche 40 Lichtstelen beieinander: eine Erinnerung an die 40 Märtyrer, deren Gebeine unter der Basilika St. Laurenz gefunden wurden. Sie sind mit dem Landespatron Oberösterreichs, dem heiligen Florian, für ihren Glauben in den Tod gegangen, nur wenige Jahre bevor den Christen im Römischen Reich die Religionsfreiheit gewährt wurde.
Zweimal Neudeutung eines historischen Bestandes, einmal in einem Wiener Hinterhof, einmal auf einem oberösterreichischen Stadtplatz. „Himmelsfalter“ und. „Badhaus“ von X Architekten oder: Wie man Urlaub einmal ganz anders gestalten kann.
Die Ferienzeit ist da: am Himmel das dicht gewobene Netz des Flugverkehrs, das Schweröl und der Müll der Kreuzfahrtschiffe in den Meeren, auf den Autobahnen der stinkende, lärmende Stau. Wie schön könnte man es doch daheim haben, auf dem eigenen Balkon zum Beispiel. Leider ist nicht jede von einem Geländer umwehrte Platte, die aus einer Fassade kragt, ein Ort, an dem man die Seele baumeln lassen möchte. Doch der „Himmelsfalter“ den die in Linz, Wien und Lambach ansässigen X Architekten in den engen Hof eines Gründerzeithauses in der Wiener Weyringergasse gesetzt haben, bannt Gedanken an Flucht aus dem Alltag und der Stadt mit zauberhafter Leichtigkeit.
X Architekten haben den von der Magistratsabteilung 19, Abteilung für Architektur und Stadtgestaltung, mit einer Teilnahme an der Ausstellung „Gebaut 2017“ ausgezeichneten Balkon gemeinsam mit seinen Nutzern, Kopp Restauratoren, geplant. Er bereichert die dahinterliegende, ebenfalls in Gemeinschaftsplanung zu einem feinen Gefüge aus Erinnerungen und Zukunftsvisionen verdichtete Altbauwohnung mit jenem privaten Luft- und Grünraum, den Quartiere dieser Art schmerzlich vermissen lassen. Denn in der Zeit des großen Immobilienbooms Ende des 19. Jahrhunderts wandte man dem Straßenraum zwar gerne eine repräsentative Fassade zu. Zur Belichtung und Belüftung der Wohnungen mussten allerdings häufig Schächte genügen.
Nun darf und will man die Nachbarn ja durch die Verbesserung der eigenen Situation nicht um die wenigen Sonnenstrahlen bringen, die durch solch eine enge Schlucht in ihre Fenster fallen. Der komplizierte, in Abstimmung mit den Wünschen der Nachbarn gefundene Zuschnitt des Himmelsfalters bildet folglich die Geometrie des Hofes ebenso ab wie die Lichteinfallswinkel zu den daran grenzenden Wohnräumen. Sein mehrfach geknickter Körper ist an seiner dem Hof zugewandten Außenseite mit einer Vielzahl von Dreiecken aus poliertem Edelstahl belegt, die das Haus selbst, vermengt mit Sonne und Himmel, als glänzende Splitter hinunter in die Tiefe spiegeln. Diese schimmernde Haut, von den Helden der Baustelle, den Metalltechnikern Fikret und Feriz Nakicevic, handwerklich vorbildhaft umgesetzt, wird von einer Stahlkonstruktion getragen, deren Einzelteile samt und sonders mit Hilfe einer Seilwinde per Hand an die Einbaustelle in lichter Höhe gebracht werden mussten.
Oben im fünften Stock hat der Falter seine Flügel zu einer bergenden Höhlung geformt, die mit thermobehandeltem Eschenholz ausgekleidet ist. Die Brüstung fasst großzügige Pflanztröge, in denen Blumen, Kräuter und Gemüse gedeihen. Hier, am Tisch oder im Liegestuhl, ist man dem Himmel schon sehr nahe, und auch die eng gestellten Häuser ringsum zeigen sich mit dem von zierlichen Gesimsen gesäumten Auf und Ab ihrer Dächer von ihrer besten Seite.
Das ist alles schön und gut, aber Balkonien ist für Sie keine Option, Sie brauchen Tapetenwechsel? Wie wäre es mit einem Aufenthalt im sogenannten Badhaus im oberösterreichischen Kurort Bad Hall? Die Architektur dieses nur 22 Zimmer fassenden Hotels am Hauptplatz der gepflegten kleinen Stadt im Traunviertel verantworten ebenfalls X Architekten. Auch in diesem Fall handelt es sich um die Neudeutung eines historischen Bestandes; auch hier haben wir es mit plastisch stark durchgeformten, metallumhüllten Körpern zu tun. Den zu Beginn des 19. Jahrhunderts als Bader-, also Ärztehaus genutzten, zum Hauptplatz orientierten Trakt des Hotels haben X Architekten mit Rücksicht auf sein Umfeld sehr behutsam erneuert. Nur wer genau schaut, erkennt in der dreigeschoßigen verputzten Fassade die subtilen Interventionen, die aus einem historischen Gebäude, wie es unzählige ähnliche gibt, ein modernes Haus mit einer langen und spannenden Geschichte gemacht haben.
Am deutlichsten ist die Veränderung an den fünf Gaupen abzulesen, die den Dachraum nutzbar machen und in ihrer unverfälschten Körperhaftigkeit einen Vorgeschmack auf den Neubau geben, der sich in die Tiefe des lang gezogenen Grundstückes erstreckt. Er erhebt sich, dem Typus des Streckhofes entsprechend, anstelle eines aufgrund seines schlechten Erhaltungszustandes abgebrochenen Nebengebäudes. Auf einem knapp an die südöstliche Grundgrenze gerückten Sockelgeschoß, in dem das Restaurant untergebracht ist, erheben sich zwei weitere Geschoße mit Hotelzimmern. Diese wenden dem schmalen Garten eine mehrfach geknickte Fassade zu, die in der stark gefalteten Dachlandschaft darüber ihre Entsprechung findet. Wie kleine, rundum metallen gefasste Häuschen muten die Körper an, die durch ihr Vor- und Zurückspringen kleine, geschützte Außenbereiche vor den Zimmern schaffen. Die gläsern aufgelöste Fassade des ebenfalls zum Garten orientierten Sockelgeschoßes hingegen weitet den Raum nur mit einem Knick in ihrer Längsseite. Daran entlang stellt eine in jeder Hinsicht schräg mit Holz beplankte Bogenkonstruktion einen schützenden Schirm vor den Gästebereich des Restaurants.
Während X Architekten ihren schon oft unter Beweis gestellten Sinn für starke Farbigkeit und haptisch einprägsame Materialität vor allem im Bereich des Neubaues spielen lassen, verkommt dennoch keine der von ihnen geschaffenen räumlichen Überraschungen, kein noch so deutlich gesetzter Akzent oder Kontrast zur Dekoration. Es gibt – und das ist im Bereich des Bauens für Gäste leider eine Rarität - keine Staubfänger, keine Kulissen. Alles hat seinen Platz und seinen Sinn, von der in einem Gehäuse aus gestocktem Beton angeordneten Schauküche über die kreisrunden, gepolsterten Logen bis zum multifunktionalen, zum Hauptplatz hin geöffneten Frühstücksraum, der sich mit Elementen seiner Einrichtung unverblümt aus dem Fundus des Althergebrachten bedient, ohne das Hier und Jetzt herunterzuspielen.
Mit dem hier bewiesenen Respekt vor dem Bewährten lässt sich natürlich auch an der Oberfläche gute Stimmung erzeugen. Viel wichtiger aber ist die seitens X Architekten gezeigte Fähigkeit, das Vorgefundene zu verstehen und daraus zu lernen. Dann gelingen Räume, in denen selbst der in seiner funktionellen und bauphysikalischen Komplexität viel zu oft unterschätzte Alltag eines Hotelbetriebes und einer Gastronomie reibungslos abläuft. Sodass Sie, geehrte Leserin, geschätzter Leser, im Vorgarten des Badhauses unter der Markise sitzend, ungestört ihren Kaffee genießen können. Mit Blick auf den freundlichen Hauptplatz von Bad Hall.
Wenn Entscheidungsträger einer Gemeinde mit den Architekten gemeinsam an der Verbesserung eines Ergebnisses arbeiten, entsteht Gutes. So geschehen in Adlwang, Traunviertel.
Architektur ist überall. Wahrgenommen wird sie allerdings vorzugsweise, wenn sie ohnedies nicht zu übersehen ist: als Monument, als große kulturelle Tat, als Ausdruck eines neuen Geistes, gerne in Kombination mit noch neueren Technologien. Diese Art von Architektur ist zweifellos wichtig. Sie bahnt, nicht selten revolutionär, vormals nicht begangene Wege und findet auf Fragen, die bisher nur leise gestellt worden sind, weithin hörbare Antworten. In den meisten Fällen ist solche Architektur sogar gut für den Tourismus. Nicht weniger wichtig aber sind jene Anlagen, die außer den Nutzern kaum jemand kennt, in denen die Baukunst als Draufgabe entstanden ist. Als jener Mehrwert, der uns daran erinnert, dass Kultur auch im Alltag möglich ist. Das Feuerwehr- und Musikhaus, das die in Steyr ansässigen Hertl Architekten für die Gemeinde Adlwang geplant haben, ist eines dieser Objekte.
Mit Fremdenverkehr hat es ebenfalls, wenn auch nur am Rande, zu tun. Denn die im oberösterreichischen Traunviertel gelegene, beinahe 1800 Einwohner zählende Gemeinde ist seit dem frühen Mittelalter als Marienwallfahrtsort bekannt und konnte in dieser Funktion zeitweilig sogar Mariazell das (Weih)Wasser reichen. Daran hat weder die Reformation etwas geändert noch die Verbote Kaiser Joseph II. und schon gar nicht die Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten. Im Marienmonat Mai schwillt der von der Säkularisierung der vergangenen Jahrzehnte deutlich geschwächte Pilgerstrom immer noch an. Zu Zehntausenden aber kommen die Wallfahrer erst Anfang Oktober nach Adlwang, wenn hier an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden der „Goldene Samstagnächte“ genannte Kirtag stattfindet. Diese mit Marktständen, Festzelten und allen Attraktionen, die je ein Schausteller ersonnen hat, weit in den Raum greifende Institution bietet eine Erklärung für eine Besonderheit Adlwangs: Hier ist sehr viel Platz.
Der Ortskern von Adlwang wird von der Pfarrkirche dominiert, die sich vor einem Abfall des sonst nur mäßig bewegten Geländes im Westen erhebt. Um die Kirche haben sich Gebäude geschart, die in Maßstab und Gestaltung ein dem ländlichen Wallfahrtsort entsprechendes Selbstbewusstsein ausstrahlen. Die im Osten dieser Gruppe liegende Kreuzung der beiden Hauptverkehrsachsen des Ortes ist ein räumlich unbestimmtes Feld, zu dem zwei historische Gehöfte im Süden ein Tor bilden.
Am nördlichen Ende dieses Zentrums steht das neue Feuerwehr- und Musikhaus quer zur Straße, so weit wie möglich an diese herangerückt. In Verbindung mit einem historischen Gebäude auf der gegenüberliegenden Straßenseite schließt es den öffentlichen Raum nun auch im Norden und setzt so ein Zeichen des Zusammenhaltes in der Gemeinde. Das Gebäude ist ja schon in seiner Aufgabenstellung, einigen der zahlreichen, in ihren Zielen und Gepflogenheiten durchaus unterschiedlichen Vereinen Adlwangs einen gemeinsamen Ort zu geben, Bauwerk gewordene Verbundenheit.
Doch nur dank des Gespürs der Hertl Architekten für die Bedürfnisse der einzelnen Nutzergruppen konnte die Anlage als überzeugendes Ganzes gelingen. In diesem Zusammenhang war vor allem die Trennung der Wege ein im Einsatzfall der Feuerwehr wörtlich genommen vitales Anliegen, dem die Ausbildung zweier gleichwertiger Längsseiten entspricht. Ein zweigeschoßiges L-förmiges Gebäude umrahmt im Süden und Osten die als eigenständiger Körper mit Pultdach ausgebildete Fahrzeughalle der Feuerwehr. Die frei gebliebene nordwestliche Ecke der Garage wird durch den Schlauchturm markiert. So können die hinter den gläsernen Toren der Halle stets sichtbaren Fahrzeuge an der Nordseite des Gebäudes ungehindert ausfahren, während die im Obergeschoß des Hauses untergebrachten Musiker – Blasmusik und Chor – an der zum Ortszentrum orientierten Südseite des Hauses ihren Eingang finden. Diese erhält durch zwei dunkel gefärbte horizontale Einschnitte, den Rücksprung des Erdgeschoßes und die von einem Fensterband fortgesetzte Loggia im Obergeschoß, entsprechende Prominenz.
Ein im Rahmen des Kunstbudgets von dem in Steyr ansässigen Grafiker Michael Atteneder entwickelter, in den Verputz eingearbeiteter Schriftzug über dem Eingang weist auf die vielfältige Nutzung des Gebäudes hin. Die einprägsame, der Straße zugewandte Stirnseite des Gebäudes mit dem im Norden aufragenden Schlauchturm und ihrer zum südseitig auskragenden Obergeschoß ansteigenden Dachkante wirkt überdies als Klammer, in der Inhalt und Form zur Deckung gebracht werden.
Die wohldosierte Kraft, mit der das Feuerwehr- und Musikhaus nach außen auftritt, wird durch die klare Ordnung der einzelnen Funktionsbereiche und die disziplinierte Gestaltung der Innenräume ergänzt. Dass Hertl Architekten eine Aufgabe wie diese – Feuerwehrhäuser sind in Oberösterreich mit mindestens ebenso detaillierten Angaben zu Raumprogramm und maximal zulässigen Errichtungskosten reguliert wie Musikheime – in der hier gezeigten Feinheit und Tiefe lösen konnten, ist nicht zuletzt dem Umstand zu verdanken, dass sie als Sieger eines Architekturwettbewerbes mit der Planung beauftragt wurden. So war vom Stadium des Vorentwurfes an ein allgemein akzeptierter Weg zur Umsetzung vorgezeichnet. Einen weiteren wichtigen Beitrag zum Gelingen des Unterfangens leisteten die Nutzer des Hauses, Gemeinde und Vereine. Durch ihre Mitwirkung bei praktisch jeder Baubesprechung konnten sie jene Gestaltungshoheit zurückerobern, die sie schon vor Beginn des Projekts an einen Generalübernehmer abgegeben hatten.
Damit haben sie zugleich einer nachdrücklich gestellten Forderung des für Gemeinden zuständigen oberösterreichischen Landesrates, Max Hiegelsberger, entsprochen: „Bauen heißt gestalten. Gerade in ländlichen Gemeinden können Bauvorhaben ein wichtiges Instrument zur Stärkung der Gemeinschaft sein. Die unmittelbare Betroffenheit der Bürgerinnen und Bürger macht es daher umso notwendiger, Projekte von den ersten Gedanken bis zur Übergabe verantwortungsvoll zu begleiten. Denn Qualität entsteht dort am besten, wo die Entscheidungsträger der Gemeinde mit den Architekturschaffenden gemeinsam an der Optimierung des Ergebnisses arbeiten.“
Der so umrissene Entstehungsprozess eines Projektes mag viel von den Mühen der Ebene erzählen und wenig Spektakuläres verheißen. Doch ist Architektur, die so entsteht, jede Diskussion, jeden Gedanken und jeden Euro öffentlichen Geldes wert. Denn sie setzt Akte der Baukultur, wo man sich vielleicht mit der Erfüllung eines Raumprogramms zufrieden gegeben hätte.
Wenn es um das Glück der Nutzer ihrer Architektur geht, können Gunar Wilhelm und Sandra Gnigler sehr hartnäckig sein. Den Sachzwängen mögen sie sich fügen – sie heben aber sogar dort Qualitäten, wo andere gar nicht suchen.
Sie begehen dieser Tager ihr Fünf-Jahres-Firmenjubiläum: Gunar Wilhelm und Sandra Gnigler, die als harter Kern einer in wechselnden Konstellationen zusammenarbeiten den Gruppe von Absolventinnen und Absolventen der Linzer Kunstuniversität die mia2/Architektur ZT KG gegründet haben. Sie stehen für eine Generation junger Architekten, die den Umgang mit den als zukunftsweisend gepriesenen digitalen Medienund Planungswerkzeugen aus dem Handgelenk beherrschen. Mit der guten alten Frage, was Architekturschaffende eigentlich leisten, sind sie dennoch konfrontiert. Die schier grenzenlose Zugänglichkeit von Information hat es bisher nicht vermocht, das Bewusstsein der breiten Masse über den Mehrwert von Architektur für Individuum und Gemeinschaft zu schärfen.
Ein Blick auf die Arbeit der mia2 kann da weiterhelfen, denn das Spektrum ihrer Themen ist breit. Es reicht vom Städtebau über den Geschoßwohnungsbau, das private Wohnhaus und Räume für die Arbeitswelt bis zum Entwurf kleinster Objekte. Gunar Wilhelm und Sandra Gnigler haben sich mit Wettbewerbsbeiträgen für prominente Bauvorhaben zu Wort gemeldet, sie haben mit knappen Budgets spannende Ausstellungen realisiert, Mediationsräume in leer stehenden Objekten geschaffen, die verfahrenen Planungskarren anderer wieder flottgemacht und sich immer wieder mit Kunst am Bau oder der Gestaltung grafischer Leitsysteme befasst.
Abseits der Trampelpfade
Kein Unterfangen ist zu komplex, um nicht in Angriff genommen, keine Aufgabe zu bescheiden, um nicht mit Gedanken bereichert, kein Kostenrahmen zu eng, um nicht mit maximalem Gewinn für die Nutzer ausgeschöpft zu werden. Und immer geht es um das Denken abseits der Trampelpfade, um eine beharrliche Suche nach Übereinstimmung von Inhalt und Form und nicht zuletzt um die konsequente Sauberkeit der Umsetzung.
Quer gedacht, technologisch experimentell, räumlich großzügig bei sparsamem Umgang mit Geld und anderen Ressourcen: So ließe sich in aller Kürze ein kleines Wohnhaus beschreiben, das mia2 in Steyr-Münichholz geplant haben. Der Bauplatz ist ebenso idyllisch wie herausfordernd. Das von Bäumen dicht bestandene Grundstück fällt schon wenige Meter hinter der erschließenden Siedlungsstraße im Süden jäh zur Enns im Norden ab, wo es überdies regelmäßig von Hochwässern betroffen ist. Ein Wohnhaus üblichen Zuschnittes hätte wohl die gesamte ebene und dauerhaft trockene Fläche der Liegenschaft verbraucht. Um das zu vermeiden, drehten mia2 den rechteckigen Grundriss desHauses kurzerhand um 90 Grad. So steht das zweigeschoßige, aus gutem Grund „Baumhaus“ genannte Gebäude nur zu einem kleinen Teil auf festem Boden und greift über die Geländekante hinaus weit in den bewaldeten Raum. Ein filigran anmutendes Stahlgerüst mit drei hölzernen Plattformen findet sich, einem Hochstand nicht unähnlich, an die nördliche Stirnseite des Hauses geschoben und dient den in den Längswänden verborgenen Trägern als Auflager.
Eine weitere Besonderheit des zur Gänze aus Holz konstruierten Baumhauses ist ebenfalls nicht sichtbar: Auf ausdrücklichen Wunsch des Bauherrn besteht die Dämmung der Gebäudehülle gänzlich aus Stroh. Die Tragkonstruktion aus massiven verleimten Holzelementen prägt die Innenräume mit ihrer Oberfläche aus unbehandelter Weißtanne. Davor hat der Bauherr eigenhändig die Strohpakete aufgeschichtet, die mithilfe einer eigens entwickelten, materialsparendenRückhängung in Position gehalten werden. Eine hinterlüftete horizontale Holzschalung bildet die äußerste Schicht des Wandaufbaus. Der hohe Vorfertigungsgrad der Konstruktion, der Wunsch nach einem Maximuman Eigenleistungen seitens des Bauherrn undvor allem die hundertprozentige, späteren Korrekturen entzogene Sichtbarkeit der Bauelemente im Inneren des Hauses erforderten kompromisslose Planungsgenauigkeit seitens der mia2. Insbesondere die fließenden, sich keineswegs mit der schlichten Stapelung zweier Geschoße begnügenden Raumfolgen konnten nur dank der sorgfältigen Überlegung jeder Kante und jedes Plattenstoßes in der erreichten Qualität gelingen.
Volumen wird im Baumhaus grundsätzlich nicht verschenkt. Das Badezimmer wird zum Flur, die Galerie zum Arbeitszimmer, und selbst im Boden des Stiegenpodestes gibt eine Luke noch Stauraum unter der Stiege frei. Die Raumhöhen korrespondieren mit der Nutzung, die Öffnungen sind so gesetzt, dass Ausblick und Lichteinfall der Intimität des Wohnens keinen Abbruch tun. Der Wald aber bildet einen stets gegenwärtigen, mit Jahreszeit und Witterung wechselnden Hintergrund und bewahrt so in jedem Raum des Hauses jenen besonderen Charakter des Ortes, der für den Bauherrn das wesentliche Motiv des Unterfangens geblieben ist. Die in Planung und Ausführung des Baumhauses gezeigte Fähigkeit der mia2, die Grundstimmung einer Aufgabe zu finden und in Architektur zu fassen, ist wie ihre Bereitwilligkeit, sich ohne Preisgabe des gestalterischen Anspruchs auf die Wünsche der Bauherrschaft einzulassen, in allen Projekten sichtbar, die sie bisher verwirklicht haben.
„Wege zum Glück“ im Nordico
Besonders gut lässt sich das gezielte Erschaffen einer bestimmten Atmosphäre in den Ausstellungsgestaltungen der mia2 nachvollziehen. So haben sie etwa im Vorjahr mit der Architektur und Grafik für die Ausstellung „Wege zum Glück“ im Nordico Stadtmuseum Linz all die Initiativen und Gruppen, die in Linz an einem gelingenden Miteinander basteln, auf berührende Weise porträtiert. Gleichzeitig ist es ihnen mithilfe eines ebenso einfachen wie erfindungsreichen interaktiven Mobiliars gelungen, das Publikum ein Stück dieser Wege zum Glück entlangzuführen.
Wenn es um das Glück der Nutzer ihrer Architektur geht, können Gunar Wilhelm und Sandra Gnigler sehr hartnäckig sein. Den Sachzwängen mögen sie sich fügen, aber am Ende gelingt es ihnen, selbst dort noch Qualitäten zu heben, wo andere sich nicht einmal auf die Suche machen würden. Das ist nicht zuletzt für den sozialen Wohnungsbau eine gute Nachricht.
2008 hat Gunar Wilhelm die Talentförderungsprämie des Landes Oberösterreich erhalten, 2014 Sandra Gnigler. Im Jänner dieses Jahres haben Max Luger und Franz Maul mia2 anlässlich ihrer eigenen Würdigung mit dem Heinrich-Gleißner-Preis für den damit verbundenen Förderpreis nominiert. Ihre Erfolge hindern Wilhelm und Gnigler nicht daran, die Dinge klar zu sehen und deutlich zu benennen: „Der wirtschaftliche Gedanke hat in der heutigen Gesellschaft mehr Gewicht als die räumliche Qualität, egal in welchem Maßstab.“ Das zu ändern sehen sie durchaus als ihre Pflicht.
Pioniere des konstruktiven Holzbaus in Oberösterreich, Streiter für Qualität, Vertreter des Standpunkts, dass die Würde des Menschen auch in Räumen Ausdruck finden muss: zur Verleihung des Heinrich-Gleißner-Preises an das Welser Architekturbüro Luger & Maul.
Wie misst man den Erfolg eines Architekturbüros? An der Häufigkeit der Wettbewerbsgewinne, der Anzahl der realisierten Projekte, der Prominenz der erhaltenen Preise? Das Welser Architekturbüro Luger & Maul wäre unter jedem dieser Gesichtspunkte als erfolgreich einzustufen. Max Luger und Franz Maul können auf zahlreiche Wettbewerbserfolge verweisen und haben mehr als 300 Objekte gebaut, deren hohe Qualität in wichtigen Preisen gewürdigt wurde. Am 10. Jänner wurden Max Luger und Franz Maul mit dem Heinrich-Gleißner-Preis ausgezeichnet. Diese vom Kulturverein Heinrich-Gleißner-Haus jährlich an Künstler aus unterschiedlichen Sparten vergebene Auszeichnung würdigt den Einfluss der Preisträger auf das kulturelle Geschehen Oberösterreichs. Mit der ihrerseits gestellten Frage „Was kann ich für mein Land tun?“ zeigen Max Luger und Franz Maul, dass ihre Vorstellung eines gelungenen Weges nicht an der Türe ihres Ateliers endet.
Seine Wirksamkeit in Oberösterreich hat das seit 28 Jahren bestehende Büro Luger & Maul weder durch die schiere Menge noch durch die beeindruckend breite, von städtebaulichen Großprojekten bis zu vergleichsweise kleinen privaten Wohnobjekten reichende Palette der realisierten Bauaufgaben entfaltet. Auch mit dem Verweis auf die durchgängig hohe Qualität der Arbeiten ist seine Bedeutung für Oberösterreich noch nicht hinreichend erklärt. Max Luger und Franz Maul lassen sich in außergewöhnlicher Tiefe auf ihre Bauvorhaben ein. Ihr Interesse gilt immer der ganzen Aufgabe, wobei sie den Begriff „ganz“ nicht selten wesentlich weiter fassen, als es sich ihre Auftraggeber vorgestellt haben. Sie haben die seltene Gabe, umfassend und genau auf ihr jeweiliges Gegenüber mit seinen Bedürfnissen einzugehen. Das erklärt nicht zuletzt die auf Vertrauen und Zufriedenheit gegründeteTreue ihrer privaten Auftraggeber. Max Lugerund Franz Maul verstehen es, mit Menschen,mit Orten und gleichermaßen mit Traditionen wie mit Zukunftsvisionen „in Resonanz zu gehen“, wie es so schön heißt. Ihre Herkunft aus dem ländlichen Raum Oberösterreichs und ihre dem Architekturstudium vorangestellte handwerkliche Ausbildung verleihen ihnen dabei jenen zusätzlichen Körper, den man für eine gute Resonanz eben braucht – und der gerne als Bodenständigkeit bezeichnet wird.
Ihr Qualitätsbewusstsein, ihr Gefühl für Technologien und Materialien ruht auf dem Fundament des Handwerks und verleiht ihnen die Autorität, Architektur in der ihnen eigenen Logik der Konzepte und Feinheit der Detailgestaltung durchzusetzen. Auf der Basis ihres handwerklichen Könnens und ihrer Fähigkeit zur partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit ausführenden Firmen sind Luger & Maul auch zu Pionieren des konstruktiven Holzbaus in Oberösterreich geworden, was nicht zuletzt an den zahlreichen Auszeichnungen ihrer Bauten mit oberösterreichischen Holzbaupreisen abzulesen ist. Ihre Bereitschaft und das Vermögen, einfach zu denken, zeigen sich allerdings nicht nur in der Entwicklung neuer, wirtschaftlich haltbarer Technologien. Für Max Luger und Franz Maul ist das Einfache keine Pose. Ihre Architektur stellt nicht die Reduktion in den Vordergrund, sondern was erscheint, wenn man Unnötiges weggelassen hat: Licht, Farbe, Stimmung und eine Funktionalität, die auf die gegenwärtigen Bedürfnisse der Nutzer eingeht, ohne der Zukunft Raum zur Entwicklung zu nehmen. Dieser Blick für das Wesentliche und der vertraute Umgang mit Traditionen bei gleichzeitiger Offenheit für Veränderungen befähigen Max Luger und Franz Maul nicht zuletzt zu einem behutsamen wie erfrischenden Umgang mit historischen Gebäuden.
Hier spannt sich ein weiter Bogen vom Welser Rathaus und der mit dem Bauherrenpreis der Zentralvereinigung der Architekten ausgezeichneten Revitalisierung des Minoritenklosters in Wels über die Interventionen im Stift Schlierbach, das Kultur- und Jugendzentrum in Vorchdorf, das Bildungshaus Schloss Buchberg, die Schwimmschule Steyr und die Revitalisierung der Welser Dragonerkaserne bis zur Neugestaltung der Repräsentationsräume der Johannes-Kepler-Universität, um nur einige der Bauten zu nennen, mit denen Luger & Maul Vorbilder in ein allzu häufig von Unwissen, Zaghaftigkeit und starren Fronten geprägtes Umfeld setzten.
Ähnlich kontrovers wie der angemessene Umgang mit dem Baudenkmal wird das richtige Bauen im Landschaftsraum diskutiert. Insbesondere an den Ufern der Salzkammergutseen ist der Blick, den die Naturschutzbehörde auf geplante Bauvorhaben wirft, streng. Doch gerade hier ist es Luger & Maul dank ihrer Verbundenheit mit der Region, ihres hartnäckig verteidigten Qualitätsanspruchs und ihrer durch Rückschläge nicht verminderten Bereitschaft zum Dialog gelungen, zeitgemäße Formen des Bauens in der Landschaft zu finden. Ihre Badehäuser am Attersee beispielsweise verbinden zeitgemäßen Komfort, technische Reife und handwerkliche Perfektion mit tiefer, aus dem Landschaftsbezug gewonnener Emotion. Sie zeigen Auswege aus der von Klischees überladenen Maßstabslosigkeit vieler touristischer Bauten, was auch über Österreichs Grenzen hinaus anerkannt und mit einer Auszeichnung für „Neues Bauen in den Alpen“ gewürdigt wurde.
Seit 1999 geben Max Luger und Franz Maul als Lektoren an der Linzer Kunstuniversität im Rahmen ihrer Hochbauvorlesungen ihr Wissen und ihre Haltung weiter. Sie kämpfen für Qualität, für anständige Abläufe, sie treten für ihre Überzeugungen ein. Sie vertreten den Standpunkt, dass die Würde des Menschen auch in angemessenen Räumen ihren Ausdruck finden kann und muss. Mit den jüngst auf dem Areal des ehemaligen Pferdehospizes der Welser Dragonerkaserne fertiggestellten Wohnhäusern haben Luger & Maul genau das in einem Bereich nachgewiesen, der seit der Einführung neuer Förderrichtlinien für den sozialen Wohnungsbau besonders schwierig geworden ist. Die Wohnhäuser stehen als sechsgeschoßige konstruktive Holzbauten technologisch an der Spitze neuester Entwicklungen. Und sie zeigen mit ihrem klugen Erschließungskonzept, ihrer robusten wie gediegenen Ausführung und der von Sorgfalt und gestalterischem Anspruch getragenen Erscheinung, dass man mit sehr wenig Geld sehr guten Wohnbau machen kann, wenn man denn mit dem Planungsauftrag auch die Überzeugungsarbeit auf sich nimmt.
Leer fallende Gebäude im Ortszentrum, dafür Zersiedlungswucherungen an der Peripherie: ein Problem, dem sich immer öfter lokale Initiativen entgegenstellen. Etwa im Mühlviertler St. Oswald. Das Ergebnis: eine vorbildliche Neugestaltung des Marktplatzes.
Die Gasthäuser finden keine Pächter mehr, der Bäcker, der Fleischer, die Gemischtwarenhändlerin haben längst aufgegeben. Daran, dass es hier einmal einen Friseur gegeben hat, können sich nur mehr die ganz Alten erinnern. Draußen, auf den einst grünen Wiesen aber schreitet die Zersiedelung munter voran. Während Nahversorger sich mit Textilketten und Baumärkten die begehrten Plätze am Kreisverkehr teilen, sterben die Zentren aus. Es scheint, als käme auf zehn, vielleicht 15 schmucke Eigenheime im frisch gewidmeten Wohngebiet ein Haus im alten Ortskern, das hinter blinden Fenstern von der Vergangenheit träumt. Der Aufschwung an der Peripherie und der Leerstand im Inneren sind kommunizierende Gefäße.
Gegen eine Lebensweise, die, von den Verheerungen an Umwelt und Volkswirtschaft abgesehen, für den Einzelnen zermürbende Details wie den täglichen Stau zur Arbeit bereithält, lehnt sich kaum jemand auf. Doch leer fallende Gebäude im Ortszentrum werden seit einiger Zeit von einer immer breiter werdenden Öffentlichkeit als Problem wahrgenommen. Weil die Ruinen eines untergegangenen Gemeinwesens das Bild ländlicher Idylle stören, könnte man da unken. Optimisten würden sagen: weil der Wunsch nach einem guten Leben nicht zuletzt auf sozialen Austausch und auf ein mit anderen Menschen geteiltes Gefühl der Ortsverbundenheit gerichtet ist. Zahlreiche Initiativen und unterschiedlichste Gruppierungen suchen landauf, landab nach Strategien, um dieses Grundbedürfnis in einer sonst weitgehend auf vordergründige Wirtschaftlichkeit und gefühlte Individualität abgestellten Welt zu befriedigen.
Auch in Oberösterreich: In der Marktgemeinde St. Oswald bei Freistadt beispielsweise hat ein äußerst engagierter Verein die Neugestaltung des Marktplatzes als wirksames Instrument zur Rückeroberung der Mitte erkannt. Nach 15 Jahren beharrlichen Einsatzes des „Forums Marktplatz“ haben im Jahr 2009 Elisabeth Lobmaier-Stockinger und Markus Lobmaier – sie betreiben gemeinsam das Architekturbüro Lobmaierstockinger in Linz – den seitens der Gemeinde ausgelobten Wettbewerb zur Platzgestaltung gewonnen. Darauf folgte ein weitere fünf Jahre währender kooperativer Planungsprozess, in dem jede Einzelheit des 2016 fertig gestellten Platzes mit großer Offenheit von Planern und Aktivisten diskutiert und einvernehmlich festgelegt wurde.
Es gehört zu den wichtigsten Qualitäten des gebauten Ergebnisses, dass es trotz der Fülle der behandelten Themen nicht zur gruseligen Leistungsschau guter Ideen geraten ist. Vielmehr haben Lobmaierstockinger gemeinsam mit dem Verkehrsplaner Hans Haller aus Kirchberg den Bestand rigoros von Überflüssigem befreit und so das darin angelegte Gemeinsame und Verbindende sichtbar gemacht. Dieses findet sich vor allem in den zwar bunten, doch nach wie vor stimmig anmutenden Fassadenfolgen zu beiden Seiten des Platzes und dem scheinbar mühelosen Reagieren des Raumes auf die anspruchsvolle Topografie des Mühlviertler Hügellands. Dazu kommt noch die Wahl eines einheitlichen, verschiedensten Situationen angemessenen Belags, sodass sich der neue Marktplatz wie ein ordentlich gefegtes Zimmer präsentiert, das in seiner Dimension und Ausstattung gleichermaßen einladend und robust genug wirkt, es mit Aktivitäten zu füllen.
Eigentlich ist der Marktplatz von St. Oswald eine – relativ steile – Straße, die, von Westen kommend, nach Osten ansteigt und dort vom Marktturm zeichenhaft abgeschlossen wird. Der Platz ist als Begegnungszone und barrierefrei angelegt, was angesichts seiner starken, von allerlei Quergefälle durchzogenen Steigung eine große Herausforderung für die Planung war. Als Belag dient heimischer, aus dem benachbarten Niederösterreich stammender Granit. Das Material des vom oberen Ende des Marktplatzes aus sichtbaren Steinbruchs wäre in seiner stetigen Farbigkeit für das ländliche Umfeld zu gleichförmig gewesen. Immerhin konnte, nicht ohne Kampf, ein Steinimport aus China abgewendet werden. Die durch diese nachhaltige Entscheidung verursachten, nicht unbeträchtlichen Kosten konnte man durch eine sehr einfache Maßnahme in Grenzen halten: So weit das Budget reichte, findet sich der Stein in Streifen von drei Formaten quer zum Straßenverlauf von Platzwand zu Platzwand verlegt. Am oberen und am unteren Ende des Marktplatzes übernimmt kostengünstiger Asphalt, von flachen granitenen Leistensteinen gefasst, diese Funktion.
Das Regenwasser wird in flachen, sorgsam aus Stein gehauenen Rinnen abgeleitet. Sehr wohltuend wirkt der Verzicht auf ein Ausweisen von Parkplätzen in den Oberflächen. Wer jemals an einer Diskussion zu diesem Thema teilgenommen hat, weiß, welche enorme kulturelle Leistung diese Zurückhaltung darstellt. Eine blaue Linie – sie kann eines Tages wohl ohne großen Aufwand entfernt werden – genügt zur Kennzeichnung von Kurzparkzonen.
Auch die Möblierung des Platzes ist zweckmäßig und ansprechend schlicht. Einfache Kandelaber begleiten den Straßenverlauf. Die ursprünglich projektierte Beleuchtung der Fassaden hat sich als zu verhandlungsintensiv für eine Realisierung erwiesen. Den Wunsch des „Forums Marktplatz“ nach einer Begrünung des Platzes haben die Planer mit Hilfe einer Maßnahme erfüllt, die dem abschüssigen Terrain zusätzlich die eine oder andere ebene Fläche abgewinnt: Im oberen Teil des Platzes weisen die Bereiche vor den Hauseingängen kein Quergefälle auf. Den Höhenunterschied zur Fahrbahn überbrücken hier schmale Staudenbeete. Sie werden von steingefassten, mit den Namen der zum Gemeindegebiet gehörenden Ortschaften versehenen Pflanztrögen für kleinkronigen Kugelahorn ergänzt, auf denen hölzerne Sitzbänke montiert sind.
Während der Planungsarbeiten sind die letzten Geschäfte vom Platz verschwunden. Ein Hotel steht leer; ein Gasthaus wird zum Wohnhaus umgedeutet; ein ehemaliger Nahversorger ist noch als Mahnmal zur Bandbreite gestalterischer Fehlentscheidungen zu besichtigen. Doch: Es ist Leben im Zentrum von St. Oswald. Die Häuser sind bewohnt; neue Betriebe ziehen ein; die Vereine bespielen den öffentlichen Raum mit allerlei Festlichkeiten. St. Oswald bei Freistadt zählt zu den glücklichen, den aufstrebenden Gemeinden Oberösterreichs; zumal es seit Kurzem einen Autobahnanschluss hat.
Zum Schauspielhaus Linz
Nach seiner Umwandlung in ein Sprechtheater heißt das ehemals „Große Haus“ an der Linzer Promenade „Schauspielhaus Linz“. Technisch ertüchtigt, bewahrt das Haus seinen Charakter – mit verbessertem Komfort für die Zuschauer.
Häuser sind gebauter Alltag. Jede Generation fügt etwas hinzu oder wirft etwas hinaus. Im Grunde haben wir es überall mit immerwährenden Baustellen zu tun, Fertigstellungstermine ermöglichen nur Momentaufnahmen. Mit dem ehemals „Großen Haus“ des Landestheaters an der Linzer Promenade verhält es sich nicht anders. An seiner Größe hat sich nichts verändert. Doch das nach seiner Generalsanierung seit einigen Wochen wieder bespielte Haus heißt nun „Schauspielhaus Linz“, und sein Auftritt ist gelungen wie schon lange nicht.
Das Wiener Architekturbüro Jabornegg & Palffy hat in Arbeitsgemeinschaft mit dem ebenfalls in Wien ansässigen Büro Vasko und Partner jene Verwandlung des ehemaligen Mehrspartengebäudes geplant, die der 2013 eröffnete Neubau des Musiktheaters am Linzer Volksgarten ermöglicht hat. Die Wahl der Planer erweist sich als Glücksfall, den sich das Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, vertreten durch Richard Deinhammer und die Oberösterreichische Theater und Orchester GmbH unter der kaufmännischen Leitung von Uwe Schmitz-Gielsdorf, jedoch redlich verdient haben. Ein auf Architektur und Denkmalpflege spezialisiertes Büro, Pitz & Hoh aus Berlin, erstellte zunächst eine umfassende Studie zu der über mehr als 200 Jahre gewachsenen Anlage als tragfähige Grundlage zur Diskussion der weiteren Vorgangsweise mit dem Bundesdenkmalamt. Als der Erhalt des Hauses in seiner Grundstruktur und in seinem Erscheinungsbild nach außen feststand, beauftragte man weder mit dem so häufig vorgeschobenen „Bleibt eh alles, wie es war!“ einender üblichen Verdächtigen, noch entschied man das Verhandlungsverfahren für die Generalplanerleistungen über den Angebotspreis. Es war vielmehr der sensible Umgang mit historischer Bausubstanz, der den Ausschlag für Jabornegg & Palffy gab.
Für sie galt es nun, die gesamte Anlage technisch zu ertüchtigen, den Zuschauerraum räumlich und akustisch den Bedingungen eines reinen Sprechtheaters anzupassen und bei dieser Gelegenheit auch den in der Vergangenheit nicht selten schmerzlich vermissten Komfort für das Publikum zu verbessern. Gleichzeitig sollte der Charakter des Hauses bewahrt bleiben, den eine seiner zahlreichen Umformungen in besonderer Weise geprägt hatte: Von 1953 bis 1958 hatte Clemens Holzmeister das Landestheater um die im Norden angrenzenden Kammerspiele erweitert, dem Bestand Pausen- sowie bühnentechnisch genutzte Räume hinzugefügt und ihn von einem Logen- in ein Rangtheater verwandelt.
Diese im Laufe der Jahrzehnte mehrfach überformte Bauphase des Theaters erwies sich angesichts der ebenso gern gestellten wie schwer zu beantwortenden Frage „Was genau ist hier das Denkmal?“ als hilfreicher Anker. Die mit dem Bundesdenkmalamt gefundene Einigung, Holzmeisters einstigen Interventionen das größte Gewicht beizumessen, schuf den soliden Grund, auf den Jabornegg & Palffy ihre Neugestaltung des Schauspielhauses stellen konnten. Denn Holzmeisters kluges, wenngleich durch spätere Entwicklungen stark verstümmeltes städtebauliches Konzept erweist sich als genauso wertbeständig wie die von ihm unter Mitwirkung von regional verwurzelten Künstlerinnen und Künstlern in kräftiger Farbigkeit gestalteten Raumfolgen.
So hat man im Laufe des Planungs- und Bauprozesses vieles weggeräumt, was im Strom der Jahrzehnte an den Rändern der Räume gelandet ist, und vieles ausgegraben, das unter Farbschichten, Wandverkleidungen und in Rumpelkammern die Zeit überdauert hat. Ein neues, schlichtes Vordach beschirmt die Haupteingangszone an der Promenade. Das dahinter liegende Foyer mit dem von Gudrun Baudisch geschaffenen keramischen Deckenornament hat nach dem Entfernen nachträglicher Einbauten ebenso seine Großzügigkeit wiedergewonnen wie die Pausenräume im ersten und im zweiten Stock. Dort bereiten das zweifarbige Parkett, eine ockergelbe und eine pompejanisch-rote Decke, wiedergefundene Beleuchtungskörper, feingliedriges Mobiliar von Anna-Lülja Praun, in Wandnischen gestellte Terrakotta-Figuren von Walter Ritter und die auf Goldgrund gemalten Bilder von Rudolph Kolbitsch die Besucher auf das Erlebnis des Zuschauerraumes vor: roter Boden, zartblaue Wände, Verkleidungen aus Birnenholz, grau tapezierte Stuhlreihen und das in Gold gefasste Deckenfresko von Fritz Fröhlich, in dem sich die Farbigkeit der Räume wiederfindet.
Das Schauspielhaus des Jahres 2017 ist dennoch keine Rekonstruktion eines Werks von Clemens Holzmeister. Vielmehr bildet es die Fähigkeit von Jabornegg & Palffy ab, die Kraft des Vorhandenen zu erkennen und ohne selbstgefällig inszenierte Brüche in neue, heute gültige Zusammenhänge zu setzen. Das gesamte Erdgeschoß des Theaters ist neu organisiert. Der Trakt nördlich des Zuschauerraumes steht nun in unmittelbarer Verbindung zu den Kammerspielen. Die diesen 2009 im Zuge des Tiefgaragenneubaus unter der Promenade zugefügten Garderoben- und WC-Anlagen können nun auch von den Besuchern des Schauspielhauses genutzt werden, so wie der Kartenverkauf mitsamt seinen Büros im nördlichen Foyer des Schauspielhauses beide Häuser bedient.
Der mit Kehlheimer Platten im historischen Format belegte Fußboden fällt, flankiert von einer gläsernen, auf einem Travertinsockel ruhenden Vitrine, vom Niveau des Vestibüls der Kammerspiele in einer flachen Rampe zum Foyer an der Promenade ab. Eine ebenfalls mit Travertin, dem Stein der vorgefundenen Türgewände, belegte Bar schließt den Raum stirnseitig zur Promenade hin ab. Davor schwingt sich die historische Stiege mit ihren roten Steinstufen in die oberen Geschoße. Da sie als Fluchtstiege nicht geeignet ist, haben Jabornegg & Palffy ein nicht minder ungeeignetes Stiegenhaus zwischen dem Schauspielhaus und den Redoutensälen im Süden abgebrochen und durch einen Neubau ersetzt, der zeigt, dass Erschließungsflächen gerne auch räumliche Qualitäten haben dürfen.
Um dem Zuschauerraum diese Qualität zurückzugeben und überdies Sicht- und Hörbedingungen zu schaffen, die eines Landestheaters würdig sind, waren viele Interventionen nötig: vom Wegräumen überholter Akustikeinbauten bis zum Ordnen des Wildwuchses an Bühnentechnik, vom Einbau einer Belüftungsanlage bis zur Neuordnung der Ränge mitsamt Bestuhlung. Die Stühle mögen, unter hohem Aufwand denkmalpflegerisch korrekt restauriert, die alten sein. So bequem ist man in diesem Saal gewiss noch nie gesessen, geschweige denn konnte man dem Geschehen auf der Bühne jemals so gut folgen wie heute.
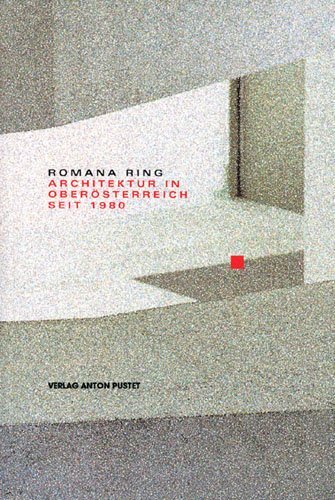
2004
Oberösterreich gilt als Land des Heimatstils – es hat aber auch bemerkenswerte neue Architektur zu bieten Das Land Oberösterreich gilt als dynamischer Wirtschaftsstandort. In seinen kulturellen Ambitionen scheint es jedoch eher der Vergangenheit zugewandt. Dieses Bild vermag der Band „Architektur in
Autor: Romana Ring
Verlag: Verlag Anton Pustet