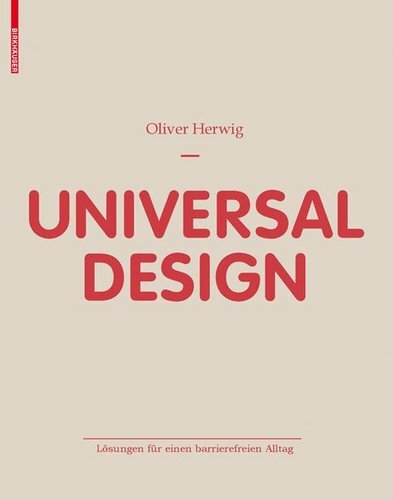Artikel
Adrenalin und Architektur
Höchstleistungen im Stadionbau - eine Ausstellung in München
Sie sind die heimlichen Stars jeder Sportübertragung: die Stadien und Arenen. Rechtzeitig zur Fussball-Weltmeisterschaft 2006, die heute im Münchner Stadion von Herzog & de Meuron eröffnet wird, widmet ihnen das Architekturmuseum der TU München eine Überblicksausstellung.
133 Meter hoch, 7000 Tonnen schwer und 315 Meter überspannend - so lässt sich der Stahlbogen in Zahlen fassen, an dem das neue Wembley National Stadion in London hängt, als wäre es an den Himmel genagelt. Ein gigantomanischer Wurf von Norman Foster für zigtausend Fans, die den Abriss ihres Traditionsstadions nicht verhindern konnten. Eine Arena musste her. Fussball denkt in Übergrössen, verlangt Rekorde nicht nur auf dem Rasen. Im Zeitalter des Sports liefert die Baukunst den Rahmen für menschliche Dramen im Flutlicht. Adrenalin und Architektur heisst die perfekte Verbindung; und Sport erweist sich als das beste Argument für Grossbauten. Die mächtigsten Kuppeln und Dächer krönen Stadien, die gewagtesten Konstruktionen überspannen olympische Hallen. Sport bildet den Motor des bautechnischen Fortschritts. Das war schon im alten Rom so. Damals wie heute sind Sportstätten darüber hinaus Landmarken, die vor Energie bersten. Ihre schwellenden Kuppeln und Schalen sind steroidverdächtig. Die derzeit gefragtesten Architekturbüros beteiligen sich am Wettlauf, dem Spiel ein optisches Signet von Dauer zu verleihen: Einen Auftakt machte Renzo Piano 1990 mit seinem schwingenden Stadion von Bari, und das zeitgenössische Highlight bildet der leuchtende Schwimmgurt von Herzog & de Meuron in München. In diesem Fussballtempel der Superlative findet der Auftakt zur Fussball-Weltmeisterschaft 2006 statt.
Von der Antike bis heute
Mit Blick auf diesen globalen Sportanlass widmet sich das Architekturmuseum der TU München in der Pinakothek der Moderne der Stadienarchitektur. Dabei konzentriert es sich auf bautechnische Höchstleistungen, auf Sportpaläste, die ihrer Ideallinie so sicher folgen, als wären sie verlängerte Linien des Reissbretts: Pier Luigi Nervis Palazzetto dello Sport von 1960 etwa, dessen Betonrippen so elegant zusammenwachsen, als seien sie Teile eines Tiefseeschalentiers. Dazu Eero Saarinens Hockeyhalle in New Haven von 1958, die einem umgekehrten Schiff gleicht - oder das 1999 fertig gestellte NatWest Media Center in London, das Future Systems als gewaltigen Fernseher über den Tribünen der Zuschauer errichteten. Mit Modellen, Skizzen, Fotos und Filmen versucht die Ausstellung die Entwicklungsgeschichte der Sportbauten greifbar zu machen, die Energiezentren des Hochleistungssports als Brutstätten der Architektur festzumachen. Leider ist der Raum dafür zu knapp bemessen - gerade einen Wechselausstellungssaal hat die Pinakothek der Moderne für mehrere tausend Jahre Geschichte frei. Darunter leidet die Darstellung, die so gedrängt durch die Jahrhunderte mäandert, dass die schönsten Modelle um ihre Wirkung gebracht sind.
Der Hexenkessel ist keine Erfindung der Neuzeit. Wenn 220 000 jubelnde Fans das legendäre Maracanã in Rio de Janeiro zum Brodeln bringen, stehen sie in bester Tradition. Die Grundtypen des Spektakels hatte die Antike erfunden: Arena und Stadion. Perfekt hatten Ingenieure das Gewand der Massen geschneidert, mit getrennten Zu- und Abgängen, ausgefeilter Akustik und Sonnensegeln sowie immer neuen, noch spektakuläreren Inszenierungen. «Panem et circenses» - auf diesen Nenner brachte Juvenal die Leidenschaften des römischen Proletariats, das sich an Reiterspielen, Gladiatorenkämpfen und Tierhetzen berauschte. Schon in der Nacht vor den tagesfüllenden Veranstaltungen drängten Schaulustige in die Arenen, um sich die besten Plätze zu sichern. Allein in Rom lockten Veranstaltungen an bis zu 182 Tagen im Jahr jeweils Zehntausende von Besuchern ins Kolosseum. Mehr kamen nur zum Circus maximus. 110 Meter breit und 635 Meter lang, fasste dieses Bauwerk fast 400 000 Schaulustige. Wenn Hermann Tilke jüngst in Schanghai die Rennstrecke mit lotosförmigen Schirmen überwölbte, kann man sehen, was der späte Ableger seinem Urahn, der römischen Circus-Anlage, verdankt.
Spiegel der Gesellschaft
Winfried Nerdinger, Direktor des Münchner Architekturmuseums, zieht doppelt Bilanz. Er zeigt die Historie der Sportstätten als Abfolge bautechnischer Höchstleistungen, präsentiert darüber hinaus Architekturen als Spiegel ihrer jeweiligen Gesellschaft, als Rahmen des von Staat und Bürgern geschätzten Spektakels. Wie haben sich Sport, Staat und Architektur weiterentwickelt? Diese Frage nimmt einen zentralen Teil der Begleittexte und des Katalogs ein. Ebenso die Kritik an der Kommerzialisierung von Sport und Spiel, die sich nicht nur in der immer gebräuchlicher werdenden Mantelnutzung der Stadien durch Einkaufszentren zeigt. Sportarchitektur sei zum Bildzeichen geworden und häufig auch zum Markenzeichen, sagte Nerdinger in einem Interview. Das Entscheidende bleibe: «Wie verpacke ich es, wie bringe ich die Werbung rüber, und genau das liefern die Sportarchitekturen, einen Spiegel unserer totalen Globalisierung.»
Wenn sich moderne Sportstätten in flirrende Medienvorhänge hüllen und Tausende in die Fassade eingelassene Bildschirme die Leistungen der Athleten zeigen, vollzieht sich die letzte Entwicklungsstufe der Sportarchitektur. Das feste Bauwerk löst sich auf, um mit der Dynamik der Sportlerstars zu wetteifern. Das Ende dieser Entwicklung ist nicht in Sicht. Kraft und Geschwindigkeit werden die Zukunft aller Sportbauten prägen, die zum Markenzeichen eines grossen Geschäfts geworden sind, gleich, wo sie stehen.
[ Bis 3. September im Architekturmuseum der TU München in der Pinakothek der Moderne. Katalog: Architektur & Sport. Vom antiken Stadion zur modernen Arena. Hrsg. Architekturmuseum der TU München. Edition Minerva Hermann Farnung, Wolfratshausen 2006 (ISBN 3-938832-09-6). 224 S., Euro 20.-. ]
Quartier im Wandel
Ein neues München auf der Theresienhöhe
Die Theresienwiese liegt da wie ein Bergsee. Jogger drehen ihre Runden, Rabenkrähen krächzen. Nichts erinnert an das bacchantische Vergnügen des Oktoberfests, an Bierschwemmen und Buden. Die Zeit scheint angehalten, das heisst fast. Über den Rand der Festwiese lugen grosse Baukörper. Drei graue Kästen bilden die Avantgarde eines neuen Quartiers westlich der Wiesn. Auf dem Areal der ehemaligen Messe München wächst die Theresienhöhe, 45 Hektaren gross, mit dem markanten Wohnturm des jüngst verstorbenen Münchner Architekten Otto Steidle als Wahrzeichen. - Nach Steidles Masterplan verketten sich auf der Theresienhöhe Wohnen und Arbeiten. Grün soll das Quartier werden, kompakt und zugleich offen für verschiedene Nutzungen und Veränderungen. Steidle ist das Kunststück gelungen, ein bisher in der Stadt-Topographie unsichtbares Gelände einzufangen und völlig neu zu definieren. Dazu hat der Münchner den Leerraum über der Wiesn nicht einfach gefüllt. Bürobauten an den Flanken wirken wie Wellenbrecher, die den Rhythmus der bestehenden Siedlungs- und Gründerzeithäuser aufnehmen und nach innen weitergeben, wo sich das Wohnen in Punktbauten rund um den alten Bavariapark konzentriert.
Am städtebaulichen Wettbewerb im November 1996 nahmen renommierte Architekten und Urbanisten teil: etwa Ortner und Ortner, Hilmer und Sattler, Albert Speer und Partner oder Herman Hertzberger. Ein sorgfältiger Blick auf ihre Arbeiten verdeutlicht die Andersartigkeit von Steidles Handschrift. Da wird kein Quartier mit starren Blockrändern festgezurrt. Steidle entwarf einen vergnügten Tanz der Themen Büronutzung und Wohngebiete. Nichts belebt die Theresienhöhe so sehr wie der Wechsel von geschlossenen Kanten und Wohnpunkthäusern, die Steidle wie Steine eines Schachspiels von Südwest nach Nordost angeordnet hat. Von aussen nach innen lösen sich die Blockränder auf, werden kleinteilig und luftig, damit der Blick bis zum Bavariapark reicht. Freiräume und Perspektiven bilden den elastischen Kitt zwischen Häusern, Hallen und Büros, ein flexibler Raster, der Umbauten, Erweiterungen und Neukonzeptionen locker in sich aufnimmt. Keine Frage: Die Theresienhöhe bildet ein Quartier im Aggregatszustand des Wandels.
Ihr Wahrzeichen dürfte der sonnige, 65 Meter hohe Turm werden, dessen Flanken in Gelb und Orange spielen. Es hätten ruhig noch ein paar Meter mehr sein können, aber Denkmalschützer fürchteten die optische Konkurrenz zur nahen Bavaria. Wie ein Jongleur Keulen lässt der Wohnturm Balkone wirbeln, so dass der Baukörper ständig in Bewegung scheint. Dieses fünfzehn Geschosse hohe, Park Plaza genannte Hochhaus bietet Ersatz für den alten Messeturm. Wer genau hinschaut, erkennt dieselben Rhythmen wie im angrenzenden Bürogebäude; Wohnen und Arbeiten werden optisch eins. Oben wird der Balkon zum Logenplatz über München. Vom Penthouse schweift das Auge über das Westend und die Altstadt bis hinüber nach Sendling. Zu Füssen stehen die alten Messehallen, in die das Deutsche Museum einzog, dann folgen die Bäume des Bavariaparks, der einst verborgen inmitten der Messe stand. Als grünes Herz des Quartiers öffnet er sich heute nach allen Seiten, vor allem aber zu den langgestreckten Wohngebieten der südlichen Theresienwiese. Von hier oben wird schlagartig klar: Da steht kein Viertel aus einem Guss. Steidle entwarf das Quartier nicht als Festkörper, der zwischen zwei bestehenden Vierteln hängt, zwischen Sendling im Süden und dem Westend im Norden, sondern als Scharnier, das Zonen hoher Dichte mit Freiräumen auflockert. 22 Hektaren bleiben unbebaut, fast die Hälfte des Viertels.
Nicht alles wurde fixiert, nicht jedes Detail formuliert. Mit dem grossen städtischen Freiraum der Esplanade nach Westen vertraute Steidle den Wünschen, Träumen und Vorstellungen der Bewohner, die ihr Viertel selbst in die Hand nehmen wollten, mehr als der Kraft seiner städtebaulichen Instrumente. Als Stadtplaner hat Steidle gelernt, sich im entscheidenden Moment zurückzunehmen. Schon vor seinem überraschenden Tod vor vier Monaten (NZZ 2. 3. 04) war die Theresienhöhe untrennbar mit ihm verbunden. Nun wurde sie sein städtebauliches Geschenk an München, die Stadt, in der er lebte.
Aus, vorbei, Schluss
Das grosse Sterben der Architekturzeitschriften
Immer deutlicher bekommen die deutschen Architekturzeitschriften die Auswirkungen der Krise im Baugewerbe zu spüren. Ganze Verlagssparten wechseln den Besitzer, Redaktionen werden ausgedünnt und Magazine eingestellt. Dramatische Einbrüche bei Anzeigen und Auflagen kennzeichnen die Lage der Baufachzeitschriften, und selbst renommierte Nischenblätter wie «Arch+» können sich dem Abwärtstrend nicht entziehen. Einsparungen beeinflussen augenblicklich Ausstattung sowie Umfang der Zeitschriften und bedrohen langfristig ihre journalistische Qualität. Unübersehbar wurde das Siechtum deutscher Architekturzeitschriften in diesem Sommer. Die Umfänge der Hefte schrumpfen, ausscheidende Redaktionsmitglieder werden nicht mehr ersetzt, und Schwerpunktthemen verlieren sich zwischen Meldungen und den immer wichtiger werdenden Produktinformationen.
Mit krisenbedingten 40 Prozent weniger Anzeigen gegenüber dem Vorjahr rechnet Felix Zwoch, Chefredaktor der «bauwelt», für alle architektonischen Fachblätter. Ein halbes Dutzend Monatszeitschriften belauern sich wie angeschlagene Boxer. «Wir warten, bis jemand aus dem Rennen geht», gibt ein Redaktor unumwunden zu, «und hoffen, dass wir nicht die Ersten sind.» Resignation macht sich breit. Im letzten Jahr brachen nicht nur die ohnehin mässigen Werbeeinnahmen teilweise weg, sondern auch die verlegerischen Perspektiven vieler Blätter. Kaum eine Zeitschrift, die nicht schon zum Verkauf stand oder den Besitzer wechselte. Neue Eigentümer verlangen Renditen. Die aber sind schwer zu erzielen. Traumzahlen von bis zu 15 Prozent, wie sie die «bauwelt» zur Zeit der deutschen Wiedervereinigung erwirtschaftete, klingen heute geradezu exotisch. Trotzdem wurde Mitte Mai die gesamte Fachverlagssparte von Bertelsmann-Springer an die Investmenthäuser Cinven und Candover verkauft. Betroffen davon waren auch die Architekturzeitschriften «bauwelt», «DBZ» und «Bundesbaublatt». Eine Milliarde Euro investierten die Briten in die Übernahme. Sie wollen aus BertelsmannSpringer und den bereits für 600 Millionen Euro erworbenen Kluwer Academic Publishers den weltweit zweitgrössten Wissenschaftsverlag schmieden.
Substanzverlust
Als die «bauzeitung» im vergangenen Dezember ihr Erscheinen nach 50 Jahren einstellte, mutmassten Kenner, es würden nun auch anderswo harte Schnitte folgen. Jahr für Jahr verliert allein die «bauwelt» 1000 Leser. Mit diesem lebensbedrohlichen Substanzverlust steht sie nicht allein da. Bei «db» fiel die Zahl der Abonnemente von 34 836 im Jahre 2001 auf 31 160, wovon allein 22 861 Exemplare direkt an die Mitglieder des Bundes deutscher Baumeister, Architekten und Ingenieure gehen. Der Einzelverkauf am Kiosk betrug im Februar nur 284 Stück. Mit «kompetent, kritisch, kontrovers» wirbt die «db» nun um neue Abonnenten. Doch diese hohen Ziele stehen nicht unbedingt im Zentrum der neuen Verlagspolitik. Seit sich die «FAZ» von ihrer Tochter DVA trennte und die Konradin Medien GmbH in Stuttgart das Heft in der Hand hält, kreist der Rotstift. «Keine Begrüssung, keinerlei Gespräch, keine Vision», klagt ein Redaktor. Und Oliver G. Hamm vom «Deutschen Architektenblatt» mutmasst: «Zwar dürfte die ‹db› nicht grundsätzlich zur Disposition gestellt werden, wohl aber ihre personelle und damit auch qualitative Basis.»
Wo Verleger fehlen, werden Zeitschriften zu reinen Objekten im Portfolio. Controller ziehen durch die Redaktionen. Bei den Honoraren, den Reisekosten, der Papier- und Druckqualität - überall lässt sich sparen. Dabei ist langfristig vor allem eines gefährdet: die unabhängige, kritische Berichterstattung. Zeitschriften würden inzwischen direkt am Anzeigenmarkt ausgerichtet, meint ein Experte und beklagt, dass «Werbesprache immer offensichtlicher in redaktionelle Teile» einfliesse. «Da fehlen Journalisten, die das überarbeiten und rausfiltern.» Dass es auch anders geht, beweist die «bauwelt», die ganz auf Produktinformationen verzichtet. Chefredaktor Zwoch beschwört das journalistische Ethos: «Bei uns gibt es keine Vermischung von PR und Redaktion. Firmen kann man das vermitteln, und das verstehen sie auch.» Anzeigenkunden aber drängen weiter in den redaktionellen Teil.
Blühende Monopolisten
Der Markt implodiert. Jeder lauert, bis ein Mitbewerber aus dem Rennen geht. Alternativen zeigen schweizerische und österreichische Fachzeitschriften. «Architektur aktuell» aus Wien trotzt der Krise. «Wir haben so weitergemacht wie immer», sagt Bernd Mandl. «Aufgrund unserer marktbeherrschenden Stellung in Österreich gab es kaum einen Rückgang bei den Anzeigen.» So bleiben Werbung, redaktioneller Teil und Produkteinformationen sauber getrennt, zur Freude der Leser. Ähnlich bei der «Archithese». Die Zürcher Zeitschrift wartete in diesem Jahr mit einem neuen Format und einem neuen Layout auf, grösser und mutiger. Die «Archithese»-Redaktorin Judit Solt meint: «Die letzten Jahre liefen ziemlich gut», und die Anzeigenlage sei gar «nicht so schlecht». Kein Wunder, dass deutsche Kollegen auf schweizerische und österreichische Blätter schielen, die nicht nur über eine sichere Auflage verfügen, sondern auch über ein ungebrochenes verlegerisches Interesse an kritischer und unabhängiger Berichterstattung.
Da keine Zeitschrift in Deutschland über eine marktbeherrschende Stellung verfügt, halten sich Gerüchte, dass die eine oder andere aus dem Markt gehen werde. Nikolas Kuhnert von «Arch+» sieht aber auch ein Problem darin, dass Lesen Arbeit bedeute. Die Zeiten der grossen Theoriedebatten seien vorbei, denn eine ganze Architektengeneration trete ab. «Infos holen sich die Jungen dann, wenn man sie gerade braucht, und zwar bevorzugt aus dem Netz.» Denn auch das Flaggschiff der Theoriedebatte hat Abonnenten verloren. Noch deren 7200 halten «Arch+» die Stange. «Das Jahr 2002 war kein gutes Jahr», schrieb Falk Jaeger in einem seiner letzten Briefe als Chefredaktor der «bauzeitung». Zuerst waren nur die Architekten betroffen. Nun geht es an die Baufachzeitschriften, von denen manche die Krise kaum überstehen werden. Umso wichtiger wäre es daher, dass alle anderen als kritische Stimmen erhalten blieben.
Gestaltung in der Krise
Neue Wege für Architekten und Designer?
Das Leiden am Design kennt viele Formen. Gestalter klagen über den inflationären Gebrauch des Begriffs Design. Studenten stöhnen über orientierungslose Ausbildungsgänge. Und Arbeitgeber sehen beim Nachwuchs noch immer «zu viel Bauhaus und zu wenig vitale Konzepte», zumindest in der jüngsten Studie des Art Director Club Deutschland. Am meisten aber leiden die Verbraucher. Kein Wunder, dass sie Design am liebsten mit zwei Worten umschreiben: ausgefallen und bunt, wie jüngst Ralph Bruder herausfand. Der Gründungspräsident der «design school zollverein» möchte auf dem Areal der Zeche Zollverein Grafik-, Medien- und Industriedesignern eine private Alternative bieten, an der Schnittstelle zwischen Management und Produktentwicklung. Nicht, dass dabei der Design-Manager entstünde, der die Kunst beherrscht, zugleich Kreativprozesse zu steuern und über die Kosten der Gestaltung zu klagen. Bruder will mit seinem Studiengang für Postgraduierte zwei Welten zusammenbringen, die an entgegengesetzten Enden der Produktion stehen. Manager sollen nicht nur Zahlen studieren, sondern auch die Arbeitsweise von Kreativen verstehen, Gestalter aber betriebswirtschaftlich denken lernen. Angesichts hoher Arbeitslosenraten klingt die Idee verlockend.
Um eine Neupositionierung der Kreativen ging es vor wenigen Tagen auch in Ulm - 50 Jahre nach Gründung der Hochschule für Gestaltung (HfG) und 35 Jahre nach ihrem Ende. «Design und Architektur - von der Ausbildung zum Beruf?» lautete der Untertitel der diesjährigen Tagung des Internationalen Forums für Gestaltung. Das Fragezeichen war kein Zufall. Mit Patentlösungen konnte Ulm nicht aufwarten. Dafür wurde immer neu gefragt, was Design sei: Emotionale Formgebung? Leiden und Leidenschaft einer kleinen Gruppe von Starentwerfern? Oder gar eine Krankheit? Die Kampfansage an den staatlichen Lehrbetrieb kam in Ulm freilich nicht gut an. Zu viel Industrienähe argwöhnten Professoren, die sich selbst immer häufiger gezwungen sehen, Forschung über Drittmittel zu finanzieren. Fachhochschulen werben mit Praxisnähe und guten Verbindungen zur Wirtschaft. Dazu kommt der sich verschärfende Kampf um Studenten, international und fachübergreifend. Hier London, da Zürich, Athen oder Barcelona. Antworten auf die einmal ausgemachte Ausbildungsmisere gab es kaum. Die Ulmer Tagung lehrte dennoch einiges: Die gestalterischen Berufe haben sich - zumindest in Deutschland - so weit auseinander entwickelt, dass Architekten und Designer nur mit Mühe zu einer gemeinsamen Sprache finden. So glich die Ulmer Debatte über weite Strecken einer TV-Diskussion, in der jeder Reformvorschlag als Angriff auf Besitzstände erkannt und reflexartig abwehrt wird. Als Gegenmodell dazu bietet sich noch immer die HfG Ulm an: klein und elitär. Doch das liegt weit zurück.
Aufbruch in der Provinz
Neue Architektur aus der Oberpfalz
Wegweisende Architektur wird gerne mit Grossstädten in Verbindung gebracht. Dass aber auch ländliche Gebiete mit Meisterwerken aufwarten können, ist spätestens seit Graubünden und Vorarlberg bekannt. Auch im Nordosten Bayerns tut sich was. Dort schlagen die Architekten Peter und Christian Brückner Brücken zwischen den Welten.
Dem «Behmischen», wie ihn die Leute hier nennen, hält nichts stand. Kein Baum, kein Strauch und auch kein Mensch. Zwei Männer suchen Schutz vor dem Wind, der geradewegs aus Sibirien zu kommen scheint. Die Krägen ihrer Jacken hochgeschlagen, stehen Peter und Christian Brückner vor einem einsamen Bauwerk. Mitten im Nichts, auf der Höhe des Oberpfälzer Waldes, haben sie es im Juni 2000 errichtet. Mit dem Ort der Begegnung wollten sie ein Zeichen setzen. Ein Zeichen des Wandels nach jahrzehntelangem Stillstand im Grenzland zu Tschechien. Neun Meter lang, drei Meter hoch, gefügt aus Granit, Glas und Lärchenholz, Mauerfragment, Skulptur und Schutzhütte in einem. Nicht allzu lange ist es her, als noch der Eiserne Vorhang die Landschaft in hüben und drüben teilte. Aber die alten Gewissheiten gelten nicht mehr. Auch nicht mehr in der Oberpfalz im nordöstlichsten Bayern. Die Grenze verläuft gleich hinter dem Wald. Genau dort wollten sie bauen, an der einstigen Bruchstelle zwischen Ost und West. Das ist nach vielem Hin und Her schliesslich gescheitert. Aber auch auf dem Hügelkamm wirkt das Bauwerk. Geschichtet aus fünf Zentimeter starken Granitplatten, grob gebrochen auf der einen Seite, diamantgesägt auf der anderen, steht es gegen den Wind. Ein schmales Schlupfloch führt hinein. Dort findet man nur einen Stahltisch, kubisch und schwer. Licht bricht durch die Glasstreifen in Wand und Decke und wandert über den Boden. Nach oben nehmen die Glasschichten zu und mit ihnen die Helligkeit. Bis sich der Bau zu entmaterialisieren scheint. Vom Granit, der den Oberpfälzer Wald prägt, bis zu den Glasschichten ein gebautes Manifest der Materialität, eine säkulare Kapelle zwischen den Welten.
Dialog mit dem Ort
Sie kämen oft hierher, sagt Christian Brückner. Manchmal findet der Architekt dann fremde Nachrichten vor oder eine Kerze. Das berühre ihn. Die sonst allgegenwärtigen Kritzeleien und Ritzspuren sucht man vergeblich, Holz und Stein sind zwar verwittert, aber makellos in ihrer von Wind und Regen erzeugten Patina. Die Begegnungsstätte gleicht zwei Händen, die ineinander verhakt einen neutralen Raum schaffen, offen und voraussetzungslos, ein idealer Ort, sich zu verabreden, nachzudenken oder einfach nur dem «Behmischen» zu entkommen. Ringförmig ist das Gras um das Gebäude platt gefahren, Reifenspuren. «Die Jugendlichen hier haben den Treffpunkt für sich entdeckt», sagt Peter Brückner und zeigt über die weite, karge Landschaft. Traditionelles, erdverbundenes Altbayern. Provinz. Doch damit haben Brückner & Brückner kein Problem, im Gegenteil. Sie beziehen ihre Stärke aus dem Ort.
Eigentlich wollten sie Bildhauer werden. Aber unabhängig voneinander entschieden sich die Brüder, Architektur zu studieren und in das Tirschenreuther Büro des Vaters einzutreten. Peter ging an die TU München und hörte unter anderem bei Zumthor, Christian, der um neun Jahre Jüngere, studierte an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart. Seit sechs Jahren arbeiten sie zusammen. Wer ihre Bauten sieht, geschichtete Steine oder fein gesetzte Klinker, ihre authentische Oberfläche, die Materialübergänge oder Fugen, erlebt die Nähe zu gebauten Skulpturen. Wie dort geht es um Volumen, um Masse und Raum. Ihre Architektur wird greifbar. Denn ihr Bauen beginnt mit Modellen, die die Architekten von den Projekten fertigen, im grossen Massstab, handgreiflich direkt und unübersehbar. Mit dieser Strategie hatten die Tirschenreuther in Würzburg Erfolg, als sie 1996 den Wettbewerb um den Kulturspeicher gewannen und ein Lagerhaus von 1904 in ein Meta-Museum verwandelten, eine Plattform für Kabarett, Kunst, Café und Geschäfte gleichermassen. In die Hülle aus Muschelkalk und Sandstein stellten sie harte Betonkisten, Ausstellungsboxen für die Städtische Sammlung und die Kollektion Konkreter Kunst. Dafür wurde das marode Gebälk radikal entfernt. Weiss geschlämmte Wände zeigen das ursprüngliche Mauerwerk, Sichtbeton und Stahl dokumentieren die Einbauten. Das Neue drängt nicht vor, stellt sich aber selbstbewusst neben den Bestand, ergänzt und erweitert ihn. An beiden Enden des über 100 Meter langen Kulturspeichers errichteten die Architekten zwei Kopfbauten aus Glas, umfangen von einer steinernen Jalousie.
Zwischen je zwei Stahlspangen spannten sie massive Steine und drehten sie pro Feld um einige Grad, so dass der schwere Vorhang in Bewegung geriet. Auflösen wollten sie die Fassade nicht, aber auf paradoxe Weise haben sie den Steinen die Schwere genommen und sie in einen Schwebezustand gebracht, der jederzeit wieder umkippen kann: von massiv zu semitransparent und von leicht nach schwer. Auf der Mainseite, an der Industriefront mit ihrem Wippkran und mit Blick auf den Schlot eines Kraftwerks, kehrten sie den Materialkodex um: Glas umgibt hier zwei Betonboxen, die wie Container an der Fassade kleben. Um die zerbrechliche Hülle zumindest optisch der harten Umgebung anzupassen, versahen sie die Glasplatten per Siebdruck mit Gebrauchsspuren.
Für den Umbau des Kulturspeichers im Norden Würzburgs erhielten Brückner & Brückner gerade den Balthasar-Neumann-Preis 2002. Sensible Radikalität bescheinigte ihnen die Jury. Wenn man dies positiv wende, meint Christian Brückner, verpflichte Radikalität «zum konsequenten Umgang mit dem alten Gebäude». Dass man nicht mit aller Kraft versuche, dem Gebäude etwas zu oktroyieren. Als sie zum ersten Mal am Mainufer standen, vor dem Industriedenkmal, fühlten sie sich von dem Ort herausgefordert. Sie spürten, dass schon vieles da war, dass sie «nur noch korrigierend eingreifen» mussten. Christian Brückner weiss: «Wir wollten den Charakter des Ortes beibehalten, ihn ein Stück weit rauskratzen.» Diese Fähigkeit bewiesen die Architekten auch mit zahlreichen Sanierungen und Neubauten in ihrer Heimat.
Oberpfalz, «Stoapfalz», diese Gleichung gilt seit dem Dreissigjährigen Krieg, als Gustav Adolfs Schweden die einst blühende Kulturlandschaft im Nordosten Bayerns in Schutt und Asche legten. Aus dem Ruhrgebiet der frühen Neuzeit mit seiner Eisenerzverarbeitung und seinen Hammerschlösschen wurde eine grosse Brache. Wer es seitdem auf den kargen Böden nördlich der Donau aushielt, musste schon ein rechter Dickschädel sein. Auf der dünnen Verwitterungsschicht über Granit und Flussspat wächst wenig. Die harte Arbeit auf dem Feld hat die Menschen geprägt: reserviert gegenüber Neuem, wortkarg und traditionsverhaftet.
Karge Formen in der Landschaft
So erscheint auch das Wohnhaus eines Forellenzüchters bei Bärnau: verschlossen und unnahbar, wie die Burgen im Umland. Mit Satteldach und steinerner Basis, wie der Grund, auf dem es steht. Aber durch und durch zeitgemäss, als reine Form in der Landschaft, bei der Lärchenholz und Granit eine ganz neue Qualität erhalten. Dabei interpretierten Brückner & Brückner nur eine alte Tradition neu. Wie die Höfe des Umlands setzt das Einfamilienhaus auf eine gemauerte Gründung. Seitlich und darüber folgt, wie ein Winkelhaken, Holz. Dazwischen liegt eine Fuge mit einem Lichtband. Weniger geht kaum mehr. Ein Haus ohne Allüren, aber mit grossem Anspruch gebaut. Und ein Spiegelbild der Landschaft, in der es steht - karg und zurückhaltend, dabei voller Überraschungen. Im Inneren ist nämlich Licht im Überfluss, bis hinauf zum offenen Dachfirst, was den Räumen im Obergeschoss einen Hauch von Grösse und Weite verleiht. Fenster werden zu Aussichtsplattformen, die den Oberpfälzer Wald als gerahmtes Panorama bieten. Oben auf dem Hügel, kaum mehr sichtbar von hier aus, steht der Ort der Begegnung.
Turmbau zu München
Eine neue Stadtkrone für Bayerns Metropole
Mit «Afterhour» wirbt ein Flyer zum Abtanzen nach Geschäftsschluss. Auf dem Papier gleicht München einem Scherenschnitt im Abendlicht, gegliedert nur durch die Türme der Altstadt. Das dürfte sich schnell ändern. Die Landeshauptstadt greift nach den Sternen. In München steht bald nicht nur ein Hochhaus. Fast ein Dutzend von ihnen soll in den nächsten Jahren aus dem Boden wachsen. Vier sind bereits fertiggestellt und verschieben das althergebrachte Stadtbild. In Sichtweite des Hauptbahnhofs steht ein neues Tor aus elliptischem Mercedes-Turm und rundem «Munich City Tower». Den Harras beherrscht das kubische Hochhaus der Fraunhofer Gesellschaft, und im Norden erhebt sich der Büroturm der Münchener Rück über dem Mittleren Ring.
Die Hochhäuser besetzen Lücken im städtischen Gewebe, an Schnellstrassen oder Bahnlinien - und gestalten ganze Quartiere um, indem sie alle Blicke auf sich ziehen. Ihre bis zu 85 Meter hohen Fronten fallen bescheiden aus im Vergleich zu den Projekten, die schon in der Baugrube scharren. 146 Meter misst Christoph Ingenhovens Turm in der Nähe des Olympiastadions, und fast 150 Meter soll dereinst der Büroturm der Süddeutschen Zeitung in den weissblauen Himmel steigen. Wie ein Belagerungsring stehen die Riesen um die Kernstadt. Damit diese neue Stadtkrone möglich wurde, musste viel ideologischer Ballast, der das Höhenwachstum bislang bremste. über Bord geworfen werden. Jahrzehntelang war der Drang nach oben durch zwei Grössen begrenzt, die es nicht zu überschreiten oder zu verstellen galt: die Türme der Frauenkirche und die Silhouette der Alpen.
Hielt sich der BMW-Vierzylinder von 1973 noch an die 100-Meter-Vorgabe der Frauenkirche, so übersprang der ausdrucksstarke Hypoturm von Walter und Bea Betz die sakrale Richtschnur. Mit 114 Metern hält der Bankenriese bislang den Münchner Rekord. Fundament der auf Containment angelegten Hochhauspolitik bildete Detlev Schreibers Studie aus dem Jahre 1977. Der mahnte 1995: Hochhäuser können nur dort entstehen, wo sie «klärend in die morphologische Substanz der Stadt integriert werden.» Höhenwachstum und Verdichtung sollten Hand in Hand gehen, und zwar entlang den bestehenden Ausfallstrassen und Bahnlinien, also zwischen Donnersberger Brücke und München-Pasing sowie im Norden am Georg-Brauchle-Ring und im Osten entlang der Wasserburger Landstrasse. 200 Jahre nach der für den Freistaat so profitablen Säkularisation wird auch Münchens Stadtbild verweltlicht. Die Frauenkirche als Mass aller Dinge hat ausgedient, die neuen Dominanten künden von Investoren und Unternehmen.
Angesichts dieser unübersehbaren Lust an der Selbstdarstellung mutet die jahrelange Hochhausdebatte wie eine Provinzposse an, die nur ein Gutes hat: Die Thesen der «Vierkantklotz»-Gegner können vor Ort überprüft werden. Und da sieht es gar nicht so rosig aus. Corporate Architecture als Kommunikationsplattform fällt manchmal etwas platt aus, blickt man etwa auf den Neubau der Fraunhofer-Gesellschaft. Das kantige Gebäude der Zentralverwaltung wirkt wie ein Relikt aus den achtziger Jahren. Trotz energetischer Doppelfassade bietet er nicht mehr als 17 Geschosse gereihter Langeweile. Ganz anders wirkt der Büroturm im Münchner Norden von Allmann Sattler Wappner: Die fein gegliederte Fassade umhüllt einen eleganten Baukörper, der - als Nachfahr von Mies van der Rohes Seagram-Building - auch am Hudson stehen könnte. Die viel gescholtene Investorenarchitektur zeigt hier ihre beste Seite, ist allerdings dazu verdammt, schon bald im Schatten des ungleich höheren Langenscheidt-Hochhauses gegenüber zu stehen.
Anders als in Frankfurt, wo nach argen Missgriffen in der Summe doch eine Skyline entstand, die über einzelne Geschmacksverirrungen hinwegsehen half, setzt das Münchner Modell auf Solitärtürme, die über das gesamte Stadtgebiet verstreut sind. Damit erhalten sie eine Präsenz und Bedeutung, die ihre Architektur nicht immer einlösen kann. Auf dem Richtfest des 85 Meter hohen «Munich City Tower» sagte Stadtbaurätin Christiane Thalgott, auch wenn sie die Tradition hoch halte, im Zentrum keine Hochhäuser zu bauen, könne man stolz darauf sein, «dass in Sichtweite der Altstadt ein Büroturm entsteht, der zeigt, dass München eine moderne Stadt ist».
In einsamer Höhe
Neue urbanistische Projekte für München
München explodiert. Neue Wohnquartiere sollen den überhitzten Immobilienmarkt beruhigen und Perspektiven eröffnen für eine nachhaltige Stadtentwicklung. Die Szenarien erscheinen eindrücklich. Doch was bieten die Neubaugebiete der Parkstadt Schwabing, der Theresienhöhe und der Messestadt Riem ihren künftigen Bewohnern?
Liebliche Plätze, grosszügige Parks und breite Strassenzüge - so hat sich München in den Köpfen von Millionen Touristen festgesetzt. Stadtplanung klingt da nach einer historischen Aufgabe. Abgeschlossen, abgesichert und unverrückbar für alle Zeiten, denn schliesslich waren hier Titanen am Werk: Klenze, Gärtner, Fischer und Sckell bildeten das geistige Fundament, auf dem München gefahrlos zum Millionendorf wuchs. Damit ist Schluss. Heute platzt das leuchtende Isar-Athen aus allen Nähten. Der Wohnraum wird knapp, die Mieten explodieren, und bei den Immobilienpreisen bewegt sich die Voralpenstadt ohnehin in einsamer Höhe. Wie gerufen kommen da neue Siedlungsprojekte mit wohlklingenden Namen: Parkstadt Schwabing, Messestadt Riem und Theresienhöhe. Ihr Anspruch ist gross. In nur wenigen Jahren sollen sie ehemalige Industrieareale in grüne Wohnquartiere verwandeln und Leerstellen im Gefüge der Stadt füllen. Klug nutzte die Kommune dabei den Drang der Industrie an die Peripherie. Die drei Gebiete im Norden, Osten und im Zentrum Münchens verdeutlichen die Choreographie dieses grossmassstäblichen Stadtumbaus hin zur Medienmetropole.
Charme des Hinterhofs
Den Auftakt machte der neue Flughafen Franz Joseph Strauss. Seine Eröffnung im Mai 1992 hinterliess im stadtnahen Riem ein 556 Hektaren grosses Areal - und die einmalige Chance, das ehemalige Flughafengelände in ein Wohnquartier mit Zukunft zu verwandeln. Sechs Jahre später nahm dort die Neue Messe Riem ihren Betrieb auf und liess ihre einstigen Hallen und Bauten hoch über der Wies'n leer zurück. So gab es auch im Herzen der Stadt plötzlich Raum für ein Wohn- und Dienstleistungsquartier. Mit ähnlichem Ehrgeiz polieren Stadtplaner gerade die Parkstadt Schwabing zu einem modernen Medienstandort auf. Jahrelang versprühte das Gebiet nördlich des Mittleren Rings den Charme eines gigantischen Hinterhofs, einer vergessenen Restfläche voller Gewerbe- und Industriebauten.
Diese negativen Vorgaben reizten André Perret offenbar: «Architektur bedeutet nicht die Addition von Bauformen», erklärt der gebürtige Franzose, sondern «hat mit Kontext zu tun». Und dieser müsse für die Parkstadt Schwabing erst geschaffen werden. Leitlinie seiner Planung wurde Theodor Fischers Erweiterungsplan für München von 1892, mit seinen charakteristischen Vorgärten und Blickachsen zwischen den einzelnen Häusern. Den Verkehr wird Perret nicht wegzaubern können, aber durch Lärmschutzwälle und siebenstöckige Bauten an der Autobahn abschirmen. Von Ost nach West staffelte er die Bebauung immer lockerer und durchgrünter, von grossen Bürobauten hin zu überschaubaren Wohnzeilen. Die entscheidende Verbindung muss nach Süden, nach Schwabing hin erfolgen. Ausgerechnet dort aber endet der zukünftige Petuel-Park, der auf dem Rücken des übertunnelten Mittleren Rings grünen soll. So bleibt eine lärmende Lücke, eine offene Nahtstelle, die einzig vom Tramtrassee überspannt wird. Optisch hingegen rückt Münchens Norden dem Zentrum nahe. Für viele allzu nahe. Entlang der Autobahn entstehen nämlich die Doppeltürme des Münchner Tors II von Helmut Jahn sowie der «Skyline Tower» der Bayerischen Hausbau. 123 bzw. 84 Meter hoch, sind sie als städtebauliche Dominanten noch vom Odeonsplatz aus sichtbar. Nun scheint es, als ob der Konjunktureinbruch auch in München Spuren hinterlässt. Die grosszügig geplante Freifläche im Zentrum der Parkstadt ist beinahe fertig gestellt und wirkt verloren in ihrer Grösse, denn die Randbebauung aus Bürohäusern fehlt.
Riem ist ein Sonderfall. Auf dem ehemaligen Flugplatz sollte, ungestört von historischen Grenzen, etwas völlig Neues entstehen. Der Weg zur Öko-Mustersiedlung scheint vorgezeichnet. Tatsächlich aber eröffnet das Gelände Einblicke in die real existierende Baukultur. Neben überdurchschnittlichen Einzellösungen wie der Feuerwache, der Grundschule und der Kinderkrippe sowie soliden Bürohäusern breiten sich Investorenbauten aus. An vielen Fassaden prallten alle Vorschläge der Beratergruppe ab, die kostenlos, aber weitgehend unverbindlich Ökologie und Qualität bewertet. Die «meisten Bauträger nehmen es ernst, manche nicht so», beschwichtigt Walter Wiesinger vom Referat für Stadtplanung und Bauordnung diplomatisch. Investoren wissen, was der Markt fordert: eine Wohnung mit kompaktem Grundriss zu vertretbaren Kosten.
Architektonische Qualität, Ökologie, Rendite und Urbanität bilden auch in Riem kein magisches Quadrat, sondern versanden im Bermudadreieck gängiger Patentlösungen. Wer sich in Riem einrichten will, lebt in einer infrastrukturellen Einöde. Neben dem internationalen Kongresszentrum fehlt vorerst das Stadtteilzentrum mit eigenen Einkaufsmöglichkeiten. Bis Ende 2003 bleibt das grüne Riem mit seinen kurzen Wegen zwischen Arbeit und Wohnen ein Versprechen. Die eigentlichen Impulse der Stadtplanung dürften sich wohl erst nach der Bundesgartenschau 2005 abzeichnen. Dann sollen sich Landschaft und Wohnen über grosse Grünzüge miteinander verzahnen. Schliesslich wächst hier keine klassische Gartenstadt und auch kein Siedlungsprojekt der Moderne, sondern ein Langzeitexperiment als Antwort auf die ökologischen Herausforderungen von morgen.
Kompakt, urban und grün
Auch die sogenannte Theresienhöhe über der Wies'n kommt ohne städtebauliches Leitbild nicht aus. Kompakt, urban und grün lautet die Trias für das Quartier, in dessen Zentrum der Bavariapark liegt. Erst seit einigen Jahren wieder öffentlich zugänglich, wurde der Park mit seinen alten Kastanien längst zur Attraktion für Spaziergänger und Erholungsuchende. Rundherum will Chefplaner Otto Steidle aus dem Geist des Siedlungsbaus urbane Stadtstrukturen wachsen lassen. Das scheint zu gelingen. Schon jetzt verzahnt sich der Stadtteil Sendling mit dem Westend. Die Randbebauung steht grösstenteils. Es handelt sich dabei vor allem um Bürobauten, die das ehrgeizige Projekt erst finanzieren halfen. Schliesslich musste die Kommune alle Kosten für die neue Infrastruktur und die Abfindung der Messegesellschaft aus dem Verkauf der Grundstücke decken.
Trotz Wirtschaftskrise: Münchens Anziehungskraft ist ungebrochen. Das liegt mit an der vorausschauenden Planungskultur der Kommune, die attraktive und funktionierende Stadträume entstehen liess. Die nach 1945 belächelte Entscheidung, historische Strukturen weitgehend wiederherzustellen, erweist sich längst als grosse Qualität, meinte Stadtbaurätin Christiane Thalgott bei einer Tutzinger Tagung. Der gebürtigen Hamburgerin pflichtete der Schweizer Christoph Vitali sogleich bei. München sei «die einzig ernst zu nehmende Stadt in Deutschland - zumindest was das Stadtbild angeht». Wie aber werden sich die neuen Quartiere darin einfügen? Sieht man von Riem ab, integrieren sich die Entwicklungsgebiete Parkstadt Schwabing und Theresienhöhe dezidiert in das gewachsene München und denken es weiter. Parallel dazu entstehen weitere Siedlungen wie die sogenannte Panzerwiese im Norden und die Bebauung der Bahnanlagen nach Westen hin. Ihr Erfolg wird mit darüber entscheiden, wie sich die Lebensqualität im Ballungsraum München entwickelt. Schliesslich will die Stadt auch hier ihren Spitzenplatz verteidigen.
Vier unter einem Dach
Die Pinakothek der Moderne in München
Pünktlich zum Frühlingsanfang war es soweit: Die vollendete, aber noch nicht bespielte Münchner Pinakothek der Moderne konnte den Auftraggebern übergeben werden. Und für einen Augenblick schienen die Querelen zwischen dem Freistaat Bayern und dem Architekten Stephan Braunfels vergessen. Kultusminister Hans Zehetmair schwärmte gar von neuer kultureller Blüte. Direkt gegenüber der Alten Pinakothek rundet der Neubau das künftige Museumsquartier im Herzen Münchens ab. Zugleich geht die schon hundert Jahre dauernde Suche nach einem geeigneten Ort für die Kunst der Moderne zu Ende. Braunfels' Entwurf vereint auf fast 9500 Quadratmetern Ausstellungsfläche gleich vier bisher getrennte Museen: die Staatsgalerie Moderner Kunst, die Neue Sammlung (Design), das Architekturmuseum sowie die Staatliche Graphische Sammlung. Entsprechend vielschichtig fiel das Raumprogramm aus. Den rechtwinkligen Baukörper durchzieht eine Diagonale, die Stadt und Museumsquartier verbinden soll, aber zusammen mit der zentralen Rotunde für gewaltige Verschneidungen sorgt, die Braunfels in zwei trichterförmigen Prachttreppen aufzufangen suchte. Da verkehrt sich das rigide Programm der reduzierten Geometrien in sein Gegenteil. Beeindruckend hingegen ist die Konsequenz, mit der Braunfels störende Details verschwinden liess und für reine Kunstkuben sorgte. Denn trotz einem vergleichsweise bescheidenen Budget von 121 Millionen Euro blieb der Anspruch gewaltig. Die besten Oberlichtsäle der Welt versprach Braunfels den Münchnern. Tatsächlich fliesst das Tageslicht so weich und gleichmässig über die weissen Wände des Obergeschosses, dass es eine Freude ist. Wie die Ausstellungsmacher dies nutzen werden, wird sich allerdings erst am 13. September zeigen, dem Tag der offiziellen Eröffnung der nun dritten Pinakothek.
Fussballspielen im «Schwimmreifen»
Ein neues Stadion von Herzog & de Meuron für München
Seinen Spitznamen hat es schon: Schwimmreifen heisst das neue Münchner Fussballstadion im Volksmund. Das stört den Wettbewerbssieger Pierre de Meuron «überhaupt nicht». Mit der Entscheidung für das Basler Büro Herzog & de Meuron setzen die beiden Münchner Bundesligavereine auf Innovation. Nach den endlosen Querelen um den Ausbau des ehemaligen Olympiastadions zum Fussball-Hexenkessel, einem Bürgerentscheid und einer ersten Wettbewerbsrunde für ein völlig neues Stadion standen im letzten Herbst zwei vorläufige Sieger fest: von Gerkan, Marg und Partner aus Hamburg sowie Herzog & de Meuron.
Beide Teams sollten ihre Entwürfe nochmals überarbeiten, vor allem aber die Kosten in den Griff bekommen. Schon lange deutete alles auf einen Sieg der Basler hin, deren Entwurf mit einer transluzenten Hülle aufwartet, die sich farbig illuminieren lässt. Beeindruckt von der «magischen Poesie» dieser Arena entschied sich nun eine 15-köpfige Jury für Herzog & de Meuron. Eigentlich gibt es nur Gewinner: Die Stadt erhält ein herausragendes Stadion, und Günter Behnischs Olympiastadion bleibt als Architektur-Ikone erhalten. Das hielt den Verlierer Volkwin Marg nicht von einer Kritik ab. Er beanstandete die Tendenz, «die Hülle vor den Inhalt zu stellen» und «mit Effekten zu spielen». Gerade diese «Inszenierungsarchitektur» (Marg) aber bietet den sinnvollen Gegenpol zu herkömmlichen Ingenieurbauten, die auf Ausstrahlung gänzlich verzichten.
Die Zukunft des Münchner Fussballs wird nun nach der Vorstellung von Herzog & de Meuron in den Farben der Vereine rot und blau leuchten. Das Stadion, für das der TSV 1860 und der FC Bayern nun 280 Millionen Euro aufbringen müssen, wird auf drei Rängen 66 000 Zuschauer fassen und einige nicht unumstrittene VIP-Logen besitzen. Beflügelt von der avantgardistischen Architektur, hat sich ein Versicherungskonzern zum Sponsor und Namensgeber des künftigen Hexenkessels aufgeschwungen und ihm seinen Namen verpasst: «Allianz Arena». Baubeginn ist noch in diesem Jahr. Denn schliesslich soll in dem Stadion im Jahr 2006 das Auftaktspiel der Fussball-WM stattfinden. Dann darf München auch sportlich wieder leuchten.
Zeitgenössische Architektur als Lückenbüsser
Bauliche Erneuerung der Frankenmetropole
Geschichte ist Nürnbergs Kapital. Sie wird verkörpert von Kaiserburg und Christkindlesmarkt. Mit zeitgenössischer Architektur hingegen tut sich die Stadt schwer, auch wenn sie entscheidende Leerstellen füllt. Nun verwandelt Günther Domenig die Nazi-Kongresshalle am ehemaligen Reichsparteitagsgelände in ein Dokumentationszentrum.
Alle Orte haben Geschichte, aber nur wenige verkörpern sie. Dieser Gemeinplatz gilt in besonderem Masse für Nürnberg. Wenn die Frankenmetropole heute eher verschlafen wirkt, liegt dies nicht an ihrer Vergangenheit. In Teilen lebt sie sogar von der Sandsteinromantik des Wiederaufbaus. «Stilrein wiederhergestellt» klebt als Etikett über ihrem Zentrum, das aus zwölf Millionen Kubikmetern Schutt wiedererstand. Ein Phönix aus der Asche ist es dennoch nicht geworden, dazu blieb zu viel historische Substanz auf der Strecke. Oder wurde an den Rand des historischen Gedächtnisses gedrängt, wie das Reichsparteitagsgelände am Grossen Dutzendteich.
Nürnbergs Stadtkrone
Mit so viel Geschichts- und Trümmerlast taten sich die Architekten der Nachkriegsmoderne eher schwer, trotz der Ausnahmeerscheinung Sep Ruf. Ende der vierziger Jahre hatten ihre Vertreter noch strenge Zeilen- und Hochhausbauten propagiert - und die entscheidende Abstimmung im Stadtrat verloren. Eine gemässigtere Gruppe vertrat verschiedene Zonen der Erinnerung. Markante Punkte wie etwa die Mauthalle sollten als historische Rekonstruktion erlebbar werden, Gebäude an wichtigen Plätzen hingegen nur in zeitgemässer Architektursprache entstehen. Kraftvolle Bauten aus dieser Zeit machen sich rar. Noch Anfang der siebziger Jahre war die Altstadt keineswegs komplett saniert. Immer deutlicher zutage tretende Brüche zwischen historischer Substanz, «geretteten Vierteln» und kommerzialisierter Innenstadt riefen schliesslich die «Altstadtfreunde» auf den Plan, einen Verein, der binnen fünf Jahren 5000 Mitglieder zählte und an der langfristigen Sanierung baufälliger Gebäude arbeitete. Heute, da die Arbeit am Zentrum weitgehend abgeschlossen ist, wagt man vorsichtige Modernismen, die sich in den Bestand drängen, etwa Volker Staabs «Neues Museum», das sich zum Publikumsmagneten entwickelte. Im Gegensatz zum Germanischen Nationalmuseum, dessen verschachtelte Struktur durch immer neue An- und Umbauten verschiedenste, oft konkurrierende Architektursprachen aufnahm, gelang dem Berliner Baumeister ein überzeugendes Ganzes.
Indes wird längst an Nürnbergs Stadtkrone gezimmert. Markantestes Beispiel ist ein 400 Millionen Mark teurer Dienstleistungsgigant, der nach Osten hin die Stadtgrenze neu zeichnet. Seit Herbst letzten Jahres erhebt sich auf dem Gelände eines ehemaligen Schrottplatzes der «Business Tower Nürnberg», mit einer Höhe von immerhin 135 Metern Bayerns grösster Büroturm. Seine Symbolik ist mit Händen zu greifen: «Schutz und Sicherheit im Zeichen der Burg», hat sich die Nürnberger Versicherung auf ihre Fahnen geschrieben und dieses Motto in ihrem festungsartigen Verwaltungszentrum wörtlich, allzu wörtlich genommen. Dabei bot das Areal allerhand Entwicklungsmöglichkeiten. Drei Seiten sind von S-Bahn und grossen Ausfallstrassen definiert, aber dieser klaren Begrenzung antwortet das Bürogebäude mit weiterer Abschottung, Kuben, die aus dem Alugeviert ausbrechen, und einer harten, siebengeschossigen Blockkante von 25 Metern. Dem Massstabssprung haben die Wohnbauten der unmittelbaren Umgebung nichts entgegenzusetzen. Sie werden von den herrischen Fronten regelrecht pulverisiert.
Über allem erhebt sich der Rundturm, massiv und schwer, mit seinen begehrten Offices mit Blick zum Wöhrder See und zur Altstadt. Unter dem Business-Tower, im Schutz der Verwaltungsburg, ist der Innenhof als Seenlandschaft gestaltet, die allerdings nur für Werksangehörige zugänglich ist. Die aufgeständerte und Öffnung signalisierende Ostecke des Gevierts weckt falsche Hoffnungen. Sie bietet Einblicke, aber keinen Eintritt. Gemässigt in den Dimensionen wirkt hingegen das «N-Energie»-Haus unweit des Plärrers. Anders als bei seinem Gegenüber aus den fünfziger Jahren, das prominent den Stadtraum gestaltet, liegen die Qualitäten des Neubaus im Inneren. Hinter der gläsernen Doppelfassade entwickelte das junge Kölner Büro Hausmann + Müller ein vielschichtiges Informationsgebäude für Verwaltung und Öffentlichkeit. Besucher betreten eine Hightech-Welt aus Aluminium, Sichtbeton und grauem Naturstein samt Kundencenter und Showroom, ein Haus im Haus, das als mehrstöckiger Kubus in die südliche Front eingestellt ist. Höfe spielen mit Durch- und Einblicken. Das nördliche Geviert um einen quadratischen Wasserhof ist für Mitarbeiter reserviert. Für alle anderen bleibt der Blick in den begrünten Hof.
Ein Keil gegen das Nazi-Kolosseum
Eines der interessantesten Projekte in Nürnbergs Innenstadt wurde im Herbst 2000 abgebaut und wird nun seit Ostern als Schülertreff der Grundschule in Kornburg neu genutzt: Matthias Loebermanns «Experimental-Box», die als Stadtteilinformationszentrum drei Jahre am Celtisplatz, hinter den Gleisanlagen des Nürnberger Hauptbahnhofs, mehr schwebte als stand. Über einem temporär stillgelegten Fahrstreifen ging es per Treppe beziehungsweise Rampe in einen mit innovativen Fassadensystemen voll gestopften Pavillon. Eine Komposition aus Aluminiumlochblechtafeln, Lamellen und transluzenten, wärmedämmenden Glaspaneelen bot sich dem Besucher dar. Nach Ablauf des Nutzungsvertrags mit der Stadt wurde die Box auf einen Tieflader gepackt und in einem Stück nach Nürnberg-Kornburg verfrachtet. Offensichtlich tat man sich schwer, eine richtige Nutzung für den Pavillon zu finden. Die nun gefundene Lösung klingt nach letzter Rettung. Immerhin erhielten nun die Grundschüler von Kornburg ein Stück avancierter Architektur.
Nur wenige verirren sich an den Grossen Dutzendteich, wo die dem römischen Kolosseum nachempfundene Nazi-Kongresshalle steht. Aus dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände wurde wieder der Volksfestplatz, und aus dem Riesenbau ein Abstellplatz für den städtischen Fuhrpark. Das soll sich ändern. Über 50 Jahre nach Kriegsende wird das 18 Millionen Mark teure «Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände» ab November die eher provisorisch untergebrachte Ausstellung «Faszination und Gewalt» in der Zeppelin-Tribüne ersetzen. Architekt Günther Domenig trieb einen gewaltigen Keil aus Stahl und Glas in die steinerne Herrschaftsarchitektur des Dritten Reichs. Ob der Versuch gelingt, die Baumassen der Nationalsozialisten aufzusprengen und Licht in das völkische Dunkel zu bringen, wird sich, wenige Tage vor dem Jahrestag der Reichspogromnacht, zeigen. Im Inneren der Anlage jedenfalls bleibt von dem stählernen Keil, der durch meterdickes Mauerwerk gesägt werden musste, nur eine winzige Spitze hoch über dem Boden, eine Ahnung von Veränderung. Geschichte lässt sich nicht stillstellen und auch nur bedingt ausstellen. Wohl aber bewahren und lebendig halten.
Geschichtete Moderne
Beispiele neuer Architektur in St. Gallen
Die barocke Klosteranlage mit der Stiftsbibliothek und die Erker der Altstadt prägten bis heute das touristische Bild St. Gallens. Doch in den vergangenen Jahren hat das Zentrum der Ostschweiz auch auf dem Gebiet der zeitgenössischen Architektur von sich reden gemacht. Neue Bauten und Projekte zeugen von Aufbruchstimmung.
St. Gallen ist reich an Überraschungen. Wer kurz hinter dem Klosterbezirk und der weltberühmten Stiftsbibliothek in die Mühlenstrasse einbiegt und der Steinach folgt, steigt in die Erdgeschichte hinab. Was einst Meeresboden war, sieht man, verdichtet zu Sandstein, Mergel und Nagelfluh, an den Wänden der Schlucht. Das Buch der Natur scheint lesbar. Auch St. Gallens Architekturentwicklung zeigt eine ähnliche Struktur. Klassizismus, Jugendstil, klassische Moderne und zeitgenössische Baukunst sind nicht blosses Sediment, sondern konzentriert erlebbar. Als Gravitationskern wirkt freilich immer noch das Kloster. Doppeltürmig erhebt sich die Kathedrale, eine spätbarocke Kirchenfront mit hervorquellendem Chor.
Streben nach Qualität
Gegenüber den engen Gassen und den vielen Erkern verkörpert der Klosterbezirk einen Massstabssprung. So als hätten seine Baumeister eine sakrale Gegenwelt schaffen wollen. Heute verbinden geradezu minimalistische Eingriffe das Alte mit einer ästhetischen Spätmoderne. Direkt neben dem Karlstor hat Santiago Calatrava St. Gallens Historie in die Gegenwart verlängert. Der Pfalzkeller sowie die kantonale Alarm- und Meldezentrale (1988-98) sind als futuristische Raumerlebnisse gestaltet. Von aussen geben sich die Bauten betont zurückhaltend. Die Linienführung des zwölf Meter hohen Glasdachs der Alarm- und Meldezentrale ist nur als Rückgrat auszumachen. Noch dramatischer ist der Kontrast zwischen Innen und Aussen beim Pfalzkeller, dessen Eingang von einer beweglichen Metallstruktur überspannt wird. In geschlossenem Zustand ist sie begehbarer Teil des Platzes. Darunter, dem Blick verborgen, liegt der Pfalzkeller.
Bauten wie diese nimmt Martin Hitz, der junge Stadtbaumeister von St. Gallen, lächelnd hin. Doch lieber als spektakuläre Solitäre von Stararchitekten sind ihm stimmige Ensembles. Und dies nicht nur bei städtischen Liegenschaften, die in den letzten Jahren auf Vordermann gebracht wurden. «Die Qualität des Bauens insgesamt zu sichern und zu heben», ist für Hitz, der selbständiger Architekt war, bevor er die Aufgabe des Stadtbaumeisters übernahm, wichtigstes Anliegen. Ganz gleich, ob es sich um die Sanierung eines Schulhauses von Johann Christoph Kunkler handelt, bei der Fenster nach alten Massen in Kleinserie ergänzt werden, oder um den Neubau einer Primarschule, die mit hochwertigen Details ausgestattet wurde. Qualität lautet die Devise.
Vom Hochbauamt in der Neugasse sind es nur wenige Schritte zur St. Galler Kulturmeile. Dazwischen liegt Calatravas Wartehalle auf dem Bohl, ein weisser Stahl-Druckbogenträger mit eingehängtem Glasdach. Tonhalle und Stadttheater flankieren den Beginn der Museumstrasse. Wie bei einer Figura serpentinata schrauben sich die Volumina des Stadttheaters in die Höhe - Sechsecke, die eine skulptural geformte Gebäudemasse entstehen lassen. Dieser Theaterbau entstand 1964-68 nach Plänen des Zürcher Architekten Claude Paillard. Heute verkörpert er den Geist der sechziger Jahre in Reinform, auch wenn er durch eine allzu forsche Sanierung etwas von seinem ursprünglichen Charakter eingebüsst hat. Unmittelbar daneben ein Highlight St. Gallens: das Natur- und Kunstmuseum, 1877 von Johann Christoph Kunkler errichtet und 1987 - nach Jahren des Verfalls - von Marcel Ferrier erneuert und ausgebaut. Durch die damals unterlassene Ausgliederung des naturhistorischen Bereichs erwies sich das Haus von Anfang an als zu klein für die Sammlung und den Ausstellungsbetrieb der Kunstabteilung. Nun soll eine Erweiterung durch einen östlich des Museums zu placierenden Solitär, für den demnächst ein Wettbewerb mit internationaler Beteiligung ausgeschrieben werden soll, der Raumnot Abhilfe schaffen.
Anders als Kunklers Stadttheater auf dem Bohl, das 1857 mit «Don Giovanni» festlich eröffnet und 1971 abgerissen wurde, oder dessen gleichfalls abgebrochenes «Helvetia»-Verwaltungsgebäude hatte dieses Werk Bestand. Als 1974 ein Abbruchgesuch vorlag, erkannte man die Bedeutung des Bauwerks und behielt sich Renovierung und spätere Nutzung vor. Das von Klenzes Alter Pinakothek in München inspirierte Museum zeigt den gebürtigen St. Galler auf dem Höhepunkt seiner Kunst. Die Raumfolgen sind unprätentiös und zwingend, die Fassade differenziert: Während Kunkler das Sockelgeschoss für die Naturaliensammlung vergleichsweise zurückhaltend gestaltete, ist das für die Kunstsammlung reservierte Obergeschoss reich gegliedert. Natur und Kunst, hier haben sie sich gefunden.
«Restaurieren ist nicht blosses Verehren des Denkmals, sondern eine kritische Neuprojektierung, das Sichtbarmachen der massgeblichen Komponenten seiner Architektur», erklärt Marcel Ferrier. Und er hat sich bei der Erneuerung des Museums an diese Maxime gehalten: Kunklers Bau schrieb er ganz rationalistisch einen Kreis ein, als tragende Elementarform, auf der das Museum ruht. Sichtbeton und archaisch-massive Säulen tragen den Bau. Eine Treppe führt ins Naturkundemuseum im Untergeschoss, das sich im gläsernen Rundbogen zum Park öffnet. Diesem sichtbaren Kreis zugeordnet ist ein unsichtbares, auf die Spitze gestelltes Quadrat, das versenkte Magazin. Es liegt genau zwischen dem Natur- und Kunstmuseum und dem östlich angrenzenden historischen Museum, nur gekennzeichnet durch einen Backsteinkamin. Alt und Neu durchdringen sich in Ferriers Entwurf. Diese Koexistenz «ist auch massgebend für den Umgang mit der Stadt, wenn man selbst den Neubau als Erweiterung oder Modifikation des bestehenden Stadtkörpers betrachtet», meint Ferrier.
Neue Schichten im Stadtgefüge
In den letzten Jahren erlebte St. Gallen den Bau mehrerer bedeutender Gebäude. Vier Projekte seien exemplarisch genannt: das Gebäude der Empa (Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt) im Stadtteil Bruggen, der an die Altstadt anschliessende Raiffeisen-Komplex, die zu Ausstellungszwecken umgebaute Lokremise auf dem Areal des Hauptbahnhofs und die Olmahalle 9 im Osten des Stadtzentrums. All diese Bauten setzen eigene Schwerpunkte. Präzision, eine Tugend der Empa, verkörpert Theo Hotz' Entwurf bereits im äusseren Erscheinungsbild. Die einzelnen Baukörper sind klar akzentuiert und in eine glänzende Hülle aus Aluminium, Chromstahl und Glas gekleidet. 1996 erhielt der Zürcher Architekt dafür den begehrten Constructec-Preis.
Ganz anders war die Ausgangslage für die von Bruno Clerici und Paul Knill 1987 geplanten und vor zwei Jahren vollendeten Verwaltungsgebäude der Raiffeisenbankgruppe. Die beiden St. Galler Architekten hatten Zwänge der Topographie und Stadtplanung gleichermassen mitzubedenken. Ihr Raiffeisen-Zentrum vermittelt zwischen City und Bernegghang. Clerici und Knill entwarfen dazu eine stark urbanistisch gedachte Abfolge von Baukörpern mit markanten Ecklösungen. In der Gartenstrasse ist das ansteigende Gelände am aufgeständerten Bürowinkel direkt abzulesen. Über den kraftvoll ausgreifenden Arkaden entwickelten die Architekten eine gut proportionierte Fassade, deren Leichtigkeit dem monumentalen Unterbau Paroli bietet. Auch die anderen Blickachsen wurden architektonisch aufgewertet: Wie ein Schiffsbug teilt das elliptische Ausbildungszentrum die Verkehrsströme von Schochen- und Wassergasse, während zum Bankenviertel hin ein frei stehender Turm den winkelförmigen Baukörper abschliesst. Wer sich vom Innenhof seiner geschwungenen Betonfassade nähert, fühlt sich an Tadao Ando erinnert, so klar ist die Materialwahl.
Der Raiffeisen-Komplex wuchs in zwei Etappen. Denn erst nachdem der Städtische Werkhof ausgelagert war, konnten die Architekten mit der Front an der Gartenstrasse beginnen. Zehn Jahre waren seit den ersten Planungen vergangen. Während dieser Zeit wurde die Fassade mehrfach umgeplant und die Haustechnik auf den neuesten Stand gebracht. Das Warten hat sich gelohnt; heute wirkt der Komplex frisch im Gefüge St. Gallens. Inzwischen arbeitet Bruno Clerici bereits an einem Erweiterungsbau für die Raiffeisenbank in unmittelbarer Nachbarschaft zur architekturhistorisch bedeutenden Synagoge von Chiodera und Tschudy. Der abstrakte, allein durch Fensterachsen rhythmisierte Kubus nimmt in seiner Farbigkeit bewusst Bezug auf den orientalisierenden Fassadenschmuck des Gotteshauses. Dem Büro Clerici bescherte der Raiffeisen-Erfolg weitere Aufträge. Bereits vollendet ist inzwischen das minimalistisch anmutende Swisscom-Gebäude an der Wassergasse; und für den modisch «St. Gallen West» genannten Stadtteil Winkeln planen sie zurzeit ein multifunktionales Fussballstadion.
Ein Museum im Baudenkmal
Weniger sichtbar, doch ebenso konsequent hat sich die ehemalige Lokremise zum Museum gewandelt, in dem die Zürcher Sammlung Hauser & Wirth mit ihren reichen Beständen an moderner und zeitgenössischer Kunst für die nächsten zehn Jahre einen festen Platz gefunden hat. Für den betont zurückhaltenden Umbau verantwortlich waren Karlpeter Trunz und Hansruedi Wirth aus Henau. Anschliessend entwickelten die flämischen Architekten Paul Robbrecht und Hilde Daem, die mit ihrem Documenta-Provisorium in der Kasseler Karlsaue international bekannt wurden, im Juli 2000 die eigentliche Ausstellungsarchitektur. Auch sie liessen den spröden Charme der einstigen Werkhalle weitgehend unberührt. Über den mit Kies verfüllten Arbeitsgruben und dem Boden aus 330 000 Eschenholzklötzchen der ersten Umbauphase entstanden drei «Cluster»: Raumfolgen mit je eigenen Blickachsen und Situationen, die zunächst unbespielbar anmuten, doch für «manche Arbeit wie geschaffen scheinen». Die Einbauten sollten das gewaltige Vierfünftelrund «musealer, kleiner machen».
Das ist zweifellos gelungen, auch wenn man der verloren gegangenen Weite nachtrauern mag, denn 3300 Quadratmeter ohne innere Begrenzung wären zur steten Herausforderung an die Kuratoren geworden. Über dem Museumscafé entstand so eine zweite, fast schon intim zu nennende Ebene von 280 Quadratmetern Ausstellungsfläche. Dass die Flamen der radialen Grundform der Lokremise einen eigenen Rhythmus entgegensetzten, der sich wider die baulichen Vorgaben stemmt, ist gewöhnungsbedürftig, führt aber zu teils faszinierenden, teils überraschenden Raumfolgen. Wesentlich zurückhaltender verfuhren Trunz & Wirth, als sie für Büros und Bibliothek des abgetrennten Verwaltungsbereichs Elementarformen, Boxen und Kreissegmente, wählten. Sie sind, im Gegensatz zum Ausstellungsbereich, beheizt. Die schlechte Wärmedämmung der alten Mauern macht es nötig, die Ausstellungsräume im Winter zu schliessen. Dies ist das einzige Manko dieses eindrücklichen Gebäudes.
Im Jahr 1999 entstand das neue Wahrzeichen von St. Gallens Traditionsmesse Olma. Im Wettbewerb um den Neubau der Halle 9 wusste das Büro von Marie-Claude Bétrix und Eraldo Consolascio aus Erlenbach trotz starker Konkurrenz aus der Region zu überzeugen. Ihr Entwurf zeigt wechselnde Gesichter: Da ist der Monolith, mit 10 000 Quadratmetern Dachfläche und gewaltigen Tragwerken, die als Säulenreihe plastisch nach aussen treten. Und da ist ein höchst komplexes Bauwerk mit differenzierten Raumfolgen, gestapelten Boxen, voller Freiräume und Durchbrüche, als wäre ein Bildhauer am Werk gewesen. Dabei musste alles schnell gehen: Am 14. April 1998 fasste der Verwaltungsrat den Baubeschluss, und bereits am 4. Juni 1998 erfolgte die Grundsteinlegung. Rechtzeitig zur vorletzten Olma wurde der Riesenbau fertiggestellt. Der ungeheure Druck hat ein furioses Gebäude hervorgebracht, eine markante architektonische Schicht im sich wandelnden St. Gallen.
Baumeister des Bundes
Günter Behnisch und die deutsche Demokratie
Günter Behnisch zählt zu den bekanntesten deutschen Architekten. Wie kaum ein anderer Baumeister gestaltete der heute 78-Jährige die Symbole der alten Bundesrepublik: das Münchner Olympiastadion - Zeichen der «heiteren Spiele» - sowie das gläserne Parlament in Bonn. Beide Bauwerke sind von der Kommerzialisierung bedroht.
«Wir wollen mehr Demokratie wagen.» Dieser Satz von Willy Brandt gilt auch für Günter Behnisch. Doch wenn der 78-jährige Architekt über den Umbau des Münchner Olympiastadions spricht, schwingt Erschöpfung mit in der Stimme. Die auf 400 Million Mark geschätzte Baumassnahme sei architektonisch möglich, aber darüber dürfe das Symbol der Olympischen Spiele nicht verloren gehen. Genau hier liegt das Problem. Nicht nur für den Architekten, sondern für eine ganze Stadt, die ihren Vorzeigebau für die anstehende Fussball-WM radikal erneuern will. Ist es ein Sakrileg, die wenigen grossen Zeichen der alten Bundesrepublik zu verändern? Oder lebt ein Denkmal nur dann, wenn es sich wandelt?
Die Frontlinien der Diskussion um Münchens Olympiastadion sind nicht klar auszumachen. Keineswegs stehen sich Traditionalisten und Progressive, Denkmalschützer und Fussballfans klar gegenüber. Ein Volksbegehren versucht die Entscheidung für einen Umbau zu kippen. Der Ausgang ist ungewiss. Seit im Oktober 1995 Fussballkaiser Beckenbauer das damals 23 Jahre alte Stadion verbal zum Abbruch freigab, wurden zahllose Expertenrunden abgehalten. Drei Umbauvarianten bestimmten bisher die Debatten: «Ring-», «Schüssel-» und «Konsensmodell». Doch selbst Letzteres ist seit dem 6. Dezember nur noch Makulatur. Da erklärte ausgerechnet Manfred Sabatke, Partner im Stuttgarter Architekturbüro Behnisch: «Wir können den Kritiken am sogenannten Konsensmodell nicht in allen Punkten widersprechen.» Diese Äusserung brachte die ohnehin angespannte Situation zur Explosion. Von einer «Bombe» sprachen Lokalpolitiker; das Konsensmodell sei nun «erledigt». Doch welchen Wert besitzt ein «Konsensmodell», zu dem die Bürger noch gar nicht befragt wurden?
Wichtiger als der Aspekt der ästhetischen und technischen Probleme ist für Behnisch die Frage, ob das Stadion künftig «eine Geldmaschine wird oder wenigstens noch ein bisschen von der freiheitlichen, offenen Anlage bleibt», die es einmal war. Behnisch hätte die Mittel, einen Umbau zu verhindern. Doch beim Hinweis auf sein Urheberrecht winkt er ab: «Das ist nicht dazu da, dass man Bauherrschaften zwingt, irgendetwas anders zu machen.» Im Übrigen sei es nicht Aufgabe der Architekten, «die Politik davon abzuhalten, das Stadion zu aktualisieren». Auch wenn Behnisch den Ball an die Politiker zurückspielt, bleibt er mit in der Verantwortung für sein Lebenswerk. Fast dreissig Jahre nach den «heiteren Spielen» von 1972 ist den politisch Verantwortlichen das Lachen vergangen. Nach wie vor steht Behnisch bereit zum Umbau, um wenigstens dafür zu sorgen, «dass keine allzu grossen Dummheiten passieren», auch wenn es ihm bei diesem Gedanken nicht wohl zu sein scheint.
Transparenz und Demokratie
Schon Anfang der siebziger Jahre hatte das Büro Behnisch einen der vier ersten Preise erhalten für die Umgestaltung des Regierungsprovisoriums in Bonn. Der gebürtige Sachse gruppierte die Bundesbauten als ringförmige Bürokomplexe rund um das Abgeordnetenhochhaus «Langer Eugen». Wie bei seinem Münchner Geniestreich flutete Landschaft in und um den Komplex. Behnisch hatte «Situationsarchitektur» im Sinn: «Das Ziel ist nicht das Haus, das Gebäude, sondern die zu schaffende Situation», erklärte er damals. Diese gelte es «zu verdeutlichen, zu verstärken, zu erhöhen oder, in weniger glücklichen Fällen: neu zu schaffen».
Kulminationspunkt der Parkanlage war das Parlament: kreisrund, eine Art moderner Tafelrunde, wo die Parlamentarier wenn nicht als Brüder, so doch als Gleichberechtigte zusammenkommen sollten. Aber erst zwei Jahrzehnte später wurde die Vision Wirklichkeit. 1992 sorgte der gläserne Bundestag für Furore. Und für einen Streit um das richtige, das angemessene Bauen für die Demokratie. Die einfache Formel «Glas gleich Transparenz gleich Demokratie», die in der Debatte oft zu hören war, hält auch Behnisch für zu kurz gegriffen. Dennoch gehört gerade der transparente Bonner Bundestag, der Einblicke nach innen gewährt und Sichtachsen nach aussen schafft, zu seinen grossen Arbeiten. «Das hat uns viel bedeutet, und wir haben versucht, das Wesentliche der Demokratie in Architektur zu übertragen», meint Behnisch, der mit der neuen Nutzung des Bonner Bundestags als kommerzielle Kongresshalle seine Probleme hat. Denn am 1. November 1999 übernahm das «Maritim Bonn» durch einen Pacht- und Managementvertrag die Bewirtschaftung des Saals. Ein wohl einmaliger Fall. Was bedeutet es, wenn Parlamentsgebäude profaniert werden? «Sie werden noch eine Zeit ihren symbolischen Wert behalten, vor allem da sie gut dokumentiert sind», meint zumindest der Baumeister. Und dann? Werte lassen sich Gebäuden nicht einfach zuschreiben, und doch verkörpern sie ihre Zeit erstaunlich präzise.
Es ist viel geschehen im letzten Jahrzehnt. Die Mitte der Republik ist geographisch nach Osten gewandert. Im märkischen Sand Berlins stehen die Symbole des neuen Deutschland: Axel Schultes' kraftmeierisches Kanzleramt, das allmählich der Vollendung entgegengeht, und Norman Fosters kühl gestalteter Reichstag. Ende Oktober kam ein weiteres monumentales Zeichen hinzu, Eduardo Chillidas 90 Tonnen schwere Stahlplastik «Berlin», welche die Nachfolge von Henry Moores «Large Forms» antrat. Das Modell einer bescheidenen, betont supranationalen Wacht am Rhein, Adenauers Erbe, das erst auf dem Höhepunkt des Wirtschaftswunders nach Repräsentation jenseits des Provisorischen suchte, ist in der grossen Geste nicht mehr zu erkennen.
Offenheit und Vielschichtigkeit
Berlin und Behnisch, das ist eine durchaus reizvolle Kombination. Für den Wahl-Stuttgarter aber auch eine heikle, «weil die Bauverwaltung versucht hat, Tradition aus dem preussischen Bauen heraus weiterzuführen». Und rasch fügt Behnisch hinzu: «Nach unserer Geschichte geht das gar nicht mehr. Deshalb haben wir uns als Büro geweigert, diese Stein-Architektur zu machen.» Die Akademie der Künste Berlin-Brandenburg am Pariser Platz setzt dem Berliner Steinkult ein Spiel sich überlagernder Ebenen entgegen, die von einem geradezu exzessiven Glasanteil ins rechte Licht gesetzt werden. Die steinerne Stadt der dreissiger Jahre, die nun weitergeschrieben wird, ist für Behnisch eine Schreckensvision. Und wieder taucht der Münchner Olympiapark auf, nicht als Gegenmodell zur Urbanität, sondern als Zeichen eines Miteinanders von Grün und Landschaft, einer Offenheit, die viele seiner Bauten auszeichnet.
Offenheit und Vielschichtigkeit sind geradezu Voraussetzungen für Behnisch, der bisweilen eher «als Kritiker und Manager» denn als Planer bezeichnet wurde. Er und seine wechselnden Partner bildeten keine Schule, keinen dominanten Stil. Im Vordergrund standen Einzelbauten, individuelle Lösungen im jeweiligen Kontext, eine Haltung, die auch in Repräsentationsbauten wie dem gläsernen Parlament als «heitere Demokratie» wahrgenommen wurde. Inmitten seines vom Willen zur Qualität geprägten Arbeitens weist Behnisch nur eines weit von sich: «Wir traten nicht mit der Absicht an, Symbole zu schaffen. Es wurden einfach Symbole.» Und diese sind heute in Gefahr.