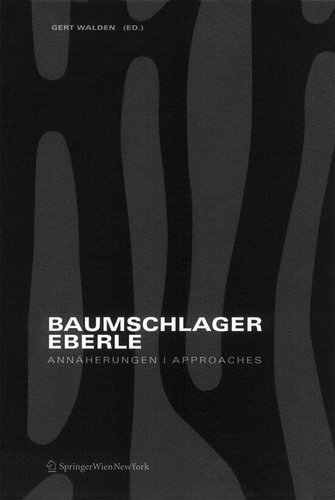Raster und Modul, Vorfertigung und Montage: die Baumethoden der Wirtschaftswunderära. Was helvetische Baukünstler mit ebendiesen Mitteln für die Architektur erreicht haben, führt die Ausstellung „Nachkriegsmoderne Schweiz“ im Wiener Ringturm eindrücklich vor Augen.
Nicht Shanghai oder Havanna waren die Ziele der Architekturenthusiasten in den fünfziger und sechziger Jahren. Nein, es war schlichtweg die Schweiz, denn das aktuelle Spesenrittertum des Kulturbetriebs existierte ja noch nicht, und die geographische Erreichbarkeit war damals noch ein Thema.
Mit Vespas, Lambrettas und Puch-Rollern steuerte die einstmals junge Generation österreichischer Nachkriegsarchitekten das südwestliche Nachbarland an, um ihr Informationsdefizit in Sachen Moderne zu kompensieren. Und der Weg hat sich gelohnt. Die Schweizer Nachkriegsmoderne knüpft unmittelbar - abgesehen vom Intermezzo des heimattriefenden Landi-Stils der vierziger Jahre - an die erste Moderne an. Die helvetischen Architekten thematisieren neue Aufgaben für ihre Zunft: Strukturierung des Raums mit Hilfe von Raster und Modul, Flexibilität der Nutzung und Montagebauweise. In diesem Land, vom Bombenkrieg unberührt, wird mit den technischen Grundlagen für ein neues Bauen experimentiert, wie auch die Auswirkungen für die Architektur auf hohem Niveau analysiert werden.
Die Ausstellung „Nachkriegsmoderne Schweiz“ im Ringturm vermittelt nun einen ausgezeichneten Blick in die einstmals hoffnungsfrohe Zukunft vor einem halben Jahrhundert. Die beiden Kuratoren, Walter Zschokke und Adolph Stiller, haben dafür 14 Bauten von Werner Frey (1912 bis 1989), Franz Füeg (Jahrgang 1921), Jacques Schader (geboren 1917) und Jakob Zweifel (Jahrgang 1921) ausgewählt.
Repräsentativ für die Bautypen der industriellen Gesellschaft, finden sich darunter Wohnhausanlagen, Bürogebäude und Bauten aus dem gesamten pädagogischen Bereich. Sachlich distanziert, in ihrer Kühle den Bauten entsprechend, werden die Exponate aufbereitet. Den Möglichkeiten der Nachkriegsmoderne entsprechend natürlich mit den analogen Medien Film (Regie: Georg Radanowicz), Photographie (Doris Fanconi) und Plänen. Ihr Einsatz generiert gepaart mit dem präzisen Raumprogramm eine nobel zurückhaltende Atmosphäre, die als Äquivalent der dargestellten Bauten dem Besucher unaufdringlich wie auch didaktisch begegnet. Die Kuratoren haben sich nämlich in der Ordnung der Exponate vom Städtebau der Nachkriegsmoderne leiten lassen: Im Ringturm sind nun wieder diese kleinen Höfe, diese querenden und begleitenden Wege zu finden, wie sie charakteristisch für den Städtebau der vier präsentierten Architekten sind.
Nachkriegsmoderne in der Schweiz bedeutet nämlich im besonderen ein Untersuchen der Beziehung zwischen Individuum und Gruppe. Die Architekten nützen die Chancen der Zeit, um ihr Statement über ein neues Verhältnis der Menschen untereinander abzugeben. „Gemeinsam und allein“, so könnte das gemeinsame Thema der städtebaulichen Annäherung beschrieben werden. Vorbei sind die Zeiten des Kollektivismus der Zwischenkriegszeit, die Egalité wird postuliert. Neu ist eine wohlüberlegte Balance zwischen Individuum und Gruppe. Die Kuratoren gehen in der Auswahl der Objekte auf diesen gebauten Diskurs ein. So findet man im Ringturm das Jugendheim Erika von Werner Frey (Zürich 1958/59) oder Jacques Schaders wichtige Kantonsschule Freudenberg (Zürich 1956 bis 1960). Bauten also, die a priori das Zusammenleben artikulieren oder wie bei Franz Füegs Kirche St. Pius in Meggen/Luzern (1964 bis 1966) zumindest temporär und zeichenhaft einen Ort der Gemeinschaft bilden.
Der helvetische Urbanismus ist allerdings nicht unter der Käseglocke einer heimatlichen Tradition entstanden. Vielmehr mußten über die alpinen Grenzen hinweg die städtebaulichen Entwicklungen in den Niederlanden und die gedankliche Vorarbeit von Claude Lévi-Strauss reflektiert werden. Der französische Ethnologe veröffentlichte 1955 seine Studien „Traurige Tropen“, die starke Resonanz erfuhren. Nicht mehr das historistische Denken des 19. Jahrhunderts mit dem Überwinden der Natur, sondern eine ahistorische Betrachtungsweise wird hier propagiert.
Strukturen aus der Natur, die Vorbilder primitiver Kulturen wurden Anknüpfungspunkte der Architekten für die Organisation des modernen Raums. Unwillkürlich wird man an das Waisenhaus des Niederländers Aldo van Eyck in Amsterdam erinnert, wo ein vielzeiliger Cluster um einen zentralen Hof aufgemacht wird, um schließlich in der Stadtlandschaft zu versanden.
In den Niederlanden wie in der Schweiz ist nur noch wenig vorhanden von den Monolithen und Wohnstangen der ersten Moderne. Im Gegenteil, vor allem die Deutschschweizer Architekten haben es mit der Maßstäblichkeit ihrer Anlagen sehr genau genommen, wie sie auch die Möglichkeit einer Expansion der Strukturen schon im Entwurf berücksichtigt haben. Aber damit nicht genug: Was die Schweizer Gruppe - als solche kann man sie durchaus bezeichnen - besonders hervorhebt, ist die Öffnung des Dreidimensionalen.
In der Kantonsschule von Jacques Schader etwa wird mit der Typologie traditioneller Gangschulen gebrochen und das neue Leitbild des Zusammentreffens von Schülern und Lehrern mit der zentralen Halle formuliert. Daher ist gerade die Kantonsschule ein bedeutendes Beispiel für die „Durchdringung und Verflechtung einzelner Geschoße und Raumelemente, also die Verwendung der dritten Dimension als wesentliches gestalterisches Mittel“, schrieb Schader 1960 in der Zeitschrift „Bauen + Wohnen“. Wie übrigens Ausstellung und Katalog das hohe Niveau der theoretischen Auseinandersetzung dieser schweizerischen Architekten dokumentieren.
Sehr früh schon war sich auch Franz Füeg der Chancen und Gefahren der neuen Baukunst bewußt. In seinem Vortrag „Was ist modern in der Architektur? Eine Strukturanalyse der zeit-genössischen Baukunst“ (publiziert 1958) zieht er die Grenzlinien zwischen Moderne und Modernismus. Moderne Baukunst ist für ihn charakterisiert durch einen „Raum, der nicht für sich selbst besteht, sondern stets nur aus der Beziehung zu anderem erst zum Raum wird“. Der Modernismus hingegen habe von diesem Anliegen noch kaum Kenntnis genommen. Dieser produziere Städte, die nicht für den Menschen, sondern für einen imaginären Mechanismus gebaut seien.
Raster und Modul, Vorfertigung und Montage sind für die vier Schweizer Architekten nur technische Möglichkeiten, nicht Fetische des eben genannten Mechanismus. Immer wieder kommt in den Schriften und Bauten die Anthropozentrik ihrer Architektur zum Ausdruck. Damit versperren sie sich vielleicht die Sicht auf das Visionäre des technischen Zeitalters, wie es die Gruppe Archigram in ihrer dekorativen Flower-Power-Manier angedacht hat. Die schweizerische Architektur der Nachkriegsmoderne hat bisweilen einen etwas betulichen Grundton, etwas von der Attitüde des „guten Menschen“. Sie verweigert sich damit aber auch den Verwertungsmechanismen des damals grassierenden Wirtschaftswunderfunktionalismus mit seinen sogenannten Zweckbauten, die heute nicht einmal den Investoren nützen.
Knapp 50 Jahre nachdem die Bauten der zweiten Schweizer Moderne entstanden sind, kann man sich fragen, wo das Entwicklungspotential dieses Strukturalismus lag. Ohne Zweifel ist die technische Kompetenz der Architekten für die Zukunft schlichtweg überlebensnotwendig, um gegen Haustechnik-Planer bestehen zu können. Die Vorstellung von der flexiblen Raumgliederung im industrialisierten Bauen ist eigentlich schon zur Selbstverständlichkeit geworden. Allein, die Präzision im Detail, wie sie diese Schweizer Architekten beherrscht haben, wird weiterhin zu den aktuellen Herausforderungen zählen. Auch die Prämisse der dienenden Funktion der Architektur im Zeichen eines humanistischen Weltbildes bildet eine immer noch sehr wichtige und wirksame Gegenposition zum künstlerischen Subjektivismus mancher formalistischer 3D-Designer im Modebetrieb des Marketing-Artikels Architektur.
In der gegenwärtigen Diskussion um das Physiognomische in der Architektur, um die Alternative „Blase oder Box“ ist die Schweizer Nachkriegsmoderne ein Referenzprodukt für die wiederaufgelegte Abstraktion und Dynamisierung der Architektur. Was die Schweizer nach dem Zweiten Weltkrieg allerdings kaum untersucht haben und worin sie sich deutlich von den „Modernisten“ der Gegenwart unterscheiden, das ist das Physiognomische der Architektur. Die Struktur mit ihrer gedanklichen Perspektive im Unendlichen eröffnet dafür keine Option, sodaß das Defizit der gestalthaften Erkennbarkeit von Architektur nicht bewältigt werden konnte.
[Die Ausstellung „Nachkriegsmoderne Schweiz: Architektur von Werner Frey, Franz Füeg, Jacques Schader und Jakob Zweifel“ im Wiener Ringturm (Wien I, Schottenring 30) ist noch bis 14. Dezember zu sehen (Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr).]