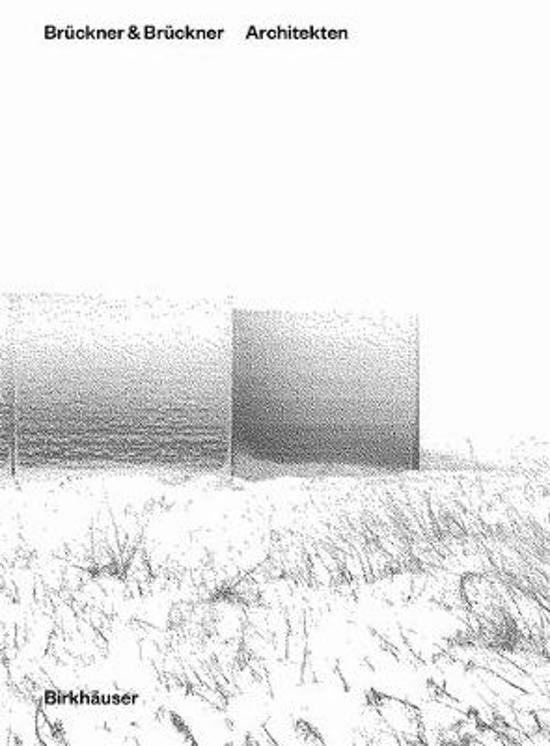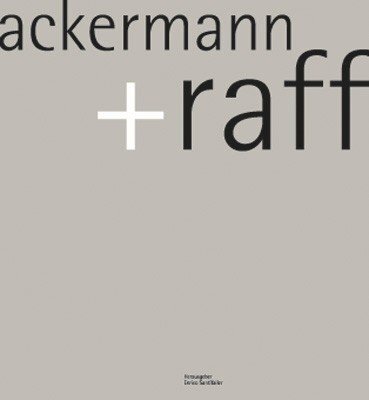Artikel
Collegium Academicum in Heidelberg
Der Neubau des Collegium Academicum ist ein Modellprojekt – in vielerlei Hinsicht. Es bietet bezahlbaren Wohnraum für junge Menschen, die sich in Ausbildung befinden – und noch viel mehr. Auch architektonisch wurde mit einem innovativen Holz-Skelett-Bausystem Neuland beschritten, das ohne metallische Verbindungen auskommt.
Es gibt keine pittoresken zwischen kleinen Gassen gespannten Wäscheleinen. Und doch herrscht in einem Blockinneren in Heidelbergs Süden ein wenig süditalienische Atmosphäre. In den Gängen im EG, aber auch auf der Freiterrasse im 1. OG stehen eine ganze Reihe von Wäscheständern verschiedener Größen und Farben. Behängt mit Jeans, Shirts, Handtüchern, Laken. In der »Waschlounge« rattern acht Maschinen eines ostwestfälischen Premiumherstellers, bei den Trocknern hingegen rührt sich nichts. An diesem sehr warmen Vormittag Ende August ist nasses Zeug in Windeseile trocken, und Strom gespart, wozu mehrere Schilder die Bewohner:innen anhalten, wird damit auch. Manch einer schaut der Szenerie von einem auf dem Rasen aufgebauten Liegestuhl zu, auf einer Terrasse im 3. OG trinkt ein Pärchen Kaffee, während im Außenbereich, vor der schon leicht ergrauten Holzfassade, sich eine kleine Gruppe junger Menschen mit Rechen und Hacken der Gartenarbeit widmet. Ein wenig Dolce Vita und Gaudeamus igitur. Studierendenleben im Jahre 2024. Freilich, was heute heiter und beschwingt auf dem Konversionsgelände des ehemaligen US-Militärhospitals in Heidelberg-Rohrbach wirkt, musste hart erarbeitet werden.
Selbstorganisiertes Wohnen als IBA-Projekt
Im Collegium Academicum (CA) – 1945 von der Universität als »Lebens-, Arbeits- und Selbsterziehungsgemeinschaft« ins Leben gerufen – von der Hochschule wegen linker Umtriebe 1978 zwangsaufgelöst, als Verein später wieder gegründet, reifte Anfang der 2010er Jahre die Idee, ein selbstverwaltetes Wohnheim für Studierende, Auszubildende und Promovierende zu bauen. Nachdem wichtige Institutionen in der Stadt ihre Unterstützung zugesichert und das Mietshäuser-Syndikat, ein Zusammenschluss von derzeit über 200 selbstorganisierten und nicht kommerziellen Hausprojekten, über Möglichkeiten und Fallstricke beraten hatten, bewarb man sich erfolgreich als offizielles Projekt der IBA Heidelberg »Wissen schafft Stadt«. In Workshops zu den Themen »Bildung in der Architektur« und Suffizienz lernten die CA-Verantwortlichen Hans Drexler, Gründer des Frankfurter Büros DGJ Architektur, kennen – und schätzen. Seine umfangreiche Forschungs- und Autorentätigkeit gerade in Sachen nachhaltiger Holz- und Wohnungsbau und der prononcierte Bildungs- und Ökologiewillen der Heidelberger Kollegiaten, das passte zusammen.
Drexler zeichnete einen ersten Entwurf, der in mehreren Runden mit CA-Aktivist:innen und künftigen Bewohner:innen ausgearbeitet wurde. Realisiert wurden ein L-förmiger Holzbau sowie ein weiterer kurzer Baukörper, die zusammen mit einer 330 m² umfassenden Gemeinschaftsaula und den erwähnten Laubengängen einen länglichen Block bilden. In dem viergeschossigen Gebäude entstanden auf knapp 5 000 m² Nutzfläche 46 Wohngemeinschaften für insgesamt 176 Bewohner:innen. Die Individualräume sowie das Bad gruppieren sich um eine Gemeinschaftsfläche mit Wohnküche, wobei diese variabel ist. Denn Drexler konzipierte jedes Zimmer zweiteilig: einen Kernbereich mit knapp 7 m² für Bett, Schrank und kleinen Schreibtisch sowie eine mit einem Raumteiler separierte, ebenso große sogenannte flexible Zone für beispielsweise Sessel oder auch ein kleines Sofa. Mit wenigen Handgriffen kann man diese Zone auch dem Gemeinschaftsbereich zuschlagen.
Und das taten denn auch die meisten Kollegiaten: Knapp zwei Drittel der Bewohner:innen kommen derzeit mit dem Kernbereich zurecht und erleben durch persönlichen Verzicht mehr Gemeinschaft(sfläche). Dass der Architekt statt normaler Anschlagstüren Schiebetüren für die Zimmer konzipierte, war eine gute Entscheidung – weil sie dem knapp bemessenen Raum mehr Platz gibt. In die Holzwände eingelegte Gummidichtungen erreichen eine hohe Luft- und Schalldichte, wofür nicht nur die üblichen Messungen, sondern auch Wahrnehmungstests gemacht wurden.
Holz-Skelett-Bausystem mit metallfreien Knotenpunkten
Gebaut wurde auf Basis von Drexlers Forschungsprojekt »Holz: Form- und kraftschlüssig«. Ziel war, eine Entwurfs- und Konstruktionsmethode für eine Architektur zu entwickeln, die flexibel und anpassungsfähig ist. Und zwar in dem Sinne, dass sie eine weitreichende Partizipation der Nutzer:innen geradezu fordert und sich mit einfachen Mitteln auch an die Bedürfnisse späterer Nutzer:innen angleichen lässt. Zentrales Element bei »Open Architecture«, wie Drexler sein Holz-Skelett-Bausystem nennt, sind Knotenpunkte, die als form- und kraftschlüssige geometrische Verbindungen der Tragelemente ausschließlich aus Holz konstruiert werden. Also ohne jegliche Verwendung von metallischen Beschlägen, sodass einerseits die Produktion solcher Holzgebäude vereinfacht und wirtschaftlicher, andererseits bei eventuellem Rückbau auch das Recycling unkomplizierter wird.
Für sein System kombinierte er traditionelle Zimmermannstechnik wie Schwalbenschwanz- und Schlitz-Zapfen-Verbindungen (Hartholzdübel sorgen für zusätzliche Sicherung) mit zeitgenössischer Bautechnologie und computergestützten Abbundanlagen. Die dreidimensionalen Geometrien der Knotenpunkte wurden dabei parametrisch berechnet. Der Architekt unterteilte das Gebäude durch die durchgängige Trennung der Konstruktion zwischen Nutzungseinheiten in statisch unabhängige Abschnitte. Weil die Erschließung über einen mit einer Fuge getrennten und nicht aussteifenden Laubengang aus Stahlbeton erfolgt, musste davon unabhängig das statische System des Holzgebäudes dessen Lasteinwirkungen aufnehmen. Dabei wurden beispielsweise die Schubkräfte der mit schwalbenschwanzförmigen Holzverbindern (X-Fix) zu Scheiben verbundenen BSP-Deckenelemente in darunterliegende Unterzüge und einige wenige aussteifende Wandscheiben übertragen. Aus den Wänden werden die Lasten ebenfalls durch die X-Fix-Verbinder in die Stützen übertragen. Dadurch wirken auf diese Stützen sowohl Druck- als auch Zuglasten, die in der Ausbildung der Knoten am Geschossübergang und Bodenanschluss berücksichtigt wurden.
Selbstverständlich achtete Drexler auch auf eine möglichst weitreichende Standardisierung und Vereinheitlichung von Tragwerk und Ausbau, auf die weitgehende Vorfertigung der Bauteile und die Reduzierung und Vereinfachung der Montageschritte auf der Baustelle.
Miete für 370 Euro plus Bildung
Das Collegium Academicum diente neben der Frankfurter Wohngruppe »Gemeinsam suffizient leben« und einer Wohngruppe um das »WohnWerk Mannheim« als Case Study des Forschungsprojekts. Die Baukosten des CA-Neubaus betrugen knapp 15 Mio. Euro (KG 300, 400), die Gesamtkosten 21 270 000 Euro (KG 100–700), wobei das Vorhaben von verschiedenen Institutionen gefördert wurde. Allein aus dem Programm »Variowohnungen« des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung kamen 2,19 Mio. Euro. Ergebnis aller Bemühungen um Wirtschaftlichkeit ist eine Miete von 375 Euro inklusive der Nebenkosten und Internetzugang. Dieser Betrag entspricht etwa der BAföG-Wohnkostenpauschale in Höhe von 380 Euro im WS 24/25, die freilich in kaum einer deutschen Hochschulstadt für ein WG-Zimmer reicht. Doch dem Collegium Academicum geht es um mehr als billiges Wohnen. Man will »gesellschaftliche, soziale und ökologische Verantwortung übernehmen«, »egalitär und inklusiv« und »basisdemokratisch und selbstverwaltet« sein, wie es auf der Homepage heißt. Man will »kritisch und kreativ denken«, »neue Wege gehen« und dabei »wertschätzend kommunizieren«.
Das CA verbindet ein Lösungsmodell für eines der drängendsten gesellschaftlichen Probleme der Zeit – die hohen Mieten – mit Bildung und einem temporären Lebensmodell. Und der Hoffnung, dass die in einem solchen Wohnen erworbenen Fähigkeiten – Stichwort »nachhaltig« – im späteren Leben weiterentwickelt werden. Dass in diesem ambitionierten Modell innovative Holzarchitektur eine entscheidende Rolle spielt, macht das Collegium Academicum zu einem hochspannenden Projekt. Ein Projekt, dem ein paar herumstehende Wäscheständer eine sehr sympathische Note verschaffen.
Gehobene Rasteritis im Grünen
Campus Westend der Goethe-Universität in Frankfurt a. M.
Die Goethe-Universität gibt ältere Liegenschaften auf und konzentriert sich auf das ehemals von den amerikanischen Streitkräften genutzte Gelände am I.G.-Farben-Haus. Einem städtebaulichen Masterplan folgend entstand auf dem neuen Campus Westend ein an städtische Blockstrukturen angelehntes Ensemble in Naturstein, das sich gleichermaßen selbstbezogen wie auch offen für außerakademische Aneignung erweist.
Am Wochenende ist der zentrale Platz des Campus Westend fest in Kinderhand. Alles rollt und kreischt – es ist ein Heidenspaß. Im Hörsaalgebäude, das mit der Mensa den Platz säumt, ist die Cafeteria auch sonntags geöffnet. Heiße Schokoladen und dampfende Kaffeebecher werden zu den Gartentischen herausgetragen. Obwohl teilweise von grünem Maschendrahtzaun umgeben, wird das parkartige Areal der Johann Wolfgang Goethe-Universität als weitere Grünfläche, als Fortführung des westlich angrenzenden Grüneburgparks wahrgenommen und genutzt. Dabei – da mehrere Fachbibliotheken auch am Wochenende in Betrieb sind – mischen sich Studierende mit Kindern, Eltern mit Passanten und Radfahrern. Auf dem Campus Westend gibt das multikulturelle Frankfurt auch im recht kalten Spätwinter ein friedliches Bild ab.
Im Sommer 2001 bezogen die Kulturwissenschaften die ehemalige, nach Plänen von Dissing+Weitling (Kopenhagen) renovierte Konzernzentrale der IG Farben im Norden des Westends. Der aus der Feder von Hans Poelzig stammende, mit Cannstatter Travertin bekleidete Stahl-Bau, der zwischenzeitlich als Headquarter der US Army in Europa diente, ist heute noch so eindrucksvoll wie damals. Den 2002 ausgelobten städtebaulichen Wettbewerb für einen Uni-Campus nördlich des Poelzig-Baus mit insgesamt 39 ha gewann Ferdinand Heide. Der großen städtebaulichen Qualität des Entwurfs halber sowie wegen der zukunftsfähigen »Hochschultypologie« und der »genügenden Entwicklungschancen«. Mit 15 Jahren Abstand ist Heides Vision eines urbanen Campus, der die Qualitäten des Bestands aufnimmt und weiterführt, im Wesentlichen aufgegangen.
Gerade die beiden Grünspangen, die zusammen mit dem »zentralen Band« das Areal durchziehen, geben ihm Großzügigkeit und eine angenehme Weite. Sein Entwurf, den das Frankfurter Stadtparlament 2006 als rechtsgültigen Bebauungsplan beschloss, wird auch in der stets misstrauischen Frankfurter Architektenschaft als der beste aller Wettbewerbsteilnehmer beurteilt.
Varianten der Strenge
Anders dagegen die in der Nachfolge, stets nach RPW-Wettbewerben (Richtlinie für Planungswettbewerbe) entstandenen Uni-Gebäude, die sich – so wollte das jede Auslobung – am Poelzig-Bau orientieren sollten (s. Liste zum Lageplan auf der linken Seite). Insgesamt wurden 185 000 m² BGF neu gebaut und etwa 480 Mio. Euro (2600 Euro/m²) ausgegeben. Nicht darin eingeschlossen ist das Wohnheim beider christlichen Konfessionen mit Apartments für etwa 425 Studierende (Architekten: Karl + Probst, München).
Für all diese Uni-Bauten fällt das Urteil, je nach architektonischer Provenienz des Beurteilenden, anders aus. Für die, die an der TU Darmstadt studierten – und davon gibt es im nahen Frankfurt viele –, haben die Berliner »Schlagschattenfuzzis« die Mainmetropole erobert. Von denen, die anderswo, etwa in Dortmund oder gar in Berlin studierten, hört man naturgemäß andere Ansichten. Dass sich bis auf das Wohnheim stets Berliner Architekten – Heide hat an der TU Darmstadt und an der UdK Berlin studiert – durchsetzten, erklärt das Hessische Wissenschaftsministerium als Wettbewerbsauslober mit »Zufall«. Dessen ungeachtet: Ob des steinernen Fassadenmaterials, v. a. ob der alles robust integrierenden Gartenlandschaft ist zweifellos ein städtebaulicher Zusammenhang entstanden, der sich unschwer als Campus identifizieren lässt, der auch durchweg von besserer Qualität ist als vieles, was in Frankfurt in den vergangenen Jahren entstanden ist. Der neben dem Studieren auch zum Verweilen, Kaffee-Trinken, Spazieren oder sogar zum Spielen einlädt. Und es scheint auch so, dass dies den Studierenden bewusst ist: Es lässt sich auf den Natursteinfassaden kein einziges Graffito entdecken.
Freilich: Über einige inhaltliche Widersprüche kann man durchaus schmunzeln. Denn die Gebäude nehmen keinerlei Beziehung, keinerlei Verbindungen zu ihren Nachbarbauten auf – trotz im B-Plan vorgegebener Raumkanten, Höhen, Dimensionen, trotz der Natursteinfassaden, trotz »Orientierung« an Poelzig. Der ach so kontextsensitive, vom städtischen Straßenraum gedachte Berliner Neorationalismus bleibt in der durchgrünten Stadtlandschaft des Campus Westend auf Einzelstatements beschränkt. Er kann, wenn kein städtischer Kontext da ist – und das Uni-Gelände liegt relativ isoliert –, offensichtlich selbst wenig Kontext aufbauen. Heide hatte gedacht, über die Nutzung Beziehungen herzustellen: Über die Bibliotheken für insgesamt knapp 1 500 Studierende, die sich in den Sockelgeschossen des RuW- und des PEG-Gebäudes befinden. Die sollten offen sein und sich zum Campus orientieren. Doch Müller Reimann bauten zwei introvertierte, jeweils um einen grünen Innenhof liegende Büchereien. Auch die dritte Bibliothek – im Fachcluster für Sprach- und Kunstwissenschaften, der von 2018 an nach Plänen von BLK2 Architekten im Nordosten des Uni-Areals gebaut werden soll – orientiert sich mit ihren 350 Studentenarbeitsplätzen nach innen.
Darüber hinaus ist der Einwand berechtigt, dass die Kollegen aus der Hauptstadt Poelzig allzu eng, allzu klassizistisch interpretierten. Es braucht nicht viel, um beim I.G.-Farben-Haus bei allem Willen zur strengen Form einen furiosen Formen- und Anspielungsreichtum in Detail zu entdecken, der die Monumentalität des Baus immer wieder unterläuft. Erst die Verschränkung beider Ebenen macht seine eigentliche Qualität, seine Kraft aus. Von dieser Synthese ist bei den Berlinern wenig zu sehen – obwohl die Bauten durchweg in hoher handwerklicher Qualität, teilweise sogar hervorragend ausgeführt sind. Kleihues, dem Drittmittel zur Verfügung standen, zitiert in seinem »House of Finance« das Vestibül des Poelzig-Baus, glänzt mit verschiedenfarbigen Marmorböden und drei Seminarräumen, die dem britischen Oberhaus entlehnt sind. Das Haus, das in exklusiver Clubatmosphäre der Begegnung von Finanzwirtschaft, Forschung und Politik dienen soll, ist gesammelter Ausdruck der Distinktionsbedürfnisse, die die Finanzelite hegt – inklusive derer, die dazugehören wollen.
Müller Reimann bauten jeweils viergeschossige Baukörper, die sich über einen zweigeschossigen Sockel erheben. Sie punkten mit Flächeneffizienz und schönen Details – etwa im PEG-Gebäude eine Wand mit handgestocktem, mit ockerfarbenen Zuschlagstoffen versehenem Sichtbeton, umrahmt von ebensolchem, aber geschliffenem. Auch Volker Staab hat drei über ein Sockelgeschoss sich erhebende Baukörper geplant: Einer davon, mit Apartments für Gastwissenschaftler, ist einnehmend charmant geraten, die beiden anderen nur bedingt. Und die Fassade zur Hansaallee mit ihren Schießscharten – querliegende, vom Bücherregal ausgesparte Fenster für eine weitere Bibliothek – ist, mit Verlaub, hässlich und in ihrer fast hermetischen Abgeschlossenheit ein Affront gegenüber Passanten und Betrachtern.
Bei Gesine Weinmillers stocksteifem Quader lässt sich maliziös vermuten, die Architektin habe die »normativen Ordnungen« allzu wörtlich genommen, obwohl sie für ihre Verhältnisse mit L-förmigen Naturstein-Formaten geradezu spielt und feine Schattenwürfe auf die profilierte Fassade zeichnet.
Der Verweis auf die Bauaufgabe kann die ob ihrer gehobenen Rasteristis gescholtenen Kollegen entlasten: Schließlich ist Universitätsbau Bürobau. Weil sich auch der universitäre Mittelbau geschlossen für Einzelbüros aussprach, blieb den Architekten nicht viel anderes übrig, als über den Bibliotheken Bürostrukturen für Institute und Lehrstühle zu bauen. Ob diese in solch barscher Rigidität wie auf dem Campus Westend ausfallen müssen, darüber lässt sich trefflich streiten.
Einzig Heide nutzte konsequent die Freiheiten, die ihm die Sonderfunktionen seiner Gebäude gaben: Mit tiefen Einschnitten, Loggien und geschossübergreifenden Verglasungen geht er fast skulptural zu Werke. Er schneidet Volumina aus, variiert Fensterbreiten hier, schließt groß dimensionierte Fassadenflächen da. Weil auch sein Travertin eine weit größere Farbvarianz aufweist und stärker strukturiert ist als der seiner Berliner Kollegen, kommt er dem Poelzig des IG-Farben-Gebäudes wesentlich näher als jene.
Ausbau der Selbstbezogenheit
Der Campus Westend, der zentrale Anlaufstelle für etwa 25 000 der insgesamt 46 500 Studierenden der Goethe-Uni ist (neben dem Campus Riedberg für Naturwissenschaftler und dem Campus Niederrad für Mediziner), hat mit historischen Altlasten zu kämpfen. Schon Ernst May und Martin Elsässer kritisierten Poelzig, weil dieser mit seinem 250 m langen Riegel – dem damals größten Bürohaus Europas – das dahinter liegende Gelände vom Westend abschneide (Dass die beiden einem ähnlichen, doch architektonisch nicht ganz so beeindruckenden Wettbewerbsbeitrag eingereicht hatten, war ihnen offenbar entfallen). Als im Mai 1972 die Rote Armee Fraktion den ersten von insgesamt drei Anschlägen auf das Hauptquartier der US Army verübt hatte, verwandelte sich der bis dahin öffentlich zugängliche Park zur militärischen Sperrzone. Das galt auch für die dahinter liegenden Offiziersvillen, die Zeilengebäude der Mannschaften und die Frankfurt American High School. Weil die Adickesallee, die den nördlichen Abschluss des Areals bildet, ein vielbefahrener Autobahnzubringer ist, dahinter wiederum Zeilenbauten liegen, und auch im Osten wenig städtische Strukturen vorhanden sind, wird der Campus vermutlich auch weiterhin isoliert bleiben. Und dass gar ein Studentenviertel entsteht – wie einstmals in Bockenheim rund um den derzeit sich rapide leerenden Kramer-Campus –, kann man sich schwerlich vorstellen. Zumal sich in jedem neuen Uni-Gebäude eine Cafeteria mit gehobenem Angebot befindet (auch das eine Vorgabe des Masterplans), sodass die Studierenden nicht gezwungen sind, das Areal zu verlassen. Das Studierendenhaus, derzeit in der Ausführungsplanung (Architekt: HJP, Würzburg), soll das Angebot in naher Zukunft sogar noch vergrößern.
Die weitere Zukunft des Campus ist noch nicht abzusehen. Heide hatte als nördlichen Abschluss insgesamt fünf Sechsgeschosser mit 13-geschossigen Hochpunkten – analog zu den Risaliten des I.G.-Farben-Hauses – vorgesehen. Einer davon, an der Nordost-Ecke, wird derzeit nach Plänen von K9 Architekten (Freiburg) für das Deutsche Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) gebaut. Die restlichen Vier stehen als Reserveflächen für Uni-nahe Einrichtungen zur Verfügung. Darüber hinaus steht die Philipp-Holzmann-Schule dem Campus-Ausbau buchstäblich im Wege. Diese städtische Berufsschule hatte das Gebäude der High School übernommen, deren Sportplatz sollte bis vor Kurzem als Übergangsstandort für ein Gymnasium dienen.
Wegen des enormen Zuzugs sucht die Stadt händeringend nach Grundstücken für Schulen und Kitas. Im Januar 2017 verkündeten Land, Stadt und Goethe-Uni eine »grundsätzliche Verständigung«: Man tauscht Grundstücke aus, die Stadt bekommt einen neuen Schulstandort, die Uni Planungssicherheit für ihren weiteren Ausbau. Über die einzelnen Modalitäten wird noch verhandelt. Wann also der letzte Stein des dann nicht mehr ganz so neuen Campus gesetzt wird, steht in den Sternen. »Mittel- bis langfristig«, heißt es offiziell. Vielleicht zu einer Zeit, in der jene, die ihn heute zum Spielen benutzen, selbst studieren wollen.