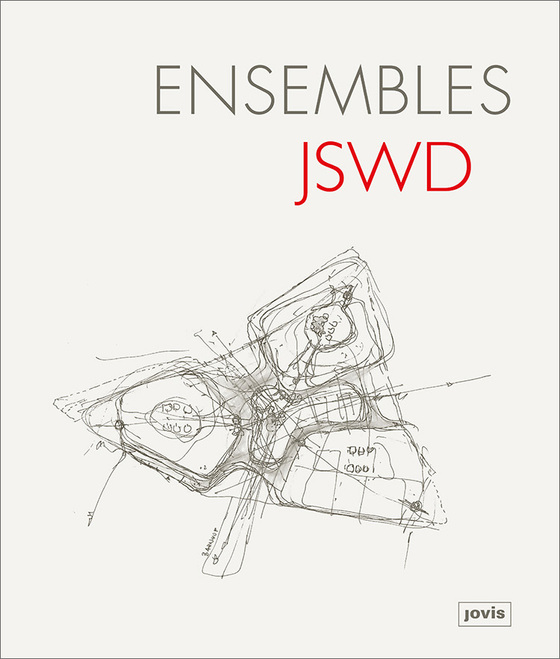Luftschiffhangar in Mülheim an der Ruhr
Dass ein Luftschiffhangar die Zeppelinform aufnimmt, liegt nahe. Dass die Konstruktion der auch als Eventlocation nutzbaren Halle in Mülheim trotz enormer Spannweite allein aus Holz besteht und das gesamte Gebäude kreislauffähig ist, gelang Smyk Fischer Architekten in einem interdisziplinären Team mit Tragwerksplanern und Maschinenbauern.
Kurz vor der Abfahrt Essen-Kettwig gibt es eine Lücke im Gebüsch an der A52, für einen Augenblick erscheint ein silbrig schimmernder Kokon auf grüner Wiese. Wer hier ortsfremd ist, mag irritiert sein. Wer dagegen im Ruhrgebiet heimisch ist, kennt diese Landmarke und sicher auch ihren ikonischen Vorgänger, der ein wenig an eine dicke grüne Raupe erinnerte. Im November 2023 wurde der neue Luftschiffhangar auf dem Flughafen Essen/Mülheim in Betrieb genommen. Das Mülheimer Architekturbüro Smyk Fischer Architekten wurde von der WDL (Westdeutsche Luftwerbung Theodor Wüllenkemper) direkt mit dem Entwurf eines neuen Luftschiffhangars beauftragt (ab LP5 übernahm Gronau Plan, Wegberg). Nicht unbedingt der Anspruch, der mit dem Neubau der Landmarke verbunden war, sondern die Größe der Aufgabe, die ein Architekturbüro allein nicht würde bewältigen können, ließ Martin Smyk und Patrick Fischer mit großem Respekt an diese Aufgabe herangehen. Sie bildeten frühzeitig ein Team mit einem Tragwerksplanungs- und einem Maschinenbaubüro, in dem sie Höhe und Weite des Raums nicht nur bewältigen, sondern virtuos und nachhaltig gestalten konnten.
Im Kreis gedacht
Da es sich um einen Ersatzneubau für die 33 Jahre alte Halle handelte, waren die Dimensionen des neuen Hangars gegeben. Zwei Luftschiffe sollten auch weiterhin darin parken, »Theo« dauerhaft, »Hugo« zu Wartungszwecken und über den Winter. Doch der Neubau sollte mehr als eine bloße Garage werden, die WDL wollte den großen Raum gleichzeitig auch als multifunktionale Veranstaltungshalle nutzen, ihn wirkungsstark inszenieren können. War 1989 noch eine einfache folienbespannte Stahlkonstruktion ausreichend, wurden mit der erweiterten Nutzung auch die Anforderungen an Wärmeschutz, Schallschutz und Brandschutz deutlich komplexer. Diese ließen sich nur mit einer »harten« geschlossenen Hülle erfüllen. Damit stellte sich dem Planungsteam die nächste große Herausforderung. Denn eine harte Hülle, gleich welcher Art, würde sich nicht so einfach wie beim Vorgängerbau kapuzenartig aufklappen lassen, hier musste eine individuelle technische Lösung entwickelt werden.
Einig waren sich alle Beteiligten darin, dass der Neubau der Halle sowie der Rückbau des Bestands nachhaltig erfolgen sollte. Vier Monate dauerte der Rückbau der 92 m langen, 42 m breiten und 26 m hohen Halle. Sobald Theo im April ins Freie konnte, wurden die PVC-Planen abgenommen, dann die acht Stahlfachwerkträger abgebaut und schließlich Fundamente und Hallenboden abgebrochen. Der größte Teil der Fundamente und des Bodenaushubs konnte vor Ort gebrochen und als RCL-Schotter vor Ort wiederverwertet werden. Für den mittleren Teil des neuen Hallenbodens konnten 750 2 x 2 m große Stahlbetonplatten wiederverwendet werden, die Smyk Fischer zum passenden Zeitpunkt auf einer anderen Baustelle, einem ehemaligen Logistikzentrum, ausbauen ließen. Einige davon tragen noch Streifen einer früher einmal weißen Fahrbahnmarkierung, andere leichte Beschädigungen an den Kanten – keine Makel, sondern Zeichen dafür, dass der viel besprochene Re-Use hier tatsächlich geklappt hat.
An der Grenze des Machbaren
Neben den Argumenten der Nachhaltigkeit sprach bei allen Beteiligten auch eine allgemeine Begeisterung für das Material dafür, den Neubau als reine Holzkonstruktion zu realisieren. Inspiriert von dem im Verhältnis zur Hallengröße filigran erscheinenden Stahlfachwerk des Vorgängerbaus, sollte auch der Holzbau eine entsprechend leichte Ästhetik aufweisen. Konstruktiv wäre die naheliegende Lösung die Verwendung massiver Binder aus Brettschichtholz gewesen, wesentlich attraktiver erschien Smyk Fischer jedoch eine Fachwerkkonstruktion. Bei den gegebenen Maßen von Höhe und Spannweite erreicht man damit jedoch die Grenze des Machbaren. Ripkens Wiesenkämper und Marx Krontal Partner entwickelten eine innovative Tragwerkskonstruktion allein aus Holz. Das aus Brettschichtholz gefertigte Primärtragwerk besteht aus 15 gebogenen Zwei-Gelenk-Rahmen als aufgelöste Fachwerkkonstruktion mit einer Spannweite von 42 m. Eine Richtungsänderung gibt es jeweils an den Kalotten. Die Obergurte und Fachwerkdiagonalen sind zur Aussteifung in die darüberliegende Dachtragschale aus 10 cm dicken großformatigen Brettsperrholzplatten eingespannt. Jeder Träger besteht aus vier vorgefertigten Segmenten, die auf der Baustelle zusammengesetzt wurden. Nicht nur die Stöße der Segmente, auch die 592 Knotenpunkte der Fachwerkträger wurden mit jeweils acht Hartholzdübeln (Ø 25 mm) pro Anschluss von Strebe oder Gurt und vier Knotenplatten aus Furnierschichtholz (27 mm dick) als reine Holzverbindungen hergestellt. Kraftschlüssig wird die Verbindung, wenn das Buchenholz der Dübel nach dem Einfügen in die Bohrung die Feuchtigkeit aus den Trägern (BSH Fichte) aufnimmt und sich ausdehnt. Innovativ ist bei dieser Konstruktion die Übertragung der klassisch zimmermannsmäßigen und auch hier von Hand ausgeführten Holznagelverbindung in den Maßstab des zeitgemäßen Ingenieurholzbaus.
Die Dachschale aus 10 cm dicken großformatigen Brettschichtholzplatten dient nicht nur der Aussteifung der Konstruktion, sondern gewährleistet zudem Schall- und Wärmeschutz. Die erforderlichen Werte werden nach dem Folieren und Abdichten mit einer wiederum 10 cm dicken Schicht Mineralwolle erreicht. Um die charakteristisch gerundete Form des Hangars zu erzeugen, wurde die gesamte Konstruktion mit einer Aluminium-Stehfalzfassade überzogen. Die Hülle ist damit langlebig und wartungsarm und ebenso wie die Konstruktion sortenrein recycelbar. Nur an der Westseite reicht die Fassade nicht bis auf den Boden, hier lässt ein an den langen Flanken auslaufendes Tür- und Fensterband Tageslicht und Gäste in die Halle.
Ästhetischer Mehrwert
Die große Konsequenz der Planung erzeugt nicht nur einen außergewöhnlichen Baukörper, sondern auch einen fast wie das Innere einer Kathedrale wirkenden Raum. Beleuchtung, Rauchmelder und insbesondere die linearen Aluminium-Deckenstrahlprofile der Heizung sind mit eigener Rhythmik schlüssig in die Geometrie des Raums eingefügt.
Zum Ein- und Ausfahren der Luftschiffe muss der Hangar an einer Stirnseite in voller Höhe zu öffnen sein. In einer Machbarkeitsstudie untersuchte das Planungsteam Möglichkeiten zur Öffnung der östlichen Kalotte mit zwei großen Torflügeln und deren räumliche Wirkung. Sie erkannten das Potenzial der Funktion als potente gestalterische Geste, sahen aber auch, dass zur Umsetzung Maschinenbau-Expertise erforderlich war. Dr. Schippke + Partner (Hannover), Experten für bewegliche Brücken, entwickelten für die beiden jeweils 72 t schweren Torflügel eine auf Schienen fahrende Zugmaschine, die das gesamte Element um einen Gelenkpunkt dreht. Der jeweils rund fünf Minuten dauernde Öffnungsprozess wird von drei Personen gesteuert. Im geöffneten Zustand erinnert die Ostansicht des Hangars nun an einen gewaltigen Flügelaltar. Höchste Präzision ist dabei erforderlich, auch bei Wind dürfen sich Tore und Halle nicht bewegen. Dabei gelang es dem Planungsteam, die konstruktiven und technischen Erfordernisse, wie z. B. die massiv ausgeführten Randbinder von Toren und Halle, schlüssig in das System zu integrieren. Wie im gesamten Bau musste nichts kaschiert werden, alles darf ablesbar sein.
Die zum Fachwerk aufgelöste Konstruktion erwies sich als materialeffizient und wirtschaftlich, ein wichtiger Aspekt, da die russische Invasion in die Ukraine zur Bauzeit enorme Auswirkungen auf Preise und Verfügbarkeit von Baustoffen hatte. Mit der integralen und BIM-gestützten Planung und einem hohen Vorfertigungsgrad gelang es, den Hangar inklusive Abriss des Bestands im Zeitraum von April bis Ende Oktober 2022 so weit fertigzustellen, dass Theo vor dem Winter wieder unter das Dach kam. Die Errichtung der reinen Holzkonstruktion dauerte dabei nur zehn Wochen, Ausbau und Restarbeiten waren im August 2023 abgeschlossen. Was der Raumwirkung der Halle sehr zugutekommt, ist, dass sie konsequent ohne Einbauten, vollständig offen geplant wurde. Die dadurch fehlenden Nebenräume (Kantine, Gastronomie und Sanitärbereiche sowie Büros für die Verwaltung) werden in einem Pavillon Platz finden, der derzeit in einem zweiten Bauabschnitt direkt angrenzend errichtet wird. Erst dann wird das bereits mehrfach ausgezeichnete Projekt wirklich fertig sein.