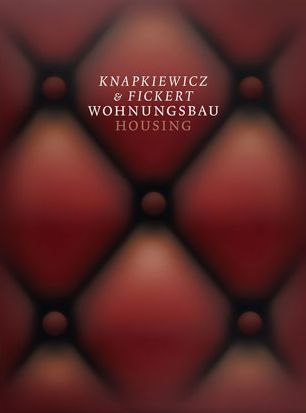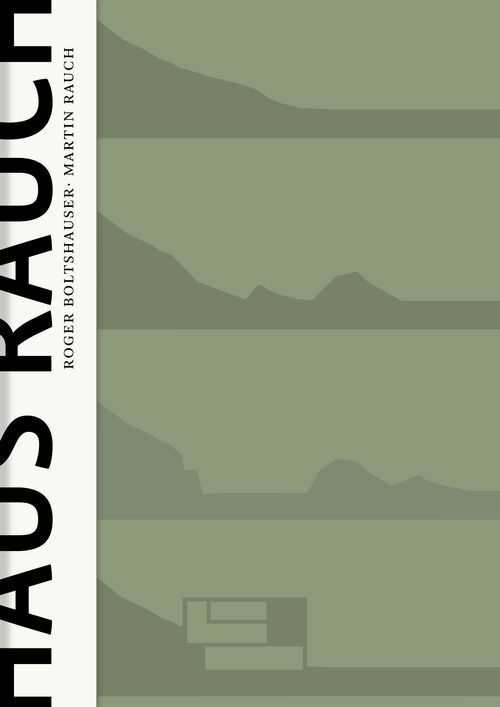Artikel
Duft und Klang – Auratischer Ort
Cinema Sil Plaz in Ilanz (CH)
In den abgelegenen Tälern am Vorderrhein ist Kultur nur zu haben, wenn man sie selber macht. So veranstaltet der örtliche Filmclub zusätzlich zum Kinoprogramm auch Konzerte, lädt zu Lesungen oder Theaterabenden ein und schuf dadurch ein kleines Kulturzentrum. Die Architekten sind selbst Mitglieder des Vereins und sorgten innerhalb der bestehenden Räumlichkeiten für Anpassungen der Haus-, Sicherheits- und Kinotechnik sowie den nötigen Lärmschutz. Durch minimale, aber hochpräzise Eingriffe und unter Verwendung archaisch anmutender Materialien wie z. B. Lehm sind stimmungsvolle Räume entstanden.
In einem Kino zählt das Immaterielle, Licht und Ton schaffen die Welt. Kinosäle, die darüber hinaus einem architektonischen Anspruch gerecht werden, sind rar. In Ilanz erwartet man einen solchen am allerwenigsten. Architekten ist das Städtchen mit rund 2 300 Einwohnern nur deshalb ein Begriff, weil der Weg nach Vals dort hindurchführt. Von der Rhätischen Bahn steigt man hier ins Postauto, das sich zu Zumthors Therme hinaufschlängelt. Ab jetzt ist Ilanz aber ebenfalls eine Übernachtung, weil einen Kinobesuch wert.
Die Geschichte beginnt vor rund 20 Jahren. Das Kino Darms schließt als letztes Kino der Region Surselva. Um die Lücke zu füllen, gründet sich der Filmclub Ilanz. Der befriedigt im Laufe der Zeit nicht nur cinephile Bedürfnisse, sondern organisiert auch Lesungen und Diskussionsrunden, Konzerte und Theatervorführungen. Als Openair-Wanderkino zieht er in verschiedene Gemeinden, auf Bio-Bauernhöfe und Kuhalpen, er berät Schulklassen bei Filmprojekten und hilft bei der Organisation von Dorffesten. Im Laufe der Jahre wird aus dem Film- ein Kulturclub, ein Zentrum für Kleinkunst der Surselva mit 150 Mitgliedern. Lange trifft man sich in ungemütlichen Provisorien, 1999 schlägt der Versuch fehl, die leerstehende Markthalle in Ilanz zum ständigen Quartier zu machen. Dann findet man das Haus Vieli im Zentrum des Dorfs. Eine mächtige Einzelsäule, die weiße Putzfassade und der fehlende Dachüberstand zeigen Kennern den früheren Umbau von Rudolf Olgiati (dem Vater Valerios) – ein stattliches Haus mit Wohnungen, Büros, einem Therapieraum und einem Café. Und mit Besitzern, die Kultur fördern. Seit Herbst 2004 vermieten sie dem Filmclub den rückseitigen Anbau, Räume und Keller im Haupthaus. In dieser ehemaligen Weinhandlung, die laut den Architekten einst auch als Schmiede genutzt wurde, findet in den folgenden Jahren ein vielseitiges Winterprogramm seinen Ort – mit Veranstaltungen auch für Kinder, Jugendliche und Senioren, für Einheimische und Weltoffene, auf Plastikstühlen und mit zünftigem Barbetrieb danach.
Sinn für Form und Handwerk
Ein Umbau ist notwendig, denn die Wohnungen im Haus und in der Nachbarschaft sind vom kulturellen Lärm geplagt. Auch muss Kino- und Brandschutztechnik installiert, diejenige der sanitären Anlagen, von Heizung und Lüftung erneuert werden. Die Planung übernehmen zwei noch relativ junge ETH-Architekten. Sie engagieren sich bereits länger im Filmclub, erforschen von Ilanz aus das bauliche Erbe ihrer Heimat und bauen auch immer wieder daran weiter: Gordian Blumenthal und Ramun Capaul. Ihren Anspruch an Architektur und ihr Können zeigt das neue Cinema Sil Plaz sehr schön: Zuerst, indem es sich eben nicht »neu« präsentiert. Nicht von außen – wo lediglich die neu aufgedoppelten Fensterrahmen eine Veränderung zeigen – und auch nicht im Innern, im langen Raum des Anbaus, der Eingang und Bar, Konzertraum und »Beiz« also Kneipe gleichzeitig ist. Nichts haben die Architekten hier verkleidet – die, übrigens, wie viele andere Vereinsmitglieder auch, selbst zum Werkzeug griffen. Den vorhandenen Kalkverputz beließen sie, die anderen Wände und die offene Holzdecke kalkten sie neu. Auf der alten Holzempore stehen nun einige Beizentische; freigeräumt dient sie den Künstlern als Bühne. Eine lange Bartheke teilt die andere Hälfte des Raums. Die einfache Gestalt und die praktischen Kniffe der Steh- und Einbaumöbel – ein Möbel dient z. B., geklappt und geschoben, an Club-Abenden als DJ-Pult – zeigen Sinn für Form und Handwerk.
Fragt sich der Besucher im ersten Raum noch, was dort neu sei, so wird er beim Gang in Richtung WC hellhörig. Im zentralen Foyerraum passiert er riesige, unbehandelte Stahltore, die an Rollen hängen und auch die Wände und Türen der WC-Kabinen sind nicht aus gängigen, kunstharzbeschichteten Platten, sondern aus brachialem Metall. Meint man vorn in der Beiz noch den einst hier abgefüllten Wein zu riechen, so klingt hier förmlich der Schmiedehammer im Ohr. Der fein gearbeitete Waschtisch aus bläulichem Gneis (Ilanzer Verrucano) versöhnt allzu zarte Seelen, er ist das Werk des ebenfalls im Club und auf der Baustelle engagierten Christian Aubry, Steinmetz und damaliger Vereinspräsident. Und der Stein, mit seinem gestalterischen Anspruch irgendwie fremd an diesem Ort, bereitet auf den großen Moment vor: den Eintritt in den Kinosaal, durch einen unscheinbaren Holzkasten am Kopf des Foyers.
Kein Schmiedehammer, kein Wein – aber was sonst? Die Schritte über den harten Boden sind fest, werden zwar leicht gedämpft aber nicht geschluckt. Es riecht eigenartig exotisch. Die Wände zeigen ein natürliches Ornament in bräunlichen Tönen. Doch sie sind weder aus Holz, noch aus Naturstein, sie fühlen sich rau und glatt zugleich an, weich und warm. Überhaupt möchte man hier alles anfassen, streicheln: den Stampflehm der Wände, die Bänke aus Eiche, die Polster aus ungefärbtem Leder darauf. Der Boden ist ebenfalls gestampfte Erde, gewachst, um robuster zu sein. Die Lehmbauplatten der Decke überzieht ein Lehmputz und selbst der kleine Treppenblock vor der Fluchttüre besteht aus diesem Material. Der vorarlberger Lehmbauexperte Martin Rauch hat die Architekten beraten und die Handwerker auf der Baustelle angeleitet. Die stampften einen Raum mit abgerundeten Kanten, mit runden Öffnungen zum Projektionsraum, mit einem halbrunden Gewölbe unter der Leinwand, aus dem die tiefen Töne kommen. Rund ist der Raum auch in der gesamten Wirkung für Auge, Nase und Ohr. Der exotische Geruch stammt von den Lederpolstern, die eine in Marokko lebende Freundin der Architekten dort fertigen ließ.
Ein Fremdling ist dieser Raum, keine Frage. Der Lehm kommt zwar aus einer Grube in Surrein, einem Dorf, nicht weit von Ilanz entfernt, doch vertraut ist er nicht. Zumal in einem Kino. Die Macher des Filmclubs, also auch die Architekten, fragten sich zu Beginn der Planung: Was muss heute ein Kleinkino bieten, um existieren zu können? Die Technik war und ist budgetbedingt nicht die neueste, weder digital, noch 3D, ein Großteil der Filme und Veranstaltungen erklärtermaßen anspruchsvoll. Der Raum sollte die technischen Mängel wettmachen, sollte gut genug sein, das Kinoerlebnis zu stützen, sollte auch über das Programm hinaus Menschen anlocken – und nicht nur Architekten. Das ist geglückt, denn für die Ausstrahlung von Stampflehmwänden sind nicht nur Experten empfänglich. Von Donnerstag bis Samstag läuft nun das Kulturprogramm, das von der regional-genossenschaftlichen Raiffeisenbank gesponsert wird. An den anderen Tagen werden in den Räumen auch schon mal Hochzeitstorten oder Geburtstagskuchen angeschnitten. Der Ort taugt nicht nur dafür, sich von Filmen aus aller Welt in eine Traumwelt entführen zu lassen. Er verzaubert auch den Alltag. Welche Leistung!
Leben im Manifest
Der solothurnische Gärtnermeister Ueli Flury hat eine fixe Idee. Er möchte möglichst autark leben, ökologisch und gesund. Die Kinder sind weg, nun kann er ein Stöckli bauen, im hintersten Eck des Gartens neben dem Glashaus seines Blumenladens und dem alten Bauernhaus. Es war bisher der Familie Heim, doch bald wird es jenes einer anderen sein. Den Weg zur Erfüllung seiner Idee nimmt er ernst: Planer evaluierten ihm Bedürfnisse und Möglichkeiten, schliesslich unterbreiteten vier Architekturbüros ihre Studien. Die siegreichen und jungen Bieler spaceshop planten das Haus, das Flury zu einem guten Teil selbst baute. Heute lebt er auf 100 Quadratmetern in drei grossen Räumen, gebildet von zwei dicken Lehmwänden und raumhohen Fensterfronten mit Blick in den schönen Garten.
Nachhaltig und gesund ist das Haus: Der Grossteil des natürlichen Baumaterials hat keine zehn Kilometer Weg hinter sich. Abbruchsteine und alte Grabsteine bilden mit Trasskalkfugen die Kellermauern. Das Traggerüst ist aus Fichtenholz, kurz vor dem winterlichen Neumond im nahen Wald gefällt. Im nahen Dorf vermischte man den Lehm einer Baugrube mit Stroh. Aufgeschichtet und seitlich abgestochen bildet er die achtzig Zentimeter dicken Wände. Strohballen vom Feld des Nachbarn dämmen Boden und Decke. Fichtenbretter drauf, fertig. Kein Silikon, kein Kitt, kein Beton. Nur die Dachabdichtung aus Kautschuk, Fenster und Spenglerbleche entstammen der gemiedenen Welt der Industrie.
Das autarke Leben sichern zwei Kreisläufe: Im Energiekreislauf sorgt Photovoltaik auf dem Dach des Bauernhauses für mehr Strom als nötig und Stückholz aus dem nahen Wald für Wärme. Dem Bewohner wird warm beim Holzhacken, das Haus heizt ein zentraler Herd, der über einen Speicher im Keller die Heizkörper mit warmem Wasser versorgt und auch zum Kochen nützt. Im Wasserkreislauf kommt frisches Nass aus der eigenen Quelle, um nach Gebrauch in einer Sandpflanzen-Filteranlage gereinigt und zum Giessen in der Gärtnerei genutzt zu werden. Die Komposttoilette liefert zweimal jährlich Dünger. Nicht allgemeingültig sei sein Haus, sagt der Gärtnermeister, er sei kein Vorreiter. Sein Alltag ist nun ritueller, qualitätsvoller, umgeben von bergenden und borstigen Erdmauern.
Cinema Sil Plaz
Auf dem Rückweg vom Baden in Vals fährt man darauf zu: das Haus Vieli im Zentrum von Ilanz. Im hinteren Anbau zeigt der hiesige Filmclub seit einigen Jahren ein farbiges Kinoprogramm, veranstaltet Konzerte und lädt zu Lesungen oder Theaterabenden ein — und schuf so ein informelles Kulturzentrum der Region Surselva. Die bald nötigen baulichen Anpassungen für Haus-, Sicherheits- und Kinotechnik sowie Lärmschutz planten die beiden Architekten Gordian Blumenthal und Ramun Capaul als engagierte Mitglieder des Vereins und legten beim Bau auch selbst mit Hand an. Im Bar- und Bühnenraum beschränkten sie sich auf das Nötigste. Rohe Eisentore führen zu den Toiletten und den Raum mit den Filmprojektoren, man riecht noch den Wein, der früher hier abgefüllt wurde.
Den Kinoraum jedoch implantierten sie als schönen Fremdling: Massige Stampflehmwände, Lehmdecke und -boden bilden den archaischen Raum, in dem das bewegte Licht die Besucher an fiktive Orte entführt. Mit ihrer überraschenden Wahl würdigt die Jury die Intensität des Projekts. Die Architekten reagierten feinsinnig auf das Vorhandene. Ihre minimalen, aber hochpräzisen Massnahmen zielten auf das Notwendige und schufen doch etwas Reiches und gänzlich Neues.
[Kommentar der Jury Cinema Sil Plaz]
Hospiz St. Gotthard
Miller & Maranta bauen für die Stiftung Pro San Gottardo das älteste Haus auf dem Pass um. Sie entfernen marode Wände und Balken, erhöhen den Giebel der Umfassungsmauer und setzen eine moderne Holzkonstruktion hinein. Ein tonnenschweres Bleidach gibt dem Haus nun Abschluss und Einheit. Hochparterre schrieb im Septemberheft: ein Gipfel alpiner Beherbergung! Die Jury fragte sich: Ist der Umbau eines solchen Hauses ein Steilpass für die Architekten? Will heissen, sind Aufgabe und Ort per se so schön, dass daraus ein schönes Haus resultieren muss? Wohl kaum, kommt man zum Schluss, und spricht dem Basler Architekturbüro Miller & Maranta für ihr Projekt den Preis zu. Weil sie aus dem vorhandenen Konglomerat ein komplexes, aber stimmiges Ganzes geschaffen haben. Weil sie dem Volumen mit der Überhöhung eine schöne Geste und eine gestärkte Wirkung verliehen haben. Und weil sie Alt und Neu überzeugend und stimmungsvoll miteinander verschmolzen haben.
Der Pass ging ins Tor.
[Kommentar der Jury Hospiz St. Gotthard]
Eingang Grossratsgebäude
Die Aufgabe: dem Eingang zum Bündner Parlament mehr Prominenz verleihen. Die Lösung: ein kraftvolles Objekt vor das Gebäude stellen, unabhängig und eigenständig. Das tonnenschwere Gebilde erscheint aus wenigen Teilen zusammengesetzt und ist aus einem Material gegossen. Mit seiner präzis-monumentalen Geste beeindruckt es und irritiert gleichzeitig mit scheinbarer Instabilität. Die Jury kürt Valerio Olgiatis Eingang zum Grossratsgebäude als eine herausragende Einzelleistung. Er ist mehr Installation als Vordach, mehr Kunst als Architektur.
[Kommentar der Jury Grosser Eingang]
Ursuppenküche
Berlin verdankt Diener & Diener einen aufregenden Museumsraum und eine Geisterfassade.
Wissenschaftler und Aussteller sind zwei verschiedene Spezies. Die einen forschen im stillen Kämmerlein, die anderen wollen diese Forschung unter die Leute bringen. An der Berliner Humboldt- Universität kam es 1869 zum Eklat, als ein präpariertes Walross den Studenten den Zugang zur Aula versperrte. Die üppige naturwissenschaftliche Sammlung der Universität drohte das Hauptgebäude Unter den Linden zu sprengen. Als man dieser Sammlung schliesslich ein eigenes Haus zugestand, träumte der Museumsdirektor von einer Einheit des Forschens und Ausstellens. Er liess den Architekten zwei opulente Treppenhäuser planen, die sämtliche Teile der Sammlung zugänglich machen sollten. Doch als die Tore des Hauses 1889 öffneten, war der Direktor tot, und sein Nachfolger hatte einen anderen Traum. Er liess den Zugang zu den oberen Etagen sperren und im Erdgeschoss eine reine Schausammlung einrichten. Das ist in den Naturkundemuseen der Welt üblich und bis heute so: Die Forscher arbeiten in ihrem Elfenbeinturm, die Besucher stehen zu Füssen der Prachtstufen vor roten Kordeln.
Grandezza und Zerstörung
Nicht, dass die Berliner Säle im Erdgeschoss weniger prächtig wären. Die fast sechs Meter hohen Schausäle zeigen feinsinnig und farbig die Bewunderung ihres Architekten August Tiede für Karl Friedrich Schinkel. Besonders der zentrale Lichthof, den man gleich nach dem Eingangsfoyer betritt, bringt einen ins Staunen, auch weil sich hier der Hals des weltweit grössten Dinosaurierskeletts bis zum Glasdach reckt. Der etwas schematische Flügelbau gruppiert sich, neben dem Sauriersaal, um weitere Lichthöfe und erinnert mit gusseisernen Säulen, Geländern und Lüftungsgittern an die vorangegangene Nutzung des Areals durch die Königliche Eisengiesserei. Da die Sammlung rasant wuchs, vor allem durch das «Ausräumen» der deutschen Kolonien, erweiterte der Architekt schon während des Ersten Weltkriegs sein Gebäude pragmatisch auf dem hinteren Restgrundstück. In den letzten Wochen des Zweiten Weltkriegs traf dann eine Bombe den Ostflügel, bis vor wenigen Jahren noch die «letzte Kriegsruine Berlins». Der weiterhin benutzte Rest des Museums litt am mangelnden Unterhalt während der DDR-Zeit. Bei der Neuordnung des Hauses scheinen Wissenschaftler und Aussteller nun endlich an einem Strang zu ziehen. Den Wettbewerb zur Komplettsanierung gewannen Diener & Diener 1995 mit dem Ziel, auch die oberen Etagen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Bis 2007 reparierten die Basler Architekten fünf Säle im Erdgeschoss, ergänzten kaputte Fliesen und Farbflächen, ertüchtigten Bauteile, darunter die alten Fenster, die sie an heutige Sicherheitsauflagen anpassten. Die neue Technik blieb dabei beinahe unsichtbar.
Grossvitrine für Präparate
Die Architekten gingen aber noch weiter. Schon im Wettbewerb schlugen sie vor, im wiederaufgebauten Ostflügel einen der grössten Schätze der Sammlung zu präsentieren: die «Nasspräparate», rund 276 000 mit Alkohol gefüllte Gläser, in denen Fische, Reptilien oder Säugetiere unbeschadet die Zeit überstehen, zum Teil vor mehr als 200 Jahren von Humboldt selbst nach Berlin gebracht. Darunter finden sich viele «Typenexemplare», Tiere, die als Erste ihrer Art untersucht wurden und vielen internationalen Forschern noch immer als Vergleichsobjekte dienen. Roger Diener stiess mit seiner Idee einer saalgrossen Vitrine — wie sollte es anders sein — bei den Forschern zu Beginn auf Skepsis. Zu wertvoll der Schatz, zu kompliziert das Miteinander von musealer Einsehbarkeit, gesichertem Forscherzugriff und angemessener Lagerung, denn bei Temperaturen über 15 Grad verdunstet der Alkohol, legt die Präparate frei und droht sich zu entzünden. Schliesslich aber überzeugte die Idee und auch die Vorstellung, mit der Inszenierung der Präparate viel Volk anzulocken und ihm die wissenschaftliche Arbeit näher zu bringen.
Mehr Besucher
Der Neubau des Ostflügels bekam grünes Licht, und seine Eröffnung im September 2010 setzte den Schlussstein auf die erste Umbauetappe. Ein Teil der Nasssammlung ist nun im Erdgeschoss des Ostflügels zu bestaunen. Der Grossteil lagert in den Etagen darüber und ist weiterhin nicht öffentlich zugänglich. In den kommenden Jahren soll der Umbau weiterer Hauptsäle des Museums im Erdgeschoss und in den Obergeschossen folgen. Der neue Flügel wird wohl den Popularitätsschub weiter anfeuern, den die Eröffnung der aufgefrischten Säle vor drei Jahren auslöste. Allen voran die Neupräsentation des knochigen Brachiosaurus machte aus dem Museum den «grössten Kinderspielplatz Berlins», wie der Ausstellungsleiter sein Haus gerne nennt. Auf die neuen Displays hatten die Architekten keinen Einfluss. Die stammen vom spezialisierten Büro Art Com — mit Bertron & Schwarz — und setzen auf interaktive Technik und Einbauten, die sich für die architektonische Fassung nicht weiter interessieren. Auch Diener & Diener bewarben sich — gemeinsam mit dem Filmer Peter Greenaway — um die Ausstattung, scheiterten aber schon in der Präqualifi- kation am Einbezug des Künstlers. Anders beim Ostflügel.
Als Einheit von räumlicher Hülle und inszeniertem Inhalt entworfen fällt er nun spannungsvoll aus dem musealen Rahmen. Offenen Mundes umkreisen die Besucherinnen und Besucher den gläsernen Raum, auf dessen Regalen sich fast sechs Meter hoch die Exponate stapeln. Nach rein wissenschaftlichen Kriterien sortiert glotzen hier Fische auf das Publikum herab, liegen Schlangen in bernsteinfarbenen Flüssigkeiten aufgerollt. Die Säugetiere liess man im Depot, um den Kinderschrecken in Grenzen zu halten.
Leuchtstoffröhren im Inneren machen die Regale zum mystisch-strahlenden Schrein. Unbeschriftet zielen sie allein auf den visuellen Eindruck. Aus Sicherheitsgründen wird man allerdings keine Forscher mit den Schätzen hantieren sehen, der Zutritt ist ihnen nur ausserhalb der Öffnungszeiten gestattet.
Geflicktes Bombenloch
Weil die Exponate lichtempfindlich sind, hat der Raum keine Fenster. Flache Nischen in den mit dem kalten Rotpigment Caput mortuum gefärbten Wänden deuten die Lage der einstigen Fenster an. Zum westlichen Innenhof hin war die Fassade erhalten geblieben, zur anderen Seite hin gab es nur noch Mauerfragmente. Die flickten Diener & Diener nicht einfach, sondern ergänzten sie auf eine Art, die — besonders unter Architekten und Denkmalpflegern — für viel Aufmerksamkeit sorgt. Die erhalten gebliebenen Fensteröffnungen der gelben Ziegelfassade liessen sie zumauern, die Bombenlücke füllten sie mit Betonkopien erhalten gebliebener Fassadenteile. Wer nun durch den seitlichen Hof des Museums zu den hinteren Universitätsgebäuden geht, der erlebt ein irritierendes Schauspiel.
Jeder Ziegel, jede Fenstersprosse, jeder Pilasterkopf der zerstörten Fassade ist wiederauferstanden. Gespenstisch farblos, bleich wie die eingelegten Fische. Es ist, als stehe man vor einem jener Schwarz- Weiss-Fotos, mit denen man sich in Berlin so gern an die «gute alte Zeit» erinnert. Damals, als der Krieg noch nicht war und alle Häuser und auch das Schloss noch standen. Doch die Fassade ist aus kaltem Beton und wenig geeignet, nostalgische Seelen zu wärmen.
«Das Museum ist keine Rekonstruktion, aber es handelt von ihr.»
In München und Berlin stehen die grossen Vorbilder der von Diener & Diener wiederaufgebauten Museumsfassade. Roger Diener über Parallelen und Unterschiede.
Der Wiederaufbau eines kriegszerstörten Gebäudes ist eine aufgabe, die wir in der Schweiz nicht kennen. Sind Sie als aussenstehender unbefangener ans Werk gegangen? Mit unserer vor zehn Jahren fertiggestellten Schweizer Botschaft sind wir ja hier in Berlin mitten in die Diskussion über Rekonstruktion und Erhaltung hineingeraten. Spätestens seit dieser Zeit beschäftigen uns Fragen des Umgangs mit dem Baudenkmal, auch in der Schweiz und anderen Ländern. Als Mitglied des Berliner Landesdenkmalrates verfolgte ich später die grosse Rekonstruktionsdebatte. Die wird hier in Deutschland sehr emotional geführt.
Die ergänzte Fassade des Ostflügels hat etwas Geisterhaftes. Ist das Ihr Beitrag zu dieser Debatte? Die Verwendung von normalem Beton spielt eine wichtige Rolle. Es ist der Versuch eines ungeschönten Umgangs mit der Geschichte. So weit ist es an das grosse Beispiel von Hans Döllgast angelehnt, der Alten Pinakothek in München. Deren Wiederaufbau liesse sich allerdings jederzeit vollenden, die Fassade rekonstruieren. Der Berliner Ostflügel schliesst seine kommende Rekonstruktion aus. Ein weiterer Unterschied: Unsere Fassade ist ein Einzelfall, der nur bei der gegebenen Aufgabe Sinn macht. Döllgasts Vorgehen ist ein allgemeines Prinzip, das sich wiederholen lässt.
Und ist das Geisterhafte der Fassade ein Kommentar, beispielsweise zum geplanten Wiederaufbau des Berliner Stadtschlosses? Die in Beton gegossene Hülle mit dem Abguss der Holzfenster in Kunststein hat eine surrealistische Qualität, und von ihr geht tatsächlich eine besondere Wirkung aus. Es ist eine Fassade, aber es ist nicht die Fassade, die sie abbildet. Es ist keine Rekonstruktion der früheren Fassade, aber es handelt von ihr. Von einem Kommentar würde ich aber nicht sprechen. Mit dem leidigen Wiederaufbau des Stadtschlosses hat die Neufas- sung des Ostflügels nichts zu tun.
Obwohl unsere Hülle eine immer wieder geforderte Rekonstruktion ausschliesst, sind die Reaktionen andere als bei der Schweizer Botschaft. So empört sich ein Vertreter der sehr konservativen Berliner Denkmalfraktion bis heute über unsere Botschaftserweiterung, doch das hier sei ein guter Weg.
Das letztes Jahr wiederaufgebaute Neue Museum ist ein viel gepriesenes Paradebeispiel und hat das Denken beim Umgang mit Baudenkmälern in Berlin verändert. Spielte es beim Museum für Naturkunde eine Rolle? Es spielte insofern keine Rolle, als dass David Chipperfield und wir parallel entworfen haben. Die Projekte sind auch ganz verschieden angelegt. Für das Neue Museum hat Chipperfield alle Spuren sorgfältig gesichert und mit grosser ästhetischer Energie herausgearbeitet. Es ist die subtile Inszenierung eines ruinösen Gebäudebestands. Das ist sehr überzeugend vorgetragen und in einer engen Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege entstanden. Bei uns war das anders. Wir haben einen ganzen Flügel des Museums neu gebaut, und weil wir im diesem Neubau für die Nasssammlung die höchsten Anforderungen an Klima und Sicherheit erfüllt haben, konnten wir in den übrigen Sälen auf aufwendige Eingriffe verzichten. Es kann nicht nur eine Formel geben.
Die Präparatoren des Museums gehen ganz ähnlich vor wie ihr bei der Fassade: Sie ergänzen Fehlstellen, zum Beispiel von Saurierskeletten, sichtbar mit nachgeformten Gipsteilen. (lacht) Anscheinend ist es sogar die gleiche Firma, die die Silikonabgüsse gemacht hat. Ich wusste das nicht. Aber ich finde es schön.
Der Nebel lichtet sich
Es ist die beste Biennale aller Zeiten. Kunst macht Räume schwerelos und die Stars mussten für einmal zu Hause bleiben.
«Die Biennale 2010 sollte eine Ausstellung über Architektur sein.» So lautet der Kuratorin erster Satz im Programmheft. An der weltweit wichtigsten Architekturausstellung muss erstmal klargestellt werden, dass es um Architektur geht. Wie viel sagt ein solcher Satz über den aktuellen Zustand der Profession? Er kommt einer Bankrotterklärung gleich.
Wundern muss einen das nicht. Als 2004 Kurt W. Forster die Leitung der Architekturbiennale übernahm, wollte er uns die «Zeichen einer neuen Zeit» vorführen. Wir gähnten ob all der digitalen Wölbungen und Blähungen der üblichen Verdächtigen. Architektur sah man dort nicht. 2006 machte der Londoner Richard Burdett aus dem Jahrmarkt der formalen Eitelkeiten eine Problemschau. Sorge um die Entwicklung der Megastädte trieb ihn um, Unmengen an Fakten schlug er den Besuchern um die Ohren: Fotos und Filme von Caracas bis Shanghai. Architektur? Fehlanzeige. 2008 schliesslich suchte der Amerikaner Aaron Betsky die Architektur «jenseits des Bauens», schickte schräge Objekte auf den Laufsteg, bunt und schrill. Unfreiwillig geriet seine Schau zu einem Abgesang auf die sich nur noch selbst zitierenden «Stararchitekten». Und zu einem Tiefpunkt in der dreissigjährigen Geschichte der Architekturbiennale.
Aus diesem Loch schwebt nun eine Lichtgestalt. Mit Kazuyo Sejima berief die Biennale seit Langem wieder eine praktizierende Architektin an die Spitze. Und eine, die 2010 mit ihrem Büro Sanaa einen rasanten Sprung hinlegte: Im Januar stellte sie ihr Biennaleprogramm vor, im Februar eröffnete sie ihr hoch gelobtes «Learning Center» an der ETH Lausanne siehe HP 4 / 10 und im März wurde bekannt gegeben, dass der diesjährige Pritzkerpreis an Sanaa geht. Im Vorfeld der Ausstellung konnte man sich nicht sicher sein, ob die 54jährige Japanerin den hohen Erwartungen gerecht zu werden vermag. Als Kuratorin war sie unerfahren, sie spricht schlecht Englisch und tritt bescheiden auf, fast scheu. Und was sollte dieser Allgemeinplatz «People meet in Architecture» als Titel? Ihr Konzept, jedem Ausstellungsteilnehmer einen eigenen Raum zuzuweisen und sich selbst zu kuratieren, wurde skeptisch beäugt.
Weg von der männlichen Leistungsschau
Seit Ende September sind die Skeptiker im SanaaRausch. Ähnlich wie die Räume des «Learning Center», in denen man seinen gesunden Menschenverstand wegstaunt, betört die Hauptschau in Venedig ihre Besucher, macht sie glücklich. Atmosphärische Installationen zaubern aus der 300 Meter langen ehemaligen Seilerei in den Arsenalen eine sorgfältig komponierte Folge von Raumerlebnissen: Dunkel folgt auf hell, schwer auf leicht. Sejima lässt Wasser tanzen, Klänge einen Raum formen, der sich im Nebel wieder verliert. Ihr gelang es, aus einer männlichen Leistungsschau ein träumerisches Ereignis zu machen. Dabei liess sie alle Stars der Szene aussen vor: Keine Hadid, kein Gehry, kein Nouvel ist hier vertreten. Als einzigen weiteren PritzkerpreisTräger lud sie Rem Koolhaas ein. Mit einer brillanten Analyse zu unserem Verhältnis gegenüber Baudenkmälern findet der zu alter Form zurück und liefert damit den Beweis, dass er den diesjährigen Goldenen Löwen für sein Lebenswerk verdient.
Auch Sejimas Motto «Menschen treffen sich in Architektur» ist mehr als ein Lippenbekenntnis. Neben der Hauptausstellung auf 10 000 Quadratmetern, den 55 Länderbeiträgen und rund zwei Dutzend weiteren Ausstellungen gibt es unzählige Nebenveranstaltungen, Diskussionsrunden und der Ausstellung führte Hans Ulrich Obrist Interviews mit allen vertretenen Architekten und Künstlern, die am gleichen Ort auf Bildschirmen (und auf Youtube) zu sehen sind. Aber auch die besten Länderbeiträge stellen Menschen in den Mittelpunkt. Zum Beispiel der von Bahrein, ein Werk des Lapa (Laboratoire de la production d’architecture) von Harry Gugger an der ETH Lausanne. In einer Installation aus drei zusammengenagelten Strandhütten wirft man hier einen kritischen Blick auf die für die Öffentlichkeit immer unzugänglicher werdenden Strände des Inselstaates – Gugger und die Seinen wurden dafür mit dem Goldenen Löwen belohnt.
Beglückender Besuch So heterogen die Beiträge auch sind, im Blick zurück erscheint das Bild einer «japanischen» Biennale. Zarte Häuser, leuchtende Räume, das sei die Zukunft der Architektur, gibt uns die Kuratorin mit auf den Weg. Wie ein Exempel eröffnet ein 3DFilm von Wim Wenders über das «Learning Center» die Hauptausstellung, lässt uns durch Raumhügel gleiten. Sanaas Hausfotograf Walter Niedermayr zeigt Bilder von Moscheen, die sich in Helligkeit verlieren. Sejimas Lehrer Toyo Ito hat ebenso einen Raum wie einige ihrer Schüler, auch Werke von Sanaa sind vertreten. Der japanische Pavillon zeigt ein Haus des Büropartners Ryue Nishizawa. Christian Kerez stellt seine grossen Modelle in zwei Räumen aus, Valerio Olgiati füllt einen weiteren. Auch hier: Reinheit, Klarheit, Kunst, wiewohl um einiges muskulöser als in Fernost. Jürg Conzetts Blick auf Brücken und Stützmauern bringt mit Eigensinnigkeit und Sorgfalt — aber der Dichte vielleicht etwas zu viel — den Schweizer Pavillon ins Gespräch siehe Seite 60. Die vorausgegangenen Architekturbiennalen scheiterten an den grossen Fragen, wie Metropolenwachstum oder Nachhaltigkeit, oder aber am Hype des Starsystems. Die diesjährige möchte ihre Besucher schlicht beglücken — sie schafft es. Dass aber auch die Sehnsucht nach schwerelosen Räumen scheitern kann, das zeigt der Beitrag, den die Jury als beste Installation der Hauptausstellung ehrte. Mit ihr versucht der 36jährige Junya Ishigami, ebenso ehrgeizig wie spielerisch Architektur zu entmaterialisieren — und überflügelt dabei fast seine Lehrmeisterin Sejima. Zusammen mit einem halben Dutzend Helfern baute er ein Volumen in die Arsenalehalle, das nur aus Kanten besteht. 4 Meter hoch, 4 Meter breit und 14 Meter lang füllte es das Mittelschiff beinahe aus, doch sichtbar war es kaum, denn die Linien bestanden aus 0,2 Millimeter dünnen, weissen Kunststoffstäbchen, die wiederum von unsichtbaren Fäden abgespannt waren. Leider kamen nur wenige Besucher in den — irritierenden — Genuss, diese feine Zeichnung im Raum zu bewundern. Wenige Tage vor der Eröffnung brachte eine Katze das fragile Hausgespinnst zum Einsturz. Das Team arbeitete vier Tage und vier Nächte am Wiederaufbau und schliesslich triumphierte das Schwebende wieder über die Schwerkraft. Wenig später lief ein Putzmann in die Installation. Zurück blieben ein paar weisse Striche am Boden, ein Mahnmal der Leichtigkeit. Ihr Autor ist nun der Ikarus der Architektur.
Massiv auf dem Gotthard
Miller & Maranta zeigen Berührungsmut mit Traditionen und schaffen einen Gipfel alpiner Beherbergung.
Der St. Gotthard ist nicht nur ein Mythos. Die baumlos strahlende Landschaft der Passhöhe hat keine Mühe, sich gegen den touristischen Sommerbetrieb durchzusetzen. Die vielen verschiedenen Wege und Strassen, die sich hier bis auf 2114 Meter über Null schrauben, zeugen von den Entwicklungsschritten des Reisens: Säumer, Kutschen, Autos. Ebenso die wenigen Gebäude.
Das «Albergo San Gottardo» (1866), die Jugendherberge im ehemaligen Stall, die Alte Sust (1837), früher Warenlager und Remise, heute Museum und Selbstbedienungsrestaurant, und schliesslich das Alte Hospiz, das seit dem 1. August als komfortable Dependance des Hotels dient. Es ist das älteste Haus zwischen den beiden Bergseelein. Die Kapelle, die sich in seinem hinteren Teil befindet, weihte der Mailänder Erzbischof vor achthundert Jahren. Kurz darauf baute man daneben das erste Hospiz, als Unterkunft der Pilger, Händler, Armen und Elenden.
Mehrfach gingen Lawinen, Kriege oder Feuer über das Haus, man baute es wieder auf und um, zuletzt vor hundert Jahren. Die einstige Herberge romantischer Grössen wie Goethe, Mendelssohn oder Wagner geriet in Vergessenheit und verkam. Zuletzt hauste hier das portugiesische Hotelpersonal im Durchzug. Die Stiftung Pro St. Gotthard besitzt seit 1972 alle Gebäude auf der Passhöhe. Eins nach dem anderen hat sie renoviert und wieder nutzbar gemacht. Doch es dauerte drei Jahrzehnte, bis sie den historischen Wert des Alten Hospizes erkannte, dessen Giebelseite so traurig nach Süden blickte. 2005 richtete die Stiftung einen Studienauftrag zu dessen Umbau und Erweiterung aus.
Doch wie geht man mit solch einem historisch bedeutenden Haus um, das sowohl technisch als auch architektonisch heutigen Beherbergungsansprüchen nicht mehr genügt? Man besinnt sich auf die Tradition des Hauses und baut es kräftig weiter. Und das taten die siegreichen Architekten aus Basel, Miller & Maranta. Sie machten sich zum Ziel, die architektonische Wirkung des Gebäudes zu klären und zu stärken. Dafür erhielten sie zwar seine Giebelform, erhöhten es jedoch um ein Geschoss, höhlten es aus und setzten eine neue Holzstruktur ins Innere und eine grosse schwere Dachhaube aus Blei darüber. Deren 25 Tonnen drücken das Haus nun auf den Fels des Gotthardmassivs.
Monumentale Melancholie
Frisch nach ihrem ETH-Studium hatten Quintus Miller und Paola Maranta die Fussgängerpasserelle Werdenberg über die A 13 gebaut. Die war aus Holz und schön verziert und zeigte, dass ihre Entwerfer bei Fabio Reinhard und Miroslav Šik studiert hatten. Die Fachwelt handelte die Brücke als die erste gebaute «Analoge Architektur», die bestehende Vorbilder mit verfremdeten Elementen vorgeschlagen hat. Zwanzig Jahre und viele abstrakte Miller-Maranta-Bauten später, kommt das Déjà-vu: Das Alte Hospiz riecht nach den Ölkreidebildern der «Analogen», denen monumentale Melancholie stets wichtiger war als der Nutzen eines Gebäudes. Gedrungen und käferhaft, die tief heruntergezogene Bleihaut einer Kathedrale würdig. Gespickt ist sie mit zahllosen Gauben. Mit mutiger Hand gingen Miller & Maranta ans Werk. Ein verhaltener Umgang mit dem Flickwerk des Bestandes wäre an dessen erbärmlichem Zustand gescheitert. Oberhalb der ersten Etage entkernten sie das Haus. Der in den 1980er-Jahren renovierte Kapellenraum blieb unverändert, die beiden Geschosse daneben sind neu aufgeteilt, im Erdgeschoss mit knappem Eingangsraum, Technik und Lager, im ersten Obergeschoss mit den Gemeinschaftsräumen hinter den markanten Rundbogenfenstern.
Darüber ist alles neu: Ein betoniertes Treppenhaus mit grosszügigem Gang, rechts und links davon eine eingestellte Holzkonstruktion mit 14 Zimmern bis unters Dach. Da der Pass nur in der Sommerhälfte vom Jahr geöffnet ist und nur in der Zeit gebaut werden konnte, wählten die Architekten eine Konstruktion, die die Zimmerleute vorfertigen konnten. Das Holzständerwerk, dass mit liegenden Bohlen ausgefacht ist, ist ein altes Prinzip, das neben einer schnellen Montage noch einen weiteren Vorteil hat: Gegenüber einem Strickbau schwindet es weniger — das «Innenhaus» darf sich gegenüber der steinernen Hülle nicht verändern. Ein Zimmer nimmt jeweils zwei Felder des Balkenrasters ein. Der Raum spannt sich zwischen Treppenhaus und Aussenwand, zwischen Eingangstür und Fenster, darin eine Kommode mit Sekretär, Sessel und Stehleuchte.
Zwei dicke Stützen und ein tiefer Unterzug trennen die Nische ab, in der das Bett steht. Die metallisch glänzenden Wände des Bades erinnern an die Schimmer-Landschaft vor der Tür. Die unbehandelte Fichte der Zimmerwände, Decken, Böden und Möbel duften nach dem Wald, der draussen nicht steht.
Aus dem Fundus
Ein einfaches Gasthaus hatte sich die Stiftung mit Blick auf die Geschichte des Hauses gewünscht. Aber eines, das gleichzeitig den Komforterwartungen heutiger Gäste Rechnung trägt — eine Aufgabe, der sich Miller & Maranta nicht zum ersten Mal widmen. Die schlichten Fichtenbetten im Alten Hospiz erinnern an diejenigen des Wohnturms der Villa Garbald im Bergell, die beiden Stuben erhellen Stehleuchten, von den Architekten für das Hotel Waldhaus in Sils-Maria entworfen. Ihr Tisch in der kleineren Stube lädt mit Eckbank zum Jassen ein, die grössere heizt ein Specksteinofen wie seit hundert Jahren. Bilder aus dem Fundus des St. Gotthard Museums hängen an den dunklen Kalkputzwänden, tagsüber schmückt sie der Ausblick aus den gedrungenen Fenstern. Es ist die verhaltene Pracht dieser Rundbogenfenster, die nun wieder das Innere des Hauses prägt, eine vom rauen Bergklima in Zaum gehaltene Kultiviertheit. Aussen lassen eine kaum sichtbare Naht im groben Kalkputz und die Fenster der Giebelfassade den letzten «Wuchs» des Hauses erahnen. Über den restaurierten Kastenfenstern der ersten beiden Etagen sitzen zwei Reihen neue, minimal grössere mit Doppelverglasung, aber noch mit Mittelsprosse. Den Abschluss macht eine grosse Öffnung mit nur einem Glasfeld und kündet vom spektakulären Raum dahinter, der sich bis unter den First öffnet. Der gehört zur «Suite», doch passt weder Name noch Nutzung. Für diesen Raum und Ort wünscht man sich ein rechtes Massenlager.
Das Alte Hospiz ist wiederbelebt, seine Zeitschichten zu einem neuen, ebenso stimmungsvollen wie stimmigen Ganzen verschliffen. Das ist den Architekten, der Bauherrschaft und der Denkmalpflege hoch anzurechnen, denn ein solcher Umgang mit dem Vorhandenen ist keineswegs selbstverständlich. Dieser Umgang ist ein Erbe der «Analogen Schule», die ihren Schülern Berührungsmut gegenüber Traditionen, Stimmungen und Atmosphären einimpfte. Nach zwei Jahrzehnten brauchte es aber auch den Mut der Architekten, sich auf ihre eigene Tradition einzulassen. Danke dafür
Kommentar „Weltoffener St. Gotthard“
Eine Passage der Multimediaschau im Passmuseum könnte von Roger Köppel, dem Verleger der Weltwoche, geschrieben sein: «Freiheit und Wohlstand muss man gegen viele Neider verteidigen.» Dieser Spruch, der die kulturelle Lufthoheit über den Mythos Gotthard auf Seiten der Nationalisten halten will, ist eine unzulässige Verdrehung von Tatsachen und Geschichten. Der St. Gotthard ist Ort und Symbol, an dem «Freiheit und Wohlstand» geteilt wurden und werden. Die ruhmreiche Geschichte vom Säumerweg bis zur Autobahn erzählt, wie Wohlstand gemehrt und Freiheiten hergestellt werden — zugunsten unsere hehren Bergler-Ahnen von Tell bis Guisan. Wenn in ein paar Jahren die Neat unter dem Pass hindurchfährt, wird hier nicht mehr das Herz der Schweizer Freiheit schlagen, sondern dasjenige des europäischen Transportwesens. Welch weltoffenes Teilen! Und die Menschen aus Portugal, Osteuropa, Spanien und Italien, die die Wurst-Rösti-Bier-Wirtschaft auf dem Pass gewährleisten, teilen ihre Freiheit mit dem Gotthard, auf dass er gastronomisch überhaupt funktioniert — und den Besitzern Wohlstand bringt. Also sieht es die blaue, frisch vom Bundesamt für Kultur am neuen Alten Hospiz angeschlagene Plakette richtig: «Europäisches Kulturerbe. Stätte mit grenzüberschreitendem oder gesamt europäischem Charakter.» Öffnen, einladen, teilen statt «gegen die Neider verteidigen» — das strahlt die Architektur von Quintus Miller und Paola Maranta aus. Ihr Haus ist ein Begegnungsort, zwar trutzig, aber keine Trutzburg. Die heitere Stimmung im Innern wird Japanerinnen, Griechen und Türken ebenso gefallen wie den Schweizern. Dort kann das geteilt werden, von dem wir so viel haben: Freiheit und Wohlstand. Und die aufgeregten Nationalisten können gut Nachtlager nehmen in der zum Hotel «La Claustra» umgebauten Reduit-Festung von San Carlo oder in der neuen Kaserne von Airolo. [Köbi Gantenbein]
Eine Strasse bekennt Farbe
Knapkiewicz & Fickert machen mit zwei malerischen Wohnhäusern einen Verkehrskanal zum städtischen Raum. Und beenden so eine endlose Zürcher Planungsgeschichte.
«Erdbeer-Vanille», so werden die beiden neuen Häuser im Quartier, meist liebevoll, genannt. Unten ein kühles Rot, darüber ein grünliches Beige. Schauen wir uns die Fassade genauer an, entdecken wir die Feinheiten, wird aus der Eiscreme Architektur: Die Fenster der beiden unteren, roten Wohngeschosse sind breiter und unregelmässiger gesetzt als die der beiden hellen Etagen darüber.
Die untere Hälfte betont die Horizontale, die obere die Vertikale; unten Strasse, oben Himmel. Zwischen den beiden Farben liegt nicht nur die vom Maler gezogene Grenze, sondern ein beträchtlich breiterer Fenstersturz — unauffällige Zeichen hoher Könnerschaft.
Zwei schöne Häuser sind heutzutage schon selten. An einer solch schwierigen Lage sind sie ein grosser Wurf. Ihre Fassaden richten sich auf eine der Hauptausfallstrassen Zürichs, der Universitäts/ Winterthurerstrasse, die zwei Tramlinien und eine Buslinie mit sich entlang des Zürichbergs führt. Die beiden voneinander getrennten Grundstücke sind im Besitz der Stadt, die sie im Baurecht an die Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Zürich abgetreten hat. Lange schirmte man sich gegenüber solchen Strassen mit ihren Blechströmen einfach nur ab, errichtete Bollwerke, innen Nebenräume, aussen Schallschutzwände.
So auch beim Rigiplatz nebenan, der sich mit niedriger Wand, Gestrüpp und unbenutzten Bänken von der Strasse abwendet. Auf seiner nackten Fläche werden mal Velos, mal Weihnachtsbäume verkauft, ansonsten werfen die Designerleuchten lange Schatten.
Den Tischgruppen des «Alten Löwen» fehlt trotz des alten Kastaniendaches das Flair eines Biergartens. Das rund 200 Jahre alte Haus spielt in dieser Geschichte eine zentrale Rolle. Die beiden neuen Häuser auf seiner anderen Seite wenden sich der Strasse nicht ab. Sie nehmen sie als Stadtraum ernst, zeigen stolz ihre städtischen Fassaden und verbreitern mit Arkaden das Trottoir. Das eigentliche Zentrum von Zürich-Oberstrass, das namenlose Plätzchen vor Migros, Seilbahn Rigiblick und Apotheke, setzt sich nun jenseits von Strasse und Tramhaltestelle fort, auch in den neuen Läden des Erdgeschosses.
Gesicht zur Strasse
Das Innere der 19 Wohnungen und 4 Ateliers trägt dieser urbanen Haltung Rechnung: Wohnräume und Küchen blicken über raumhohe, vierfach verglaste Fenster lautlos auf die Strasse, die anderen Räume öffnen sich über spezielle Lüftungserker immer auch über die Kopfseiten der Häuser. Deren öffentliches Gesicht richtet sich zur Strasse, das genossenschaftliche Herz der Wohnungen aber schlägt auf der Rückseite. Dort löst sich die städtische Strenge auf, wird zum luftig sonnigen Wohnidyll mit atemberaubender Aussicht über Zürich.
Die offenen Treppenhäuser gehen in die Wohnungszugänge über, die gleichzeitig private Aussenräume mit Gartentor sind — urbane Anonymität ist da nicht gefragt, es sind Familienwohnungen, die mit den zuschaltbaren Ateliers im grossen Haus auch moderne Lebensentwürfe ermöglichen —nicht wunderlich, wohnen da viele Architekten.
«Erdbeer-Vanille» — noch vor zwölf Jahren gab man der geplanten Überbauung ganz andere Namen: «Plattenbau», «Schuhschachteln», «Dorferneuerungspolitik à la Ceausescu». Als 1998 die Architekten Kaschka Knapkiewicz und Axel Fickert den Wettbewerb am Rigiplatz gewannen, nahm eine bisher unerreichte Schmähkampagne ihren Anfang, mit dem Stadtzürcher Heimatschutz als Drahtzieher siehe «Unendliches Planen am Rigiplatz», Seite 40.
Der Grund: Ein drittes Gebäude der Architekten sollte den räudigen «Alten Löwen» ersetzen, durch den sich seit einigen Jahrzehnten das Trottoir bohrt und der so Gesicht und Adresse verlor. Die Neubaugegner erreichten, dass das alte Haus stehen blieb, zwei Biedermeierhäuser mussten jedoch weichen. Obwohl die beiden neuen Baukörper in ihren Grundzügen dem Wettbewerbsentwurf entsprechen, änderte sich in der Überarbeitung viel: Aus Bandfenstern wurden Lochfenster, aus rechtwinkligen Kuben wurden «weichere» Baukörper, die sich trotz ihrer Grösse an die kleinmassstäblichen Häuser nebenan schmiegen. Dafür sorgen vor allem eigenwillig geformte Anbauten, die sich dem Vorhandenen entgegenstrecken und sich über eine leichte Treppe sogar mit dem «Löwen» verbinden, um einer seiner Wohnungen als Terrasse zu dienen.
Mit sprechenden Details und Materialideen haben die Architekten ihre Häuser in die Umgebung «hineingemalt»: Die leicht geneigten und begrünten Satteldächer enden in Regenrinnen, die verzinkten Stäbe der Loggiengeländer «tanzen», und Sparrenköpfe tragen die Dachüberstände der kupfergedeckten Anbauten, auch wenn diese gar kein Sparrendach haben. «Unsere Häuser wachsen aus dem Milieu heraus», sagen die Architekten. Und: «Am Ende war uns der
Farbig und lustvoll
Die Architektur von Knapkiewicz & Fickert wird zusehends malerischer, das zeigen nicht nur ihre Häuser am Rigiplatz, sondern auch andere Projekte wie die Wohnüberbauung «Lokomotive» in Winterthur siehe HP 12 / 06. Ihre typologische Sicherheit beim Wohnungsbau paart sich mit einem immer breiter werdenden Spektrum stilistischer Möglichkeiten — Berührungsängste kennen sie kaum. Dass es dem Architektenpaar darum geht, ihre Bauten einzupassen, nicht jedoch zu verniedlichen, das zeigt die mächtige Betonstütze an der Rückseite des grossen Hauses: Sie steht frei vor den Loggien und macht die dortige Höhe von sieben Geschossen körperlich spürbar. Unmittelbar daneben malte der Künstler Franz Wanner ein Fresko, das die Baustelle des Hauses als eine Art Gründungsmythos zeigt. Kleine Landschaften schmücken die farbkräftigen Treppenhäuser. Die Irritation, die diese Kunstwerke auslösen, setzt sich im Innern der Wohnungen auf andere Art fort.
Lustvoll und augenzwinkernd kombinierten die Architekten da Materialien, um Allerweltslösungen zu vermeiden — das Budget war eng, und genossenschaftliche Bauherren sind nicht immer geschmackssicher. So schmücken honigfarbige Glasmosaike die Bäder und Tropenholzimitat die Küchenschranktüren — manche potenzielle Mieter konnten da gar nicht drüber lachen und sprangen ab, so hört man. Die Liste der Interessenten war trotzdem lang, denn neben Lage und Aussicht ist auch die räumliche Qualität hoch: Jeder der nur 2,40 Meter niedrigen Räume hat mindestens zwei Türen, auch die Bäder. So werden in der Wohnung viele Wege möglich, und eine relativ kleine Wohnung wirkt grösser.
Im Quartier sind die Schmährufe rar geworden. Vielleicht liegt es an der Bewohnerstruktur, die sich in den letzten Jahren aufgefrischt hat. Vielleicht liegt es am neuen Quartierladen, der Produkte aus der Region verkauft. Vielleicht liegt es aber auch an der Erscheinung der beiden Neubauten und daran, dass sie aus dem Hindernis und der Lärmquelle Strasse wieder einen Stadtraum gemacht haben. Heute hört man Sätze wie: «Die Häuser sind so schön, dass man zu Architekten wieder Vertrauen gewinnt.»
Wasser zähmen
Conzett und Zumthor bauen gemeinsam den neuen Hochwasserschutz in Vals. Und dem Dorf ein neues Wahrzeichen. Wasser zähmen
Regen und Schmelzwasser verwandelten den Dorfbach in einen reissenden Strom und liessen ihn schliesslich über die Ufer treten. Die Einwohner von Vals standen auf ihrem verwüsteten Dorfplatz und diskutierten, geschlossen in die USA auszuwandern. Dank kantonaler Hilfe blieben sie. Das war vor 142 Jahren. Im Juni 2010 feiern sie ihre neuen Hochwasserschutzbauten und mit ihnen ein neues Wahrzeichen, eine Brücke aus Stein. Ein Schülertheater spielt die historische Gemeindeversammlung auf dem Dorfplatz nach. Die Sonne scheint, der Valser Rhein plätschert, und es braucht schon viel Fantasie, die wuchtigen Mauern, die nicht weniger wuchtige Brücke und das Rinnsal darunter in einen Zusammenhang zu bringen.
Der Fluss
Jeder Valser erinnert sich an die Jahre, als der Rhein es besonders toll trieb. Mit Stausee, Mineralwasser und Therme brachte das Wasser den Wohlstand in die Gemeinde, es brachte aber auch immer wieder Leid. Und die Dorfbewohner reagierten. Nach dem Hochwasser von 1927 bauten sie die Dorfbrücke neu, ein schlichtes Stahlfachwerk, nach dem von 1954 kam die Staumauer, deren Rückhalt eine Katastrophe verhinderte, als 1987 die Regenmenge sogar jene von 1868 übertraf. Als 1999 abermals einige Häuser im Wasser standen, stattete die Gemeinde die Dorfbrücke mit einer Hebevorrichtung aus und gab Studien in Auftrag. Sie zeigten die prekäre Lage: Die Kirche und mit ihr der Dorfkern lagen in der Gefahrenzone. Damit mehr Wasser abfliessen kann, musste das Durchflussprofil des Flusses vergrössert werden. Das Projekt eines Ingenieurbüros schlug die technisch übliche Lösung vor, eine Erhöhung der seitlichen Dämme. Die Böschungen liefen bedrohlich weit in die Gärten hinein und rückten der ersten Häuserreihe auf den Leib. Die Valser protestierten, und der Gemeinderat stellte eine Begleitgruppe zusammen, die das Projekt Hochwasserschutz zur Dorftauglichkeit bringen sollte. In Gestaltungsfragen suchte die Gruppe, der auch der ehemalige Bündner Denkmalpfleger Diego Giovanoli angehörte, den Rat von Peter Zumthor und Jürg Conzett.
Die beiden schlugen vor, die vorhandenen Dämme durch Schutzmauern zu ergänzen, was die Gemeinde schliesslich annahm — nach einer «freundschaftlichen und harten Entscheidungsfindung», wie sich Giovanoli erinnert.
Die Mauern
Die neuen Mauern und die Brücke sind aus Valser Gneis, dem Stein, der etwas oberhalb des Dorfes aus dem Berg gebrochen wird. Er deckt die Dächer des Tales, und die Welt kennt ihn, seit Peter Zumthor daraus vor 14 Jahren seine Therme baute. 2006 begannen die Bauarbeiten der Schutzmauern. Zumthor, Conzett und Steinlieferant Truffer tüftelten ein günstiges Zurichten der Gneisbrocken aus. Ein paralleler Schnitt sorgte für eine einheitliche Breite und glatte Vorder- und Rückseiten, die grob belassenen Umrisse führten zu handbreiten, unregelmässigen Fugen. Als neues Rückgrat des Dorfes ragen die Mauern bis zu fünf Meter vom Boden des Flussbetts auf. Dorfauswärts verringern Wiesenböschungen die Höhe der Mauern, bis diese schliesslich in den Böschungen enden und das verbreiterte Bett nur noch von diesen gefasst wird. Statt wie bisher Erlen säumen nun neue Leuchten die für Vals wichtigen Spazierwege entlang des Wassers. Die von Peter Zumthor gestalteten, eleganten, dunklen Peitschen zeichnen zarte Lichtpunkte auf den Mergelboden.
Als Teil der Flussverbauung mussten drei neue Brücken her: eine neue Dorfbrücke, je eine kleinere flussauf- und flussabwärts. Conzetts Skizzen überzeugten die Berater, und die Gemeinde beauftragte ihn mit dem Bau aller drei Brücken. Die beiden kleineren bestehen aus je einem geraden Hohlkastenträger aus Cortenstahl mit Edelstahlgeländern und sind auch im Rollstuhl gut zu queren — das Altersheim liegt unmittelbar am Dammweg. Die obere Milchbrücke klappt im Fall der Fälle hydraulisch über die brausende Flut. Die Rovanadabrücke in der Nähe des Ortseingangs ersetzt zwei bestehende Betonbrücken und sitzt fest zwischen den neuen, etwas unsensibel angelegten Böschungen.
Die Hauptbrücke
Das Prunkstück ist die steinerne Brücke in der Mitte von Vals. Sie führt die Kantonsstrasse auf den Dorfplatz. Die geometrischen Bedingungen waren eng: Die steile Rampe zwischen Brücke und Platz sollte nicht noch steiler werden, gleichzeitig musste das Durchflussprofil der Brücke möglichst gross sein. Das sprach entweder für eine komplizierte Hubvorrichtung oder für eine Brücke, die schwer genug ist, den Wassermassen standzuhalten. Conzett baute die Brücke massiv aus Valser Stein, wie einst Zumthor seine Therme — wohlgemerkt: Bei beiden Bauten ist der Stein nicht bloss Verkleidung, er trägt. Eine Bogenbrücke legte das Material nahe. Der Ingenieur kreuzte sie mit einer Trogbrücke, um einen freien Durchfluss zu garantieren und das Wasser von der Strasse und dem Platz fernzuhalten. Die expressive Form, die sich daraus ergab, markiert nun den Ort des Übergangs.
Eine starke Form, doch erscheint die Brücke einfacher, als sie ist, geometrisch wie konstruktiv. Die beiden seitlichen Mauerscheiben sind zwar gleich und auch in sich symmetrisch, allerdings sind sie durch die schräge Lage der Brücke gegeneinander verschoben. Damit sich die Fahrbahnplatte dabei nur in eine Richtung wölbt, gab Conzett ihr die Form eines Zylinderausschnitts. Konstruktiv wollte er auf Klammern, Bügel oder Stangen verzichten, stattdessen Stein und Beton kraftschlüssig verbinden, miteinander verzahnen. Angeregt durch die Mauerkronen der Albulabahn-Viadukte mit ihren Konsolsteinen und Abdeckplatten ersann er eine leicht gewölbte und vorgespannte Betonplatte mit zwei seitlichen Reihen stehender, leicht konischer Betonbalken. Um diese herum schichteten die Arbeiter aus Steinplatten die flachen Bögen. Eine komplizierte Konstruktion: Die Fahrbahnplatte hängt mit den Betonbalken an den Bögen und übernimmt gleichzeitig mit Vorspannkabeln deren Zugkräfte.
Der Stein
Da die Steinplatten dasselbe Format haben wie jene der Therme, ist uns die Oberfläche vertraut. Das allerdings sei keine Marketing-Idee, so die Planer, sondern resultiere — ebenso wie die Steine der Mauer — aus einer möglichst ökonomischen Produktion, konkret aus einer Maschine des Steinbruchs, die aus einem Block mehrere Platten parallel sägt. Am unteren Rand der Mauerscheiben wird die Verzahnung von Stein und Beton zum gestalterischen Thema: Betonzinken und Pakete aus jeweils vier Steinplatten greifen ineinander. In den Mauerkronen bedecken quadratische Steinplatten die Köpfe der Betonbalken. Laut Conzett kostete die Steinkonstruktion nur 300 000 Franken mehr als andere Konstruktionen. Auch wenn der Tourismusverein «visitvals» die Brücke schon als neues Wahrzeichen feiert: Das Dorf empfängt die Brücke nicht nur mit offenen Armen, tat es nie. Viele Dorfbewohner zweifeln daran, dass sie sich im Alltag bewährt. Sie sei vom Auto aus schwer einsehbar, die gebuckelte Fahrbahn aus Stein würde schnell vereisen, ein Blick aufs Wasser sei nicht möglich. Eins jedoch ist sicher: Der Ort ist anders, seit es die Brücke gibt. Ihre elegant gefügte Schwere zeigt schön, worum es ihrem Erbauer geht: mit einer besonderen Konstruktion dem besonderen Ort eine Form zu geben. Ihre schräge Achse nimmt die Richtung der Kirche auf, deren Turm und schmuckloses Schiff den Dorfplatz von schräg hinten dominieren. Wer über den mit Stein belegten Brückenbuckel geht, durchschreitet überrascht einen Raum. Dieser blendet einen Teil der Umgebung einen Moment lang aus, fokussiert dafür einen anderen Teil. Nicht umsonst fand die Pressekonferenz zur Eröffnung der Brücke an einem Tisch mitten auf ihr statt. Ein Fragezeichen bleibt: Die Beziehung zwischen den Zyklopenmauern und der Dorfbrücke.
Zwar ist ein und dasselbe Material da rau, dort fein, da grob geschichtet, dort komplex gefügt, doch fehlt ein Übergang: Die beiden Massstäbe prallen unvermittelt aufeinander. Die gestapelten Steinkolosse der Mauer heben kurz vor den kunstvollen Bögen an, nehmen sie unverfroren in die Zange, statt sie als Verfeinerung ihrer selbst zu feiern. Die Brücke jedoch ist ein Kunstwerk, ist nun, zusammen mit der Kirche, das monumentale Bauwerk am Platz.
Beide, Brücke und Kirche, erzeugen eine Spannung, setzen den Raum dazwischen unter Strom. Mit selbstverständlichem Pathos erzählt uns das Brückenbauwerk aus Stein von der drohenden Gefahr des Wassers in Vals.
Von Vals nach Venedig mit Jürg Conzett
Interview: Axel Simon
Ende Monat öffnet die diesjährige Architekturbiennale in Venedig ihre Tore, vom 29. August bis 21. November). Das Bundesamt für Kultur beauftragte den Ingenieur Jürg Conzett (54) mit der Ausrichtung des Schweizer Beitrags. Bei einem Spaziergang entlang des Valser Rheins gab er Auskunft.
Ein Ingenieur vertritt die Schweiz an der Architekturbiennale?
Ich war überrascht und erfreut, als die Anfrage kam: Ingenieurbauten sind Teil der Architekturlandschaft!
Was wird uns im Schweizer Pavillon in den Giardini erwarten?
Bei der Frage, was stellen wir aus, war ich vollkommen frei. Eine Werkschau interessierte mich nicht. Das kennt man. Stattdessen mache ich zusammen mit dem Fotografen Martin Linsi eine Ausstellung mit dem Thema «Landschaft und Kunstbauten». Wir haben Brücken und andere technische Bauten in der Schweiz besucht, die mir persönlich etwas bedeuten. Zu den Fotos gibt es dann Texte von mir. Eine relativ konventionelle Ausstellung, aber keine kunsthistorische Einordnung. Ich möchte die Tradition der konstruierten Bauten aufzeigen und damit auch Stellung beziehen gegen den starken Designanteil im heutigen Brückenbau.
Haben Sie ein konkretes Beispiel einer ausgewählten Brücke?
Der Goldach-Viadukt aus den Sechzigerjahren ist eine schnörkellose Betonkonstruktion. Martin Linsi fotografiert langsam. Erst nach einer Weile bemerkst du viele Sachen: Die Pfeilerstellung als Rahmung der Landschaft, die ganzen Verhältnisse — das ist alles durchdacht. Da wurde nie gross drüber geschrieben, aber man merkt: Es ist ein wohlüberlegtes Bauwerk mit einem Landschaftsbezug. Das ist das Thema!
Gibt es einen zeitlichen Rahmen für die Auswahl?
Ich habe relativ wenige zeitgenössische Bauten ausgewählt, viele alte, bis zurück ins Mittelalter. Auch ein paar eigene Arbeiten sind reingerutscht, was aber nicht gross auffällt.
Was, glauben Sie, interessiert die internationale Architektenschaft an alten Schweizer Brückenbauwerken?
(lacht) Das ist das, was ich liefern kann: eine persönliche Sicht auf Bauten, die sonst nicht wahrgenommen werden. Ich hoffe, das, was einen persönlich packt, strahlt auch aus und stösst auf Interesse.
Block im Blockrand
Ein Architekt baut sich sein eigenes Büro. Nicht als Firmensitz, sondern als Experimentierfeld.
Manchem wird es wohl so gehen: Beim Spaziergang in Zürich-Wiedikon geht der Blick beiläufig durch eine Hofeinfahrt. Einige Schritte weiter hält man inne, geht zurück und betritt neugierig den Hof. Denn was der Spaziergänger sieht, ist alles andere als gewöhnlich: grosse Fenster, messerscharf gerahmt von dunklem Backstein und glattem Beton. Er assoziiert kraftvoll, elegant, grosszügig — Architektur! Schon der kleine Ausschnitt, den die Einfahrt freigibt, zeigt: Hinterhofmief sieht anders aus.
Starker Umbau
Das frische Haus ist das Architekturbüro von Roger Boltshauser. Dass es sich um einen Umbau handelt, ahnt man nicht, die alte Substanz ist an keiner Stelle mehr zu sehen. Das zweigeschossige Gewerbehaus wurde, wie viele andere Hofbauten im Zürcher Kreis 3, bereits zusammen mit den Wohnhäusern des Blockrandes gebaut. Das war Ende des 19. Jahrhunderts. Nach einem massiven Umbau mit Erweiterung wurde aus der damaligen Schreinerei 1978 ein Textilbetrieb, in den Neunzigerjahren zog das Institut für Individualpsychologie ein. Vor einigen Jahren wurde Roger Boltshauser auf das Gebäude aufmerksam und kaufte es. Er legte den Rohbau frei, baute ihn aus und umhüllte ihn. Die innere Raumstruktur veränderte er dabei nicht wesentlich: ein geräumiger Eingangsraum in der Mitte jedes der beiden Hauptgeschosse, drumherum Treppenhaus mit Sanitärkern und Büroräume, Letztere nun hinter grossen Schiebetüren. Die alten Fensteröffnungen fasste der Architekt paarweise zu je einer grossen zusammen, bei der einst angefügten Schicht schloss er die aufgelöste Fassade und im Eingangsbereich entfernte er einen Lift. «Es war ein chaotisches Flickwerk aus Beton, Stahlträgern und Backstein», sagt er, doch damit musste er arbeiten, nicht zuletzt aus Kostengründen. Ein Neubau hätte ausserdem von der jetzigen Baugrenze zurückweichen müssen.
Boltshausers Handschrift
Trotzdem: Wer Boltshausers bisherige Bauten kennt, der erkennt auch den Urheber des Hofhauses. Manche Elemente und Materialien wendet der Mittvierziger immer wieder an und variiert sie: Das Fenster mit den geschlossenen, seitlich in der Tiefe der Mauer liegenden Lüftungsflügeln findet sich auch beim Lehmhaus Rauch im vorarlbergischen Schlins, die inneren Glasbausteinwände des Treppenhauses erinnern an die Schulhauserweiterung in Zürich-Hirzenbach, die beiden kubischen Betonoberlichter an die Gerätehäuser der Sportanlage Sihlhölzli, ebenfalls in Zürich. Dem Architekten dienen diese Elemente als «Vokabeln», Teile der architektonischen Sprache, die je nach Anwendung und Zuordnung eine andere Aussage machen und nicht für jede Aufgabe neu erfunden werden müssen.
Raffinierte Feinheiten
Zum Beispiel gewichtet der Architekt mit wenigen Elementen die vier Fassaden: Dort, wo sich der Blockrand zwischen zwei Häusern öffnet, gelangt man zur Eingangsseite des Hauses, seiner Adresse. Die Klinkermauer ragt geschlossen auf, lediglich ein «Portal» sitzt in der mächtigen Fläche, mit der Eingangstüre und je einem oberen und einem unteren Fenster. Über die übrigen drei Seiten des Baukörpers laufen breite Betonbänder und rahmen die Fenster oben und unten. Dort, wo sich der knappe Hofraum etwas weitet und wo eine Palme und eine in Regenbogenfarben bemalte Rückfassade vom gewandelten Image des Hinterhofs erzählen, da bildet das Bürohaus so etwas wie seine Hauptfassade aus: Als symmetrische Einheit präsentieren sich hier die sechs Fenster, stolz und prächtig.
Und hier kann der Spaziergänger genügend weit zurücktreten, um die Feinheiten der Fassadenstruktur zu studieren. Denn, was man erst bei genauerem Hinsehen merkt: Die Fenster der beiden Etagen sind keineswegs gleich. Oben sind sie etwas schmaler, dafür höher, unten breiter und niedriger — es scheint, als werde das untere Geschoss durch das Gewicht des oberen gepresst. Auch das untere Betonband ist niedriger als das obere, das den Baukörper abschliesst.
Handgemachte Klinker
Der «gepresste» untere Teil weist darauf hin, dass der Boden der Erdgeschossräume einen halben Meter tiefer liegt als das Hofniveau. Es ist aber auch ein Hinweis auf die Interessen des Architekten, der viel über die Wirkung von Proportionen nachdenkt. Es liegt wohl an den Massen der Fassaden und ihrer «Feinjustierung», wie das Boltshauser nennt, weshalb das nicht allzu grosse Gebäude kraftvoller wirkt als seine hofrahmenden Nachbarn. Und es liegt am Material der Fassade, am schweren Klinker. Denn obwohl sich in der direkten Umgebung zahlreiche Ziegelfassaden finden lassen, auch berühmte, wie das Künstlerhaus an der Wuhrstrasse von Ernst Gisel aus den Fünfzigerjahren, ist das Fassadenmaterial hier ungewohnt.
Exotisch ist das «römische Format» des Ziegels, den Peter Zumthor für sein Kölner Museum in Dänemark von Hand fertigen lies, weshalb er «Kolumba-Ziegel» heisst. In Zürich kam nicht das hellgraue Original zum Einsatz, sondern ein schwarz-braunes, mehrfach gebranntes Modell, das dadurch rauer wirkt. Ausserdem liess Boltshauser den Wilden Verband nicht flächig verfugen, sondern mit vertieften Lagerfugen, damit die Verwerfungen der Steine stärker in Erscheinung treten. In der Horizontalen stossen die 53 Zentimeter langen und keine vier Zentimeter dünnen Klinker stumpf aneinander, was sie noch länger erscheinen lässt. Rund 9500 Stück von ihnen umhüllen das Haus.
Lehm im Innern
In der kraftvollen Schale steckt ein weicher Kern. Trotz klarer Formen, weiter Durchblicke und grosszügiger Flächen ist hier nichts nüchtern. Das scharfkantige Grau der Stahlfenster, Deckenleuchten, Treppengeländer oder Glasbausteine kontrastiert spannungsvoll mit erdigen Farbtönen und reichen, samtigen Oberflächen. Es ist, als betrete man das Versuchslabor eines Alchemisten. Wie bei vielen Projekten arbeitete Boltshauser auch hier mit dem Lehmbaupionier Martin Rauch zusammen siehe HP 12 / 09 «Massarbeit».
Ihr umfangreichstes Gemeinschaftswerk war bislang Rauchs eigenes Haus in Schlins, das fast zur Gänze aus Lehm besteht. Beim Zürcher Bürohaus konzentriert sich der Einsatz des Materials auf die Oberflächen der Innenräume: Acht Tonnen Lehm verarbeite Rauch zu Putzen, Spachtelungen, Fliesen, Waschbecken bis hin zur einfachen Farbe. Beim Spachtel bindet Kasein, also Quark, das Material. Er findet sich nicht nur an den vielen eingebauten Schrankelementen und Schiebetüren, sondern auch dunkel eingefärbt auf dem Boden. Metallpartikel im Spachtel oder Metallschienen unter dem 1,5 Zentimeter starken Putz lassen Magnete an den Wänden haften. Öl und Wachs machen die Oberflächen in den Nasszellen wasserabweisend. So manche Mischung feiert hier Premiere.
Auch die schwarzen Fliesen im Treppenhaus sind Schlinser Handarbeit und wären nicht bezahlbar, würden sich Boltshauser und Rauch nicht gegenseitig mit Arbeitsleistung bezahlen. Hinter der Eingangstür und auf dem oberen Podest empfängt ein «Teppich» aus ornamentierten Boden-platten die Besucher. Marta Rauch formte die Platten, das kubische Ornament zeichnete Sohn Sebastian. Die treppenbegleitende Stampflehmwand zeigt das Material in seiner ursprünglichsten Verarbeitungsform, wenn auch nur sechs Zentimeter dick und vorgehängt: Sie wurde in der Werkstatt hergestellt, zerschnitten und auf der Baustelle wieder zusammengefügt. Hier ist er zu sehen, der «Dreck», dessen Wandlungsformen überall im Haus schön und unaufdringlich glänzen.
«Räumlich tut die Wand gut», meint der Architekt. Doch auch aufs Raumklima wirken sich die Oberflächen aus: Bis zu 100 Liter Feuchtigkeit sollen sie pro Geschoss innert kürzester Zeit aufnehmen und wieder abgeben können. Bezüglich Grauer Energie und Rezyklierfähigkeit ist Lehm unübertroffen.
Stolz und Bürde
In Erd- und Obergeschoss arbeiten zurzeit bis zu 24 junge Architektinnen und Architekten an Bildschirmen und weissen Modellen. 35 können es werden, wenn auch das Untergeschoss ausgebaut sein wird. Bei 40 würde es knapp, sagt der Architekt. Sein Büro hat zu tun, projektiert öffentliche Häuser und Wohnbauten, zum Beispiel ein Wohnhochhaus in Zürich-Hirzenbach oder eine Siedlung in Winterthur-Wülflingen. Und es vergeht kaum ein Monat, in dem es nicht auf einem der vorderen Ränge eines Wettbewerbs landet.
Warum wurde der Architekt sein eigener Bauherr? In seinen alten, gemieteten Räumen habe er sich nicht mehr wohlgefühlt. «Ich verbringe viel Zeit im Büro und Räume inspirieren mich.» Das wenige Eigenkapital, das er hatte, hätte zwar kaum für den Kauf gereicht. Der frühere Besitzer kam ihm dann aber mit dem Preis etwas entgegen — die Situation des Jungarchitekten erinnerte ihn an seine eigene, als er einst mit seinem Textilbetrieb dort einzog. Das Bauen für sich selbst ist laut Boltshauser nicht nur Wohltat, sondern auch Bürde: Man stellt sich aus. Repräsentation spielte beim Haus aber nicht die Hauptrolle. «Es ging um unsere Befindlichkeit. Und wir wollten Dinge ausprobieren, Themen weiterentwickeln!»
Gleiten zum Brausen
Das Schloss Laufen, der Rheinfall und ein Lift: Ein sonderliches Trio in der Wunderlandschaft.
Schokolade, Kühe, Taschenmesser — im Souvenirshop wird schnell klar, dass man sich an einem der Hot-Spots des Schweizer Tourismus befindet: Schloss Laufen am Rheinfall. Das neue Besucherzentrum, in dem sich der Shop befindet, bemüht sich auch aussen eifrig um Swissness: Leicht verfremdete Schweizerkreuze perforieren seine rostige Schale, machen aus dem Haus mit altem Ziegeldach eine zeitgenössische «Box». Sie zeugt vom letzten Akt einer langen Geschichte. Schon im 16. Jahrhundert zog es die ersten Reisenden an den Rheinfall. Mitte des 19. Jahrhunderts kaufte ein Landschaftsmaler das Schloss, zu dessen Füssen die Wassermassen brausen. Er machte das Naturschauspiel fürs zahlende Publikum zugänglich und begründete damit den Massentourismus. Seitdem hat sich wenig verändert: Anreise per Reisebus, Hinabstiefeln in die Gischt, wieder hinauf, Souvenir, Reisebus, Tschüss.
Erster Wettbewerb
Der Hot-Spot kühlte in den letzten Jahren etwas ab. Die Besucherzahl schwand von rund 700 000 im Jahr 1966 auf unter 450 000. Und diejenigen, die kamen, liessen sich kaum mehr dazu bewegen, im Schloss zu speisen. Woher also sollte der Kanton Zürich, seit 1941 wieder Besitzer des Bauwerks, das Geld nehmen, um die dringenden Erneuerungen an Wegen und Bauten zu finanzieren? Der Ort musste attraktiver werden, sollte wieder mehr Menschen anlocken und sie vor allem dort länger verweilen lassen. Einen ersten Wettbewerb gewannen 2005 die Zürcher Architekten Leuppi & Schafroth: Die Erweiterung eines kleinen Personalhauses von 1960 zum Besucherzentrum mit Kasse, Imbiss, Shop, Toiletten und einem Saal.
Die Architekten verlängerten wie im Wettbewerb vorgeschlagen das Volumen des biederen Altbaus und umhüllten Alt wie Neu mit rostiger Stahlhaut. Vordächer am Kopf und zum seitlichen Vorplatz erscheinen wie hochgeklappt, lediglich ahnen lässt sich, was hinter den perforierten Blechen im Obergeschoss liegt: die aufgefrischte Fassade des Altbaus mit Lochfenstern und Klappläden sowie das verglaste Gesicht des «Rheinfallsaales». Der öffnet sich, schön und licht, bis unters Dach und wird von einem Strahlenkranz aus Schweizerkreuzen belichtet. Darüber raunt ein Filzbaldachin noch einmal: Swissness.
Zweiter Wettbewerb
Etwas mehr als ein Jahr nach dem ersten Studienauftrag folgte ein zweiter. Diesmal lud die kantonale Baudirektion vier Büros aus dem Bereich Ausstellung, Messedesign und Event ein, um ein «touristisches Inszenierungskonzept» für das Umfeld des Schlosses vorzuschlagen: Die Innen- und Aussenräume galt es zu bespielen, die Besucherströme zu lenken. Bellprat Associates gewannen mit farbig-lustvollen Bildern eines Abenteuerwegs vom Parkplatz zum Rheinfall: Vorbei am vor Ideen sprühenden Spielplatz «Sinnesgarten» und über den «Jahreszeitengarten» im Burggraben hinweg in den Schlosshof, durch ein neues Museum im Nordtrakt, über altem Weg und neuem Steg übers grausam wogende Wasser, wieder hinauf durch einen «Sinneswald» und durch einen Rolltreppentunnel zurück zum Schlosshof. Die Jury lobte die Dramaturgie dieser «Erweiterung des Live-Erlebnisses des Rheinfalls», räumte jedoch ein, das phantasievolle Konzept sei «vielerorts noch überinstrumentiert».
Die ausgeführte Schnittmenge
Dreieinhalb Jahr später lässt sich nun begutachten, was vom Konzept übrig blieb: Das «Historama» im Nordtrakt des Schlosses erzählt Geschichte und Geschichten: Wie in einer grossen Spieluhr erfährt der Besucher hier beispielsweise etwas zum Streit zwischen Industrievertretern, die den Rheinfall beseitigen wollten, und Naturbewunderern. Neu gesicherte Wege führen hinunter zu den traditionellen Aussichtspunkten «Belvedere» und «Känzeli». Über einen Holzsteg, der sich zackig um den Burgfelsen legt, gelangt man schliesslich zu einem frei stehenden Liftturm, schon im Wettbewerb als Alternative zu den Rolltreppen vorgeschlagen, der mit spektakulärer Aussicht zum Burghof hochsaust. Der Weg zum Rheinfall wurde so behindertengängig und zu einem Rundgang geschlossen.
Von einer grossartigen Inszenierung des «Live-Erlebnisses» ist heute — glücklicherweise — wenig zu spüren. Die Mittel sind klassischer, also räumlicher Art: Geht man entlang des geflickten Bruchsteinwegs, steuert der neu gepflanzte Hangbewuchs die Wahrnehmung des wogenden Naturschauspiels. Geäst legt sich dem Blick in den Weg oder gibt ihn an ausgewählten Punkten frei — ein vertikaler Landschaftsgarten, dessen Qualitäten nun wieder erkennbar sind.
Eichengeländer und Maschendraht geben neuen Halt auf diesem Gang in die brodelnde Tiefe. Tafeln mit Infos und alten Veduten begleiten ihn und lediglich ein paar Stahlgeräte, angetreten, «die Hörgewohnheiten zu verfremden», wirken reichlich hilflos gegenüber den brüllenden Wassermassen ein paar Meter tiefer. Die Exponate zeugen vom szenografischen Anspruch, der dem Naturschutz, vor allem aber dem knappen Budget zum Opfer gefallen ist — unerwartet teuer war die Sicherung des Felsens.
Die Reise in der dreiseitig verglasten Liftkabine macht aus der letzten Etappe des Wegs ein Erlebnis — sofern man auf der dem Rhein zugewandten Seite fährt und nicht mit Blick auf den Hang. Kein stolzes Ingenieurbauwerk haben sich die Gestalter vorgestellt, was auch die Denkmalpflege nicht erfreut hätte. An der Aussenseite eines massiven, aber zurückhaltenden Turms gleiten die beiden gläsernen Kabinen auf und ab — ein schmaler Betonsporn, der mit seiner graubraunen Schichtung das benachbarte Bruchsteinmauerwerk nachahmt. Auch ihn werden schon bald Moose und Flechten überwachsen.
Fragliche Zusammenhänge
Die Neuerungen rund um das Schloss Laufen rücken den Rheinfall wieder glücklich in den Fokus. Den Betrachter beschleicht jedoch ein mulmiges Gefühl. Was hat der Vorbereich des Besucherzentrums mit dem schön-schlichten Spielplatz am Schlossgraben zu tun? Was die Terrasse der neuen Erlebnisgastronomie mit dem sorgfältig rekonstruierten Schlosshof? Das «touristische Gesamtkonzept», wie der Kanton die zusammengewürfelten Ergebnisse beider Wettbewerbe nennt, verteilte die Zuständigkeiten: Die Architekten bauten das Besucherzentrum und fügten im Nordtrakt ein weiteres Treppenhaus ein, um ihn als «Historama» nutzbar zu machen.
Die Arbeit der Szenografen beschränkte sich nicht nur auf die Einrichtung des «Historamas», auf Exponate und Signaletik am Weg.
Sie entwarfen auch Lift und Steg und erneuerten die Wege. Für den abgespeckten Spielplatz, den Burghof und die Bepflanzung des Nordhangs zogen sie den Landschaftsarchitekten André Schmid bei.
Warum war ein solcher Spezialist bei den Wettbewerben nicht vorgeschrieben, obwohl der Ort ein Naturdenkmal von nationaler Bedeutung ist? Der Kanton begründet dies mit der intensiven Begleitung durch Denkmalpflege und Eidgenössischer Natur- und Heimatschutzkommission nach dem Wettbewerb. Fazit: Viele Hände waren hier am Werk. Eine gestalterisch steuernde Hand fehlte.
Der Kraftakt zum Wohlgefallen
«Seht her!», ist die architektonische Mitteilung des EPFL-Learning Centers in Lausanne. Der Umgang mit dem neuen Raumerlebnis will noch erlernt sein.
Der Raum des «Learning Centers» ist neu. Wir kennen keinen gleichartigen. Doch was wir zur Genüge kennen, sind die Mechanismen der «iconic buildings»: Der Auftraggeber bestellt bei einem «Stararchitekten» kein Gebäude, er bestellt globales Medieninteresse. Die gebauten Räume werden den visuellen Versprechungen, die schon zum Wettbewerb gemacht werden, nur selten gerecht. Patrick Aebischer, Neurologe und seit zehn Jahren Präsident der EPFL, macht aus seiner Strategie keinen Hehl. Spricht er vom Architekturwettbewerb, den er 2004 für das «Learning Center» initiierte, so fehlt ein Hinweis nie: dass sich unter den zwölf geladenen Architekturbüros fünf Pritzkerpreisträger befanden. Ein «Nobelpreis der Architektur» müsse her, da mit die EPFL internationale Forschergrössen nach Lausanne locken kann, die wiederum für den lang ersehnten «richtigen» Nobelpreis sorgen würden. Gewonnen haben den Wettbewerb die Japaner SANAA (Kazuyo Sejima und Ryue Nishi zawa) — keiner der Pritzkerpreisträger, aber ein Büro, das mit seinem Lausanner Werk diesem Preis einen grossen Schritt näher gekommen ist. So geht das Spiel namens «How to be a Star».
Rolex zahlt Mehrwert
Die globale Medienaufmerksamkeit gehörte also zum Programm und die Rechnung des EPFLPräsidenten ging auf: Das filigrane Modell des Siegerentwurfs betörte nicht nur die Jury, sondern auch die Chefetage von Rolex. Zusammen mit weiteren Sponsoren steuerte die Uhrenfirma 50 Millionen der 110 Millionen Franken Baukosten bei, weshalb der Bau nun offiziell den Namen «Rolex Learning Center» (RLC) trägt. Der Bund, als Betreiber der EPFL, bezahlte mit 60 Millionen ungefähr so viel, wie ein konventioneller Bau kosten würde.
Den üppigen Raum und die aufwendige Konstruktion zahlen also die Sponsoren, und somit trägt sich die mediale Aufmerksamkeit selbst. Das RLC ist jedoch nicht nur das neue mediale Gesicht der EPFL. Es ist auch eine wissenschaftliche Bibliothek mit 500 000 Bänden (ein Viertel davon im Hauptgeschoss, der Rest im Untergeschoss zugänglich) und 700 Arbeitsplätzen, mit Büros und Archiven, mit Räumen des Hochschulverlags und von Craft, einem Labor, das neue Lerntechnologien erforscht und zukünftig direkt im RLC testen will.
Neben dem Auditorium locken ein Restaurant, Cafés und eine Buchhandlung mit Kiosk auch Auswärtige auf den Campus. Das Haus will nicht nur die kreative Zusammenarbeit der Disziplinen fördern, sondern es soll auch der Ort sein, an dem die Hochschule ihre Gäste empfängt. Ineinanderfliessende Räume des Austauschs und des Treffens, von sieben Uhr früh bis Mitternacht geöffnet. Kann die gebaute Realität diesen Erwartungen überhaupt gerecht werden? Und ihrem medialen Bild?
Schwächen und Stärken
Der erste Plan des Campus ist von Zweifel, Strickler und Partner und stammt aus den Siebzigerjahren. Der rund 170 auf 120 Meter grosse, flache Neubau breitet sich südlich seiner strukturalistischen Vorgänger aus. Dort beansprucht der eingeschossige Solitär einen Grossteil der Landreserve der Hochschule siehe HP 4 / 07. Von der Metrostation im Norden müssen sich Ortsunkundige ihren Weg durch das ineinandergreifende Flickwerk der bisherigen drei Bauetappen bahnen. Das Haus, über das momentan die Welt spricht, erscheint zunächst überraschend plump. Der Schwung, mit dem sich das einzige Geschoss noch im Wettbewerbsmodell hoch und nieder wölbte, ist, um den Faktor 500 vergrössert, weitaus weniger betörend. Der reizvolle Blick von weit oben, der schon einige Beschreibende zu Käseanalogien verführt hat, bleibt Hobbyfliegern vorbehalten. Die Stärken des RLC zeigen sich auf dem Weg zum Eingang, der überraschenderweise im Zentrum des Gebäudes liegt.
Der Besucher schreitet durch weite Gewölbe aus speckig glänzendem Beton, deren Leichtigkeit vergessen macht, dass man sich unter dem Gebäude befindet. Der Kraftakt, der notwendig war, solch stützenfreie Räume zu schaffen, löst sich auf in Wohlgefallen. Dass die Hügellandschaft aus Beton eigentlich eine aus Stahl ist und ihre Errichtung eine komplexe Ingenieurleistung, berichtete Hochparterre bereits bei einem Baustellenbesuch vor bald zwei Jahren siehe HP 10 / 08: Fünf Zentimeter dicke Zugstangen in der Kellerdecke hindern die Betonschalen daran, nachzugeben. Der Stahlanteil im Beton ist fünfmal höher als üblich. Im Innern wellt sich der eine grosse Raum in weiten Bögen. Bei einer lichten Höhe von bis zu 4,5 Metern steigt er, sinkt wieder, um sich erneut in voller Breite hinaufzuwölben. Elf unterschiedlich grosse Patios durchstanzen Dach und Boden und teilen die Raumlandschaft in helle und dunklere Zonen. Die Höfe ermöglichen den Blick durch und über das Dach, vom «Hügel» am einen Ende des Raumes bis zum «Tal» am anderen. Aber auch hinaus: in die ruhigen Kieshöfe, hinüber zu den alten Hochschulbauten, bis auf die schneebedeckten Alpengipfel jenseits des Lac Léman.
Gestraffte Ausführung
Ein Blick auf den Grundriss zeigt, was sich zwischen Wettbewerbsentwurf und Bau verändert hat. Der Plan wirkt straffer, aufgeräumter, ohne an exotischer Wunderlichkeit verloren zu haben.
Manche Zeichenkürzel müssen selbst erfahrene Planleserinnen erst deuten. Die Patios, an Luftblasen unter einer Eisfläche erinnernd, sind jedoch generell kleiner geworden — die Armierungseisen brauchten Platz. Viele kleine Höfe wurden gestrichen. Weitere blasenartige Formen umschreiben als raumhohe Glaswände Besprechungszellen oder als nach oben offene Gipskartonboxen-Büroräume. Die «Hügellandschaft» ist folgerichtig mit Höhenlinien dargestellt. Im Wettbewerbsplan waren auf den «Hängen» noch Tische und Stühle verteilt, die finden sich nun konzentrierter auf Zonen in den «Talböden» oder liegen erhöht auf Podesten, die hier und da eine «Kuppe» vergrössern. Waren einst die nach oben führenden Wege mit Strichelchen nur zart angedeutet, verbinden sie nun, als markante und raumbestimmende Rampen, im Zickzack die wichtigsten Orte miteinander, unterstützt von drei Schrägliften. Die von SANAA bevorzugte Farbpalette bestimmt auch ihr Werk in Lausanne: weisser Akustikputz an der Decke, weiss gestrichene Einbauten aus Gips und ein durchgehender hellgrauer Nadelfilzteppich am Boden. Materialsinnlichkeit ist nicht ihr Thema.
Es gäbe viele Einsparungswunden, in die ein Kritiker seine Finger legen könnte. Zum Beispiel die groben Rafflamellen des Sonnenschutzes oder die facettierten Glaskurven der Besprechungszellen. Dagegen zeigen die gerundeten Scheiben beim Eingang der Lounge der Credit Suisse — ein weiterer Sponsor —, wie es geht, wenn man Geld hat.
Dass das RLC für Behinderte nicht nutzbar sei, bewegte die Gemüter schon früh. Gegen das Baugesuch reichten Behindertenverbände Einsprache ein und forderten, das öffentlichste Gebäude einer Hochschule müsse in der heutigen Zeit behindertengerecht gebaut werden. Die EPFL und die Verbände setzten eine Vereinbarung auf und passten das Projekt an. Die wichtigen Orte sind nun sämtlich über horizontale oder flach geneigte Ebenen erreichbar. Neben den Rampen und Aufzügen für Mobilitätsbehinderte zerschneiden Leitlinien für Sehbehinderte die Nadelfilzfläche.
Raumerlebnis nicht für alle
Ein Eingriff ist aber grundlegend: In der Vereinbarung verpflichtet sich die Hochschule, die schrägen Flächen, die für Rollstuhlfahrer zu steil sind, unzugänglich zu machen. Hierfür seien Elemente in der Formensprache des Projekts vorzusehen, genannt werden zum Beispiel Trennwände oder Pflanzen. Bei der Inbetriebnahme am 22. Februar standen sie noch nicht. Sie sich vorzustellen, fällt schwer, sind es doch gerade die fliessende Offenheit des Raums, die überraschenden Wege, von denen das Haus lebt. EPFLSprecher Nicholas Henchoz bestätigt, dass man über geeignete Abtrennungen nachdenke, um eine Gleichberechtigung herzustellen. Die an der Hochschule beschäftigten Gehbehinderten fühlten sich ausgeschlossen, weil sie bestimmte Wege nicht nutzen könnten.
Aber, so betont Henchoz, es brauche Zeit, um den Umgang mit diesem neuartigen Raum zu erlernen, das betreffe auch die Behinderten. Die offizielle Eröffnungsveranstaltung habe man auch daher erst für Ende Mai geplant.
Raum braucht Beinkraft
Die Studenten und die Mitarbeiter der Hochschule haben ihr neues Haus in Besitz genommen. Der Ansturm an den ersten Tagen war ebenso gross wie die Neugierde. Die Studierenden werden sich kaum an irgendwelche Absperrungen halten. Zu reizvoll ist der Gang über die Hügel, das Erlebnis, diese ungewohnte Indoor-Landschaft zu erkunden. Der Raum — und das ist die grosse Überraschung — funktioniert im Gebrauch besser als auf den Fotos. Die Raumlandschaft ist physisch, sie verlangt vom Nutzer körperlichen Einsatz. Man spürt seine Waden, wenn man länger auf einer der schrägen Flächen steht — zur Unterhaltung setzt man sich einfach auf den Boden oder lehnt zurück und geniesst die Übersicht. Es ist schade, dass Menschen im Rollstuhl diese Erfahrungen nicht machen können. Schaut man jedoch auf die enorme Kraft und Neuartigkeit dieses Raumes, kommen einem kaum Restriktionen in den Sinn, sondern Möglichkeiten: Die junge Generation nimmt die «Hügel» in Besitz, erfindet im grossen offenen Raum, in dem nichts im Verborgenen geschieht, neue Formen der Begegnung, der Bewegung, der Solidarität. Und bezieht Behinderte dabei selbstverständlich mit ein. Hoffentlich bleibt das kein blosses Bild.
«Das Gebäude erzeugt Behinderungen»
Für die Schweizer Behindertenverbände ist das Learning Center diskriminierend. Sie reichten Ein Sprache ein und setzten zahlreiche Anpassungen durch. Hochparterre sprach mit Joe Manser, dem Geschäftsführer der Fachstelle für Behindertengerechtes Bauen.
Wie beurteilen Sie das neue Learning Center der EPFL?
Das Gebäude ist nicht nachhaltig, weder in ökologischer, ökonomischer, noch in sozialer Hinsicht. Das Raumprogramm hätte man mit der Hälfte des Volumens und Geldes bauen können. Für Menschen mit einer Seh- oder Gehbehinderung ist das Gebäude schwer nutzbar. Die steilen Schrägen und weiten Distanzen sowie die komplexe Orientierung erzeugen Behinderungen bei der Nutzung.
Während dem Bewilligungsverfahren hat die Fach stelle mit anderen Behindertenorganisationen Einsprache eingereicht. Mit welchem Ergebnis?
Der Bau ist ein Flickwerk, wie wir es von einem bestehenden Gebäude kennen, nicht von einem Neubau. Die mäandrierenden Rampen und langsamen Schräglifte werden Mobilitätsbehinderten keine gleichwertige Nutzung ermöglichen. Sie brauchen täglich mehr Kraft und Zeit, um beispielsweise ins Café zu kommen.
Hat die EPFL neben diesen baulichen Anpassungen auch mit veränderten Nutzungen auf Ihre Einwände reagiert?
Der Entwurf sieht eine Hügellandschaft vor, über die man kreuz und quer gehen kann — was für einen «Modulor-Menschen » auch stimmt. Auf den Vorwurf der Diskriminierung sagte die EPFL: Die wichtigen Verbindungswege sind auch für Behinderte möglich, mit Lift oder Rampe, der Rest, also alle anderen Schrägen, sei sowieso nicht begehbar. Die Frage, mit welchen Mitteln das umgesetzt wird, blieb offen.
Wenn diese Absperrungen nun den Charakter des Raums zerstören, was sagen Sie dann?
Ich sage: Der Vorschlag kam nicht von uns.
Ist die Einschränkung aller besser als die Benachteiligung weniger?
Das ist eine grundsätzliche Frage: Dürfen Diskriminierungen aus rein gestalterischen Gründen legitimiert werden? Ich hatte den Eindruck, schon die Jury ging mit dem Thema Behindertengerechtigkeit nachlässig um. Es ist Mode geworden, dass man sich in einem Gebäude nicht nur horizontal bewegt. Das mag für eine Expo oder ein Museum in Ordnung sein, aber hier geht es um das tägliche Leben, um die für behinderte Menschen besonders wichtige Ausbildung. Gerade für eine Ausbildungsstätte wird hier ein völlig falsches Zeichen gesetzt.
Wie viel Prozent der EPFL-Studenten und Mitarbeiter sind behindert
Das ist irrelevant. Menschenrechtlich gesehen ist egal, ob Sie einen Menschen diskriminieren oder viele.
[Joe A. Manser, Architekt, Geschäftsführer Schweizerische Fachstelle für Behindertengerechtes Bauen.]
Genial oder banal?
Das neue Schulhaus Leutschenbach spaltet die Architekturkritiker. Sechs kontroverse Meinungen zum Bau von Christian Kerez.
Es ist das zweitgrösste Schulhaus der Stadt Zürich und von der Kindergärtlerin bis zum Sekschüler gehen hier alle ein und aus. Der Bau dauerte ein Jahr länger als vorgesehen. Die Erscheinung ist für ein Schulhaus so ungewöhnlich, dass sie polarisieren muss. Seit August ist das Schulhaus Leutschenbach nun in Betrieb und Hochparterres Redaktorinnen und Redaktoren besichtigten es mit dem Architekten Christian Kerez.
Die Heiligsprechung des Banalen
Ivo Bösch: Die Jury traute dem Entwurf von Christian Kerez nicht zu, dass er baubar ist. Im Wettbewerb aus dem Jahr 2003 liess sie zwei Projekte überarbeiten. Zwar gefielen damals die Zonen zwischen den Schulzimmern. Doch dieser Bereich war Fluchtweg, also nicht nutzbar. Erst nach der Überarbeitung schlug Kerez die Fluchtbalkone vor. Der Feuerpolizist entwarf also beträchtlich mit. Eine Turnhalle auf dem Dach, eine Doppeltreppe, aneinander gereihte, hohe Schulzimmer und eine stützenfreie Fassade im Erdgeschoss: Mehr steckt nicht im Entwurf. Der Kern des Projekts ist die Konstruktion.
Das Haus steht nur auf sechs Dreifachstützen. Für den Handstand auf dem kleinen Finger scheute der Architekt keine Kosten. Doch bestimmte der Bauingenieur, wo welche Querschnitte welche Lasten tragen. Was Kerez mit dem kompakten Entwurf gewinnt, verliert er mit dieser Konstruktion. Obwohl beim Ausbau gespart wurde und obwohl es die zweitgrösste Schule der Stadt Zürich ist, ist der Bau im Kubikmetervergleich (BKP 1– 9: CHF 1108.–/m3, Stand August 2009) eines der teuersten Schulhäuser. Schon die Jury schrieb nach der ersten Stufe: «Die durch die kompakte Gebäudeform gegebene Ausgangslage für eine günstige Ökonomie wird durch zu erwartende erhöhte konstruktive Aufwendungen gemindert.» Dass diese Aufwendungen so gross werden und der Ausbau so leiden musste, konnte sie nicht voraussehen: Wände aus Industrieglas, in den Schulgeschossen Kunststeinplatten am Boden, sichtbare PE-Abwasserleitungen. Alles wirkt banal, Kerez würde es reduziert nennen. Glück für ihn, dass das Schulhaus in Schwamendingen steht und die Stadt endlich ein Signal für die Quartierentwicklung neben der Kehrichtverbrennungsanlage setzen musste.
Alles schrumpft
Roderick Hönig: 1994 stellte Pipilotti Rist im Kunstmuseum St. Gallen zwei überdimensionale Fernsehsessel neben eine meterhohe Stehlampe. Wer versuchte, die gigantischen, kaum handhabbaren Möbel zu besteigen, lernte physisch seine Lektion in Raumwahrnehmung. Die drei ungewöhnlich hohen Klassenzimmergeschosse erinnern an Rists Installation. Nur ists im Schulhaus Leutschenbach umgekehrt: Die Räume sind überdurchschnittlich hoch — satte 3,6 Meter, das Minimum schreibt 3 Meter vor. Die Überhöhe verleiht weiten Atem und Grosszügigkeit und lässt, wie in Rists Arbeit, Schülerin und Lehrer auf Kindergrösse «schrumpfen ». Die Architektur stellt so die Machtverhältnisse im Schulhaus in Frage, sie demokratisiert Subjekt und Objekt. Kerez sichert mit seinen überhohen Klassenzimmern und Pausenhallen aber auch die Souveränität seines Werks. Die Überhöhe sorgt dafür, dass Möblierung und Raum kaum in ein Verhältnis treten und dass man nicht plötzlich vor lauter Schulmöbel und farbigem Kinderleben Kerez’ «architecture brut» nicht mehr sieht. Elegant ist, dass der eitle Wunsch nach Wahrung der Reinheit der eigenen Architektur nicht auf Kosten der Nutzer geht — im Gegenteil: Die überdurchschnittliche Raumhöhe ist die Attraktion und Qualität des Schulhauses. Der Luxus, bezahlt auf Kosten des Ausbaus.
Die Paulista-Schule
Axel Simon: Wo ist da die Angemessenheit? Und was ist mit den hohen Kosten? Spätere Erweiterungsmöglichkeiten? Es gibt Bauwerke, an denen perlen solche Fragen ab. Radikalität imprägniert sie zum Manifest. In Leutschenbach steht man vor einem solchen, schaut einfach nur, blöd vor Staunen. Hier liegt Zürich nicht in der Schweiz, sondern am Rande São Paulos. Sicher, Kerez’ Konstruktionen sind komplizierter als diejenigen von Artigas, Bo Bardi oder Mendes da Rocha, die hiesigen Anforderungen sind es sowieso. Die räumliche Idee jedoch ist ähnlich: eine weite Landschaft rundum, die sich im Inneren widerspiegelt, sowie ein Raum, der mit zunehmender Schwere des Hauses an Leichtigkeit gewinnt. Die eidgenössische Komplexität der scheinbar einfachen Struktur überspielt der Architekt, indem er sich jede Oberflächengüte versagt. Der sichtbaren Stapelung der Etagen entsprechen der sichtbar gegossene Beton, der sichtbar geschweisste Stahl, das sichtbar gefügte Gussglas. Die Rohheit des Materials und der immense Raum machen aus der Schule eine Werkstatt, einen Ort, an dem man ohne die Bürde des Perfekten schaffen, sich ausbreiten, auf dem Trottinette durchjagen kann. Keine gebeugten Rücken, keine Schulkrüppel! Diese Forderung, die der spätere Bauhausdirektor Hannes Meyer 1926 seinem konstruktivistischen Petersschul-Entwurf beilegte, könnte auch auf den Leutschenbacher Beton gesprüht stehen — als Kunst am Bau versteht sich.
Ein starkes Stück
Werner Huber: Wie ein Equilibrist steht das Schulhaus auf der Wiese am Rand von Leutschenbach, scheint unter Hochspannung zu sein. Es berührt den Boden kaum, die Tragstruktur balanciert die Lasten der aufeinandergetürmten Nutzungen ohne das Gleichgewicht zu verlieren. Die gleiche Spannung ist im Innern zu spüren, auch wenn die Fachwerkträger nicht immer zu sehen sind und es nicht auf Anhieb klar ist, wie die Statik überhaupt funktioniert. Kräfte werden über Umwege spazieren geführt, bevor sie den Boden erreichen. Es wäre einfacher gegangen. Ein paar Stützen hier und da diskret platziert — wer würde den Unterschied schon sehen? Kaum jemand, doch spüren würde man ihn bestimmt.
Der Architekt ist seinen Weg konsequent gegangen und hat alles seinem Konzept untergeordnet. Das ist seine grosse Leistung. Die Betonoberflächen sind nicht perfekt, der Ausbau ist karg, konstruktive Ausnahmen gibt es zuhauf. An irgendeinem anderen Bau würde man das beklagen, hier ist das sekundär. Kerez hat die richtigen Prioritäten gesetzt. Nur im Erdgeschoss musste das Konzept vor der Nutzung zurücktreten — und prompt ist
es daneben geraten: Nie und nimmer dürfte es verglast sein.
Republikanisch geschärft
Benedikt Loderer: Zwei Gründe, warum ich das Schulhaus Leutschenbach gut finde: Es ist republikanisch und es ist geschärft. In Schwamendingen leben viele jener Leute, denen man eine bildungsferne Herkunft nachsagt und die ihre Kinder nicht vor allem zum Lernen anstacheln. Für sie baute die Stadt Zürich ein republikanisches Schulhaus. Es ist ein Versprechen. Nie, sagt die Stadt, werden wir vom Prinzip der allgemeinen und obligatorischen Volksschule abweichen. Wir wollen weder Kloster-, noch Koran- oder Eliteschulen. Vor der Schule ist jedes Kind gleich und wir geben keines auf. Wir bilden sie zu Zürchern. Wir bauen Integrationsschulen. Dort, wo die Kinder am schwierigsten sind, machen wir nicht weniger, sondern mehr. Wir sparen nicht an den Bedürftigen. Gut genug gibt es nicht, wo es ein Mehr braucht. Das Schulhaus repräsentiert den Bildungsanspruch der Stadt. Dieses republikanische Schul- und Selbstverständnis strahlt das neue Schulhaus aus. Das Konzept ist einfach: Kerez stapelt. Er setzt die Nutzungen nicht neben-, sondern schichtet sie übereinander. Den Rest des Grundstücks lässt er frei. Das Konzept überzeugte im Wettbewerb, doch dann begann die Arbeit. Es nahm die Hürden der Feuerpolizei, bewältigte das gerade geltende pädagogische Programm, überwand die Schwierigkeiten seiner eigenen Statik, besiegte den Kostendruck, kurz, es wurde verwirklicht.
Selbstverständlich sieht es heute anders aus als im Wettbewerb — aber nicht verwässert, sondern geschärft. Kerez ist einer der wenigen Architekten, die Konzessionen machen können, ohne Schaden an ihrem architektonischen Konzept zu nehmen. Er ist nicht stur, er ist nur konsequent. Er weiss: Wer alles verteidigt, verteidigt nichts. Und er weiss, was er aufgeben kann, um das zu behalten, was er unbedingt haben will. Selektives Wichtignehmen heisst diese Schärfungskunst. Kerez ist ein Meister darin.
Die Konsequenzen der Konsequenz
Rahel Marti: Christian Kerez will konsequente Architektur schaffen. Er kämpft für die Reinheit der einen, einfachen Idee. Offenbar gelang es ihm, die Beteiligten für diese heroische Haltung zu gewinnen. Kerez stapelt, der Park soll frei bleiben. Er baut Glaswände, dazwischen soll Raum zum Lernen entstehen. Er will ein klares und rohes Schulhaus, in dem sich Schülerinnen und Lehrer entfalten. Paradoxerweise braucht es dafür ein komplexes Tragwerk und Bauarbeiten, die ein Jahr länger dauerten als geplant. Was aussieht wie eine strukturalistische Höchstleistung, ist eine Reihung von Ausnahmen und Kompromissen. Um etwa den Park ins Haus fliessen zu lassen — und dies bildlich, denn in der Tat gibt es ja eine Glasfassade —, ist das Gebäude an einer komplexen Fachwerkkonstruktion aufgehängt. Um die Reinheit dieser statischen Idee zu belassen, nimmt der Architekt verschiedenste Fachwerkdimensionen und damit verschiedenste Deckenfelder in Kauf, was zu zahllosen konstruktiven Anpassungen führt. Um den freien Grundriss in den Treppenhallen zu ermöglichen, sind breite, umlaufende Fluchtbalkone nötig. Damit hier keine Kinder herumrennen, werden sich Lehrerinnen und Lehrer Regeln ausdenken müssen. Um die Transluzenz des Industrieglases nicht zu stören, sind an den Wänden der Schulzimmer und der Turngarderoben nicht metallene Kleiderhaken montiert, sondern kleine, ab - bruchgefährdete Plastikhaken aufgeklebt. Die Konsequenz reicht soweit, dass Kerez auch Massnahmen durchsetzt, die mit pädagogischen Zielen nichts mehr zu tun haben. Etwa, dass keine Leuchten, dass nichts von den hohen Decken hängen darf, was aufwändige Betoneinlegearbeiten erforderte. Man wird sehen, denn nun muss sich das aussergewöhnliche Schulhaus bewähren. Sonst war die reine Idee architektonischer Selbstzweck und der Preis dafür hoch.
Von der Grau- zur Grünzone
Neubau Wohnsiedlung Werdwies in Zürich
Als Siedlung Bernerstrasse war sie ein sozialer Brennpunkt, dann entschloss sich die Stadt zur Radikalmaßnahme des Abrisses und für einen kompletten Neubau. Als Siedlung Werdwies ist sie heute ein Ort, an dem Familien sehr gut leben können. Und der frei und offen gestaltete Außenraum bereichert als neues Zentrum nicht nur die Siedlung, sondern wirkt sich positiv auf ein insgesamt nicht unproblematisches Quartier aus. Die neuen Wohnungen sind doppelt so groß wie die alten und beglücken preisbewusste Pragmatiker wie ästhetisch Anspruchsvolle gleichermaßen.
Eine wenig idyllische Bebauungsinsel im Norden der Stadt Zürich, gerahmt von Autobahn, Flusslauf, Klärwerk, Sport- und Parkplätzen. Diese »Insel« heißt Grünau und war bis vor Kurzem nur durch Unterführungen oder per Fallschirm zu erreichen. Der Filmemacher Fredi Murer hat der Siedlung Bernerstrasse, dem Kern der Grünau, 1979 ein Denkmal gesetzt. Nicht von ungefähr heißt der Film »Grauzone«: Trist war die 1959 billig hochgezogene Siedlung schon nach zwanzig Jahren. Weitere zwanzig Jahre später waren die Hausfassaden mit ihrem Ausschlag unzähliger Satellitenschüsseln nicht mehr grau, sondern schwarz und ihr Abriss beschlossene Sache. Der Zustand der 267 kleinen Wohnungen war schlecht, längst genügten sie heutigen Wohnansprüchen nicht mehr. Sie durch halb so viele, im Schnitt aber doppelt so große zu ersetzen, war das Ziel, ein weiteres die Aufwertung des gesamten Quartiers. Die sozial schwache Bewohnerschaft der ehemaligen Siedlung Bernerstrasse, die sich aus über dreißig verschiedenen Nationalitäten zusammensetzte, entlockte Politikern immer wieder das Reizwort Slum – eine sicherlich übertriebene Bezeichnung, doch fehlte eine ausgeglichene soziale Durchmischung, selbst innerhalb des Quartiers war die Siedlung ein stigmatisierter Ort. Nun sollte sie sein städtisches Zentrum werden.
Grösser, schöner, ökologischer
Zwar wurden in Zürich in den letzten Jahren bereits einige genossenschaftliche Siedlungen durch Neubauten ersetzt, doch niemals zuvor so viele gemeinnützige Wohnungen auf einen Schlag abgerissen wie an der Bernerstrasse. War der Ersatzneubau in dieser Stadt rund 25 Jahre lang tabu, so greift man heute mehr und mehr zu diesem radikalen Mittel – muss es sogar, denn die meisten Züricher Wohnungen kommen in die Jahre und sind zu kleinräumig für heutige Ansprüche an Wohnraum. Mit einzelnen Verbesserungen wie neuen Balkonen oder einer zusätzlichen Wärmedämmung hat man am Ende oft weder gute Architektur noch wird viel Geld gespart, darum baut man lieber ganz neu.
Doch der Abbruch bestehender Wohnhäuser geht nie ohne Widerstand und Kritik über die Bühne. Denn auch wenn es sich um keine Traumwohnlage handelt, haben sich über die Jahre Nachbarschaften gebildet und die Mieter sich in ihren oft sehr günstigen Verhältnissen eingerichtet, nicht anders an der Bernerstrasse. Denn im heutigen Zürich findet man kaum noch eine Dreizimmerwohnung für 600 Franken. Die Stadt reagierte auf diese schwierige Situation mit der Einrichtung eines Mieterbüros in der Grünau. Es half den 670 Bewohnern der alten Siedlung erfolgreich bei der Suche nach neuem Wohnraum, am Ende hatten die allermeisten eine Bleibe in Zürich gefunden. Warum nur wenige der ehemaligen Bewohner in die neue Siedlung zurückkehrten, hat seine Gründe: Den meisten waren die größeren Wohnungen einfach zu teuer, ansonsten regelte die Stadt als Vermieterin mit einem obligaten Bewerbungsverfahren die gewünschte neue Durchmischung der Bewohnerschaft.
Die Stadt als Hausbesetzerin
Während der mehrjährigen Übergangszeit von der Bekanntgabe des geplanten Abrisses bis zum Auszug der letzten Mieter im Januar 2004 wurde die Stadt zur Hausbesetzerin: Die frei werdenden Wohnungen überließ sie mehreren hundert Künstlern und Studenten zur Ateliernutzung. Die »Fuge«, »Europas grösste Künstlerkolonie«, wie die Presse vollmundig schrieb, verhinderte zwar eine Geisterstadt, Vandalismus und »echte« Hausbesetzungen, die Performances, Feuerwerke und durchbohrten Wände der Künstlerbesetzer stießen jedoch bei den verbliebenen Bewohnern in der Regel auf wenig Gegenliebe – sie hatten andere Probleme als sich mit Kunst zu beschäftigen.
Heute steht anstelle der Siedlung Bernerstrasse die Siedlung Werdwies, keine Grau-, sondern eine Grünzone mit frischer Architektur. Ihr Architekt, der heute Anfangvierziger Adrian Streich, gewann den an guten Vorschlägen nicht armen Wettbewerb 2002 und realisierte mit der Siedlung sein erstes großes Projekt. Mittlerweile gilt er als Fachmann für Wohnungsbau unter schwierigen Bedingungen. Seine statt der ehemals 267 nun auf 152 reduzierten, schönen Wohnungen in der Werdwies sind doppelt so groß wie in der Vorgängersiedlung – die meisten von ihnen weisen bei viereinhalb Zimmern 106 bis 112 Quadratmeter auf, die größten mit sechseinhalb Zimmern gar 154 Quadratmeter. Auch die Mieten haben sich verdoppelt, sind aber für Züricher Verhältnisse noch immer günstig, ein Drittel der Wohnungen wird zur angestrebten sozialen Durchmischung für weniger Verdienende subventioniert. Und Schöngeister können sich eines von 28 schallgedämmten Musikzimmern dazumieten.
Städtischer Raum statt Siedlungsraum
Die sieben neuen Häuser sind mit jeweils acht Geschossen alle gleich hoch. Sie besetzen in drei unterschiedlich großen Typen das Grundstück: Die vier kleinen Häuser öffnen den Raum der Siedlung in Richtung Quartier, das größte bildet wie ein Block den westlichen Schlusspunkt. In diesem Block sitzt über einem erdgeschossigen Supermarkt ein großer, offener Innenhof mit Laubengängen. Bei den mittelgroßen Baukörpern erschließt ein glasgedeckter Lichthof im Zentrum jeweils vier Wohnungen pro Geschoss, die kleinen Häuser sind zweispännig organisiert und besitzen ein Treppenhaus an der nördlichen Fassade – schon dieser Reichtum an verschiedenen Typen belebt den Raum dazwischen. In den hohen Erdgeschossen finden sich öffentliche und gemeinschaftliche Einrichtungen: neben dem Supermarkt ein Bistro, Kindergarten und Kinderkrippe sowie Fahrradräume und Waschküchen, die sich über große Fenster nach außen öffnen, zusätzlich – wie bei gemeinnützigen Siedlungen in der Schweiz üblich – ein Gemeinschaftsraum, außerdem Ateliers und drei Gewerberäume. Tiefe Loggien prägen die Fassaden – bei den kleinen Baukörpern auf der Südseite, bei den beiden größeren Typen im Osten und Westen – und vermitteln auch in den oberen Geschossen zwischen dem Außenraum der Siedlung und den privaten Räumen.
Dieser Außenraum umfließt die neuen Wohnblöcke, die keine definierte Vorder- und Rückseite haben. Bäume und »Rasenkissen« geben der offenen Fläche einen Rhythmus und schieben sich beim Durchschreiten der Anlage wie Kulissen vor die Häuser. Diesen Freiraum definierte der Landschaftsarchitekt André Müller als »städtischen Bewegungsraum« – das nahe Limmatufer dient dem gesamten Quartier als natürliche Grünfläche. Was innerhalb der Grünau fehlte, waren belebte Räume, städtische Räume. So geht der Asphalt der umgebenden Straßen und Gehsteige nahtlos in die Siedlung über, die Erdgeschossfassaden sind aus robustem Beton. In Gruppen gepflanzte Eschen und Erlen, aber auch Exoten wie Tulpenbäume wachsen in großen Baumscheiben aus dem Hartbelag. Mit Eisenträgern gefasst und Schotter gefüllt, funktionieren die Baumscheiben wie überdimensionierte Gullys: Das Regenwasser der gesamten Siedlung sammelt sich hier und wird versickert. Überhaupt war die Nachhaltigkeit ein wichtiges Thema: Die Häuser wurden zu achtzig Prozent aus recyceltem Material aus dem Abbruch der Siedlung gebaut, die Wohnungen genügen dem Schweizer Minergie-Standard. Die Konstruktion setzt sich zusammen aus einer tragenden Gebäudehülle in Ortbeton und Mauerwerk und einem tragenden Betonskelett im Inneren. Die meisten Wohnungs- und Zimmertrennwände sind nichttragend ausgeführt. Außer den Erdgeschossfassaden (zweischalig auch aus Beton) und den Loggien (selbsttragende Konstruktionen aus Betonelementen) besteht die Gebäudehülle aus einer verputzten Außenwärmedämmung mit mineralischem Aufbau.
Bürgerliche Vorbilder
Tritt man aus den drei unterschiedlichen Erschließungsräumen in eine Wohnung, steht man zunächst in einer großzügigen Eingangshalle mit Wandschränken, die bei Bedarf auch als Essraum dienen kann. Seitlich gruppieren sich gleichwertige Zimmer, der große Wohn- und Essraum wird von einer riesigen Loggia begleitet. Die Räume sind robust und einfach materialisiert, ihr Vorbild war jedoch der großzügige Zuschnitt bürgerlicher Häuser der Jahrhundertwende.
Die geschundene Grünau besitzt nun ein belebtes Quartierzentrum mit sieben stattlichen Häusern, gepflegten Rasenflächen, öffentlichen Einrichtungen und einem Brunnen des New Yorker Künstlers Ugo Rondinone als Treffpunkt. 500 Bewohner leben in Werdwies, davon die Hälfte Kinder, der Ausländeranteil liegt bei vierzig Prozent, hier wohnt der Gastarbeiter neben dem Chef eines bekannten Kunstbuchverlages. Nicht nur portugiesische, kosovarische oder Schweizer Flaggen schmücken hier die grünen Brüstungen der Balkone, auf jedem der sieben Häuser flattert außerdem eine große Fantasiefahne, installiert vom Genfer Künstler Frédéric Post. Wie eine Neugründung in Übersee liegt nun die Grünau-Insel inmitten von Autobahn, Flusslauf, Industrie und Sportplätzen. Eine neue Fußgängerbrücke führt auch hinüber. Die neue Architektur passt zu diesem Ort: Sie ist robust und pragmatisch, erfüllt aber auch die nicht geringen Ansprüche der Kreativen Zürichs.
Golf club, Sempachersee
Joseph Smolenicky realizes one of the first Analogue works.
With its most recent expansion, Golf Sempachersee near Lucerne became Switzerland’s largest golf course in terms of area. Driving up to the new clubhouse, architecture enthusiasts are reminded of an icon of Expressionist architecture: Erich Mendelsohn’s hat factory in Luckenwalde. Here too a massive „hat“ of a roof towers above an otherwise low body of a building. Initiates, however, also see another model: that of Analogue Architecture, a very influential theory developed in the 1980s by Fabio Reinhardt and his senior research assistant Miroslav Sik at ETH Zurich. The nostalgic gaze of the Analogues focused on architectural history and the homeland, rejecting the Modernism still predominating at that university. Hardly anything in the style of their designs, depicted in large oil-pastel paintings in great detail and gloomy tones, found its way into real life. This clubhouse by Joseph Smolenicky, first a student then an assistant of Reinhardt, can be regarded as one of the first built Analogue works.
The building enthroned high above Lake Sempach is expressive in appearance but was nevertheless conceived from the inside out. The shape of its ground plan is completely irregular, and the walls – painted a different colour on each side – lead a screen-like life of their own without right angles. They each run out from under the roof-hat’s brim and brace themselves against the slope with their slanted ends. These walls shape the rooms – half are reserved for club members, half are open to the public – around the large core. This contains the „back of house“, in particular the very spacious kitchen serving not only the two restaurants and a large, divisible hall, but also the conference room underneath, a total capacity of 450 guests. The roof-hat’s crown over the kitchen conceals the all the building services.
What a roof! The architect chose it because the client wanted the „atmosphere of a small Grand Hotel“. Although the building with its almost 60-metre length is not small, it is only one storey high, at least on the entrance side. Even so, the heightened silhouette lends, if not grandeur, at least power. The interior does justice to the pretensions of the sport of golf – in a very sporty style. Casual elegance is what you might call it in the world of fashion. Bold colours in good taste define the rooms; a lot of white-painted wood frames the surfaces and structures them, reading as joinery. Smoothness is nowhere to be found. The structures and patterns covering almost everything – such as the Oriental floral ornament in the red bar – pick up traditional motifs and bring them up to date with the help of furniture that changes from room to room. Backlighting the walls and ceilings of the restaurants and the lobby freshens and ennobles the familiar materials and forms, and accentuates the indoor surfaces vis à vis the fantastic view of the golf course, lake and mountains. There’s no denying that surfaces activated in this way seem oddly laboured, lose some of their substance, become visual background noise. Many an architect may not like that. Golfers, who have just spent hours on green expanses, maybe do.
A few hundred metres away from the clubhouse, the rectangular red wooden maintenance building, reprises the roof motif somewhat more calmly. Between the two is the low reception building which also houses a shop and the secretary’s office; this the architect merely altered. Linking all three is an asphalt path with very wide, white-painted borders curving dynamically across the green terrain. The path and the house bring many an image to mind – of the sea, wide open spaces, the New England of Edward Hopper – and not only on the splendid wooden veranda of the conference room. If there’s one thing this cheerful work by Joseph Smolenicky is not, it’s gloomy - in that respect it is miles away from its architect’s beginnings. According to Smolenicky, there is a common conception of a golf club and he wanted to sweep it away. He has succeeded. After this building, who can still say what a golf club should look like?
Hirzenbach School extension
Roger Boltshauser employs „precision adjustments“ in his extension to a 1950s school building.
Built between 1955 and 1965, the dormitory suburb of Zurich-Hirzenbach features point and slab high-rises and few low public buildings. At the time, the development was hailed by the city of Zurich for its exemplary architecture; today it is a social hot spot. The school in its midst was built by Charles Steinmann in 1959. Its buildings and grounds were badly in need of renovation and a competition was held for a new kindergarten and day care centre as well as a double gym and additional classrooms.
Although most people have trouble feeling any sympathy for the functionalist architecture of this suburban development and school, Roger Boltshauser managed to do so – and won the competition. His two annexes, north and south of the existing school building, pick up the strictly orthogonal alignment of the suburb and submit to its logic with their low forms. It is not through their height that these carefully calibrated public buildings stand out from the residential blocks, but through the very opposite: their horizontal spread.
The annexes took their cue not only from the suburban development but also from the architectural grammar of the existing school building. In the new buildings the concrete structural grid extends into the third dimension: deep concrete frames protruding slightly above ground level provide permanent sun protection and create a spatial transition between indoors and the unstructured outdoor space. Thanks to these storey-high brise-soleils, the building volumes appear almost to float.
A fond homage to the modernist district is also apparent in the large, box-shaped skylights which enlarge the rooms in a similar way to the brise-soleils and mould the incident light. They also shape the buildings’ flat exteriors, lending them a sculptural force and appearing to repeat the surrounding development in miniature on both rooftops. Thus the new architecture’s most striking elements – concrete grid and skylight boxes – echo the existing architecture and in so doing turn the deficiencies of functionalist planning into good architectural quality.
The aforementioned light management, the extension of space outwards and upwards together with the well-judged spatial proportions, give the interiors of these buildings their unexcited matter-of-factness. A wide variety of educational situations becomes possible in the kindergarten building, for instance, through the group rooms that can be added by means of sliding doors or through the fully usable hallways. The kindergarten’s small courtyard flows into a roofed-over play and entrance area which provides access to the kindergarten on the left and the day care centre on the right.
The entrance and the courtyard can be separated from one other by a sliding lattice gate. The use of such an ordinary grille at this most public part of the institution and not – as is customary nowadays – a CNC lasered, organoid, pixelated something-or-other, is typical of the overall architectural approach. The chief materials are exposed concrete and glass blocks, which are used both for the kindergarten building’s longitudinal facades and for internal walls. The other materials and their subdued palette of colours are also geared to a robust, everyday world: warm grey linoleum in the classrooms, reddish-brown asphalt tiles in the halls, dark grey synthetic stone sinks, greenish glass mosaics and an olive shade for the surfaces of cupboards and shelves enlivened by the merest traces of pale turquoise. Rather than anticipating the children’s presumably colourful everyday experience, these sober colours serve as a background for it.
In addition to the brise-soleils and the skylight boxes, there is one other design element that not only underscores the massiveness of the buildings but also has an impact on the atmosphere of the indoor spaces: the curtains by the artist Alex Herter. With their broad horizontal stripes in green/white, red/white or yellow/black they function as sunshades, screens or tent-like rooms within rooms. Depending on the colour combination, they suggest connections or create interesting spatial tensions.
On the three window facades of the gym – one-third of which is below ground level so that it appears to only two storeys high – curtains were dispensed with. In the concrete grid on the front of this building the windows bulge slightly outward, angling at the point where the casements and glazing meet. The glass mosaic-covered side walls of the brise-soleils are also slightly bevelled. The aim of such barely perceivable shifts, which the architect calls „precision adjustments“, is to make the attached concrete grid look as if it is an integral part of the building. And thus we gradually become aware of the source of these low buildings’ forceful appearance – not Hirzenbach after all, but works of architecture a few hundred years older.
9=12 IN WIEN
Neun international renommierte Architekturbüros haben in Wien eine Mustersiedlung gebaut. Der Masterplan stammt von Adolf Krischanitz, der selbst zwei Häuser realisiert und die anderen Teams eingeladen hat. Die Häuser tragen unverkennbar die Signatur ihrer Entwerfer – was zwar intendiert war, der formalen Einheit der Siedlung jedoch alles andere als förderlich ist.
Eine Mustersiedlung will Mustergültiges aufzeigen, Vorbild sein. Das war schon 1927 auf dem Stuttgarter Weissenhof so, und das hatte auch der Wiener Architekt Adolf Krischanitz im Sinn, als er im Jahr 2000 die Idee einer Siedlung lancierte, die dem verdichteten Wohnen an der Peripherie seiner Stadt neue Impulse geben sollte – wie die dortige Werkbundsiedlung von 1932, die Krischanitz in den 1980er-Jahren renoviert hatte, oder wie seine Siedlung Pilotengasse von 1987–92, bei der auch Herzog & de Meuron und der Münchner Otto Steidle mitgewirkt hatten. Letzteren und sieben weitere Kollegen lud Krischanitz nun wieder ein, in der neuen Siedlung im Westen Wiens ein Haus beizusteuern: Max Dudler und Hans Kollhoff aus Berlin, Meili Peter Architekten und Peter Märkli aus Zürich, Diener Diener aus Basel sowie Hermann Czech und Heinz Tesar aus Wien. Von Krischanitz selbst stammt nicht nur der Masterplan, sondern er hat auch zwei Häuser realisiert. Neun Architekten bauen zwölf Häuser – so kam man auf den sperrigen Namen «9=12 Neues Wohnen in Wien». Aus Sparmassnahmen wurde aus den drei kleinsten ein grosses Haus; die Landschaftsarchitektin Anna Detzlhofer machte aus der reinen Männergesellschaft schliesslich ein «10=10».
Zusammenarbeit mit der Industrie
Obwohl er früh den traditionellen Begriff «Villenkolonie» benutzte, peilte Krischanitz noch ein weiteres Ideal der klassischen Moderne an: die kreative Zusammenarbeit von Architekt und Industrie. Daher formierte er eine Projektgruppe mit Vertretern vor allem aus der Betonindustrie. Die beteiligten Firmen fi nanzierten die aufwändige Entwurfsphase, bei der die internationalen Architektenteams sich an mehreren Wochenenden in Wien trafen und in einer Art freundschaftlichem Wettstreit die Grundzüge der einzelnen Gebäude erarbeiteten – gemeinsam mit den Industrievertretern, was zu einem «gemeinsamen qualitativen Lernprozess zumNutzen der Architektur» führen sollte. Dieses Ideal findet sich in der fertigen Siedlung jedoch nur schwerlich wieder.
Die zehn Häuser stehen dicht aneinander gereiht auf dem leicht nach Süden abfallenden Grundstück in Wiens öder Peripherie inmitten von Kleingartenkolonien. Die Häuser bilden zwei Reihen, halten sich mit ihren unterschiedlichen Volumina jedoch kaum an eine gemeinsame Baulinie, sondern springen leicht vor und zurück. Zwischen den Reihen weiten sich die ansonsten engen gemeinschaftlichen Zwischenräume zu einem durchgehenden, grünen Aussenraum, durch dessen Mitte sich ein Weg schlängelt. Dieser dürfte von den meisten auch als Zugang zu ihrem Haus benutzt werden, denn er startet beim halb eingegrabenen Parkhaus am Fusse der Siedlung.
Variationen in Beton
Auch wenn Krischanitz nur befreundete Architekten eingeladen hat, mit ihm zu bauen, sind die einzelnen Häuser denkbar unterschiedlich ausgefallen – ein gesuchter Reichtum verschiedener Haltungen, durchaus auch geprägt von den jeweiligen Baukulturen der drei vertretenen Länder. Beton taucht als Fassadenmaterial in unterschiedlichster Ausprägung auf: als Fertigteile bei Dudler, als Echo handwerklicherer Schalungstechniken bei Diener, als leicht schräge Fläche bei Tesar oder als Bodenplatten, die sich als Balken abzeichnen, bei Märkli. Nur Meili Peter entwickelten nahezu avantgardistischen Ehrgeiz: Ihre Fassadenwurden vor Ort aus normalem und gelblich eingefärbtem Beton gegossen, wobei die Flächen ineinander greifen. Das technisch komplizierte und teure Verfahren führte allerdings zu einem Ergebnis, das man – vor dem Hintergrund mehrerer gnadenloser Einsparungsrunden, unter denen die Ausführung und die Ausstattung aller Häuser empfindlich litten – hinterfragen kann.
Diagonalen, Verschachtelungen, Komplexität und Konvention
Die innere Organisation der Häuser folgt unterschiedlichen Strategien. Meili Peter und Märkli haben die Wohnungen mit diagonalen Raumfi guren und Fenstern an den Ecken der Baukörper von den engen Zwischenräumen weg und hin zur gemeinsamen grünen Mitte orientiert. Czech, Diener und Steidle versuchten, den Wohnungen durch eine komplexe Verschachtelung teilweise überhoher Räume mehr Luft zu verschaffen. Flexibilität machte lediglich Krischanitz bei einem seiner Häuser zum Thema – in Form von Wohneinheiten, die als offene Halle zwischen drei Erschliessungs- und Installationstürmen liegen und entweder in fünf Räume unterteilt oder offen belassen werden können.
Czech und Kollhoff verweigerten sich dem Beton in der äusseren Erscheinung ihrer Häuser. Während Czech sein plastisch differenziertes Haus aussen dämmen und verputzen liess und mit einer hohen Betonpergola krönte, fiel Kollhoffs Projekt bereits bei der ersten Präsentation völlig aus dem Rahmen. Zwar musste der anfangs vorgesehene Säulenportikus aus Kostengründen gestrichen werden, doch noch immer zeigt sich das klassizistische Volumen mit seinen Lisenen und Gesimsen aus Putz wenig beeindruckt von der parallel entworfenen Nachbarschaft. Ironie des Marktes: Die Kollhoff’schen Wohnungen, die konventionell geschnitten sind, relativ eng über drei Geschosse gehen und so gar nicht zu der hochherrschaftlichen Geste des Baukörpers passen wollen, waren als erste vermietet.
Erfrischendes Baudenkmal
Das Freibad Seebach war in die Jahre gekommen. Die Architekten Hermann Kohler und Enrico Ilario erneuerten die Technik, sanierten die Gebäude und frischten die gesamte Anlage auf. Die ist nun zeitgemässes Freibad und junges Baudenkmal in einem.
Die Sport- und Freizeitanlage Seebach liegt in einer lang gezogenen Mulde des Katzenbaches und besteht aus pavillonartigen Gebäuden, die eine kunstvoll modellierte Parklandschaft begrenzen. Neben dem Heuried ist sie die grösste in der Stadt Zürich. Das Hochbauamt der Stadt Zürich plante die Anlage unter der Leitung des damaligen Stadtbaumeisters Adolf Wasserfallen zusammen mit dem Landschaftsarchitekten Willi Neukom. Die Realisierung erfolgte in Etappen: 1963–1966 wurde das Freibad erstellt, 1967 das Volierengebäude in der Nähe des Badeinganges und 1968–1970 das Gemeinschaftszentrum, das die Anlage nach Westen hin abschliesst.
Das Freibad besteht aus drei Schwimm-, einem Planschbecken und vier Gebäuden: einem Dienstgebäude am Eingang mit separater Dienstwohnung, dem benachbarten Garderobengebäude sowie dem ehemaligen Restaurant am anderen Ende des Bades
mit Sportgarderoben und einem Anbau für die Filteranlage. Die Häuser huldigen einer materialbetonten Sachlichkeit. In den Worten ihres Architekten sind sie «dem Zweck der Anlage entsprechend architektonisch einfach gehalten und in robusten Materialien ausgeführt» – eine unaufgeregte Architektur, wie man sie heute wieder schätzt. Auskragende Flachdächer mit stark in Erscheinung tretenden Betonrippen prägen ihre horizontale Erscheinung. Die darunter liegenden Fassaden sind entweder aus Sichtbackstein oder aus rötlichem Sipoholz. Der nach Norden ansteigende Rasen der An-lage ist weich moduliert und von einzelnen Bäumen und horizontalen Betonbändern durchsetzt.
Die Freiräume sind im Inventar der schützenswerten Anlagen und Gärten der Stadt Zürich aufgeführt, die Gebäude bei der Denkmalpflege inventarisiert. Das Bad befand sich grösstenteils noch im Originalzustand, musste jedoch nach vierzigjährigem Gebrauch dringend instand gesetzt werden. Die Wasseraufbereitungstechnik war veraltet, Leitungen waren desolat, der Beton sanierungsbedürftig und die Kacheln der Becken defekt. Bei der Instandsetzung der Anlage galt es aber auch, funktionelle Mängel zu beheben, sie allgemein aufzufrischen und für heutige Bedürfnisse attraktiver zu machen.
Das mit Planung und Ausführung beauftragte Architekturbüro Kohler Ilario begann in einer ersten Phase (Winter 2004/05) mit einer vollständigen Erneuerung der technischen Anlage sowie der Becken. Hier setzten die Architekten den erneuten Einsatz bläulicher Keramik durch statt einer heute oft verwendeten Edelstahl-Oberfläche. Nach Plänen des Landschaftsarchitekten Andreas Geser wurden ausserdem Spielgeräte, Rampen und Pflanzkübel entfernt, der Baumbewuchs ergänzt, ein zusätzlicher Weg angelegt sowie die einstigen beckennahen Staudenbepflanzungen wiederhergestellt. Beim Kleinkinderbereich findet sich nun ein Wasserspiel und beim Nichtschwimmerbecken ein grosser Rutschbahnturm. Das ungenutzte Lehrbecken überdeckt ein Liegerost – so konnte hier eine Erfindung Adolf Wasserfallens vor dem völligen Verschwinden bewahrt werden: Die «Zürcher Überlaufrinne» entwickelte der Architekt für das Freibad Seebach. Sie sorgte für einen gleichmässigen Wasseraustausch der Becken und wurde zum Vorbild für viele andere Bäder.
Im Winter 2005/06 folgten die Massnahmen an den Gebäuden. Die Betonoberflächen sämtlicher Häuser wurden saniert, die Backsteinwände sowie die wertvolle Holzverschalung gründlich gereinigt und teilweise ergänzt. Die Nutzungen der Gebäude veränderten sich zum Teil stark. Den bereits provisorisch eingerichteten Verpflegungskiosk am Eingang erweiterte man mit moderner Küchentechnik und einer WC-Anlage. Er ersetzt nun definitiv das ehemalige Selbstbedienungsrestaurant im Obergeschoss des Sportumkleidengebäudes im hinteren Teil der Anlage. Das Restaurant wurde dort zu wenig frequentiert, weshalb an dessen Stelle nun weitere Saisonkabinen eingebaut wurden. Die einstige Restaurantterrasse wurde zur Liegefläche – die darüber liegenden Sonnenschutzlamellen aus Beton nehmen nun auch den ehemals geschlossenen Teil des Daches ein. Im Geschoss darunter wurden die Sammelgarderoben zu einem Spiel- und Sportraum hinter einer Faltschiebewand umgebaut – der Bedarf an Umkleiden hat sich im Laufe der Zeit mehr und mehr reduziert.
Das zeigt auch der grösste Eingriff in die historische Anlage im unteren Geschoss des Garderobengebäudes. Die Männer teilen sich nun mit den Frauen die obere Etage. Ihre ehemalige Umkleide im Untergeschoss steht nun als Mehrzweckraum der Öffentlichkeit das ganze Jahr über zur Verfügung, was auch im Winter zur Belebung dieses sozial nicht ganz einfachen Ortes beiträgt. Sein Zugang befindet sich ausserhalb des Bades: ein ehemaliger Serviceweg entlang des Katzenbaches. Die einstige Werkstatt ist nun ein Entree mit WC und durch eine innere Glasfront vom frei teilbaren Raum getrennt. Schwarze Platten an den Wänden und naturbelassener Steinholzbelag kontrastieren mit den gelbgrünen Vorhängen, die für gute Akustik und Intimität sorgen – hier zeigt sich der neue Eingriff in zeitgemässer Frische. In der hallenartigen Garderobe darüber scheint sich dagegen kaum etwas verändert zu haben: Die hölzernen Umkleidekabinen wurden leicht erhöht, einige Schliessfächer vergrössert und der Dusch- und WC-Bereich erneuert.
Eine diskrete Arbeit der Künstlerin Franziska Koch macht die Erneuerung des Freibades Seebach zum Thema: Über der Brüstung der ehemaligen Restaurantterrasse hängt ein Badetuch, vor Schmutz starrend und tropfend, als hätte es dort jemand vergessen. Erst bei genauerer Betrachtung sieht man: Es ist aus Metall gegossen. Sämtliche Möbel in der Anlage wie Tische, Stühle, Liegestühle und Sonnenschirme sind kräftig rot und bilden so einen satten Kontrast zum Grün der Bepflanzung, zum Blau der Wasserbecken und zur zurückhaltenden Tonigkeit der Gebäude.
Aufpolierte Stadtkrone
Mit einem dreiteiligen Projekt gewannen Burkard Meyer Architekten 2003 den Studienauftrag um die Gebäude der Berufsschule Baden. Das 1954 von Armin Meili gebaute Wohlfahrtsgebäude wurde mit einem Turnhallentrakt erweitert und durch ein neues Schulhaus an der Bruggerstrasse ergänzt. Beginnen die beiden Neubauten das ehemalige BBC-Areal und damit den Kontext des Meili-Baus grundlegend umzudeuten, lässt sein Umbau ihn in neuem Glanz erstrahlen.
Das Gemeinschaftsgebäude der Brown, Boveri & Cie. (BBC) thront seit 1954 auf dem Martinsberg oberhalb des Werkgeländes (Bild 3). Einer Stadtkrone gleicht nicht nur seine Lage, sondern auch das «neuartige, aus hohem sozialem Verantwortungsgefühl entstandene Bauprogramm», so der Architekt Armin Meili. Er wurde Anfang der 1950er-Jahre von der BBC beauftragt, Räume für einen «fröhlichen und beschaulichen Feierabend» und für die Pflege von «Gemeinschaft und Weiterbildung» zu schaffen. So entstanden Freizeitwerkstätten, Kegelbahnen und ein Festsaal, dessen «Lichtspielanlage» Vorträgen «belehrender oder unterhaltender Art» diente. Ein weiterer Programmpunkt war die Bewirtung von 3000 Arbeitern zur Mittagszeit.
Der bauliche Ausdruck des Hauses entspricht sowohl seiner patriarchalischen Programmatik als auch der Monumentalität einer Stadtkrone: Zwar thront es quer zum Hang, doch schwächt es die Wucht seiner Erscheinung mittels ornamentaler Gliederung der Fassade. Im Aufbau des Gebäudes lässt sich die direkte Umsetzung des Programms auf dem schwierigen Bauplatz ablesen: Das Hauptgeschoss ist so ausgedehnt, dass die Räume der Bewirtung (Mensa und Aula) auf einer Ebene um die Küche herum gruppiert sind. Eine Pfeilerreihe stemmt diese Ebene mit der darunter liegenden in die Höhe – die unteren Geschosse sind um mehr als die Hälfte schmaler und liegen daher hinter der grossen Auskragung der Obergeschosse. Die monumentalen Elemente der Erschliessung machen die ehemalige Nutzung des Hauses ablesbar: Die Arbeiter überwanden auf einer gedeckten Kaskadentreppe die Höhe der Pfeiler und gelangten nach einer Wendung und einer weiteren Treppe auf die Hauptebene. An ihrem hinteren Ende verliessen sie über eine grosse Wendeltreppe die Speisehalle und befanden sich nun unterhalb der Auskragung wieder im Freien (Bilder 4, 5).
Der Umbau
Im Laufe seiner über fünfzigjährigen Geschichte wurde das Gemeinschaftshaus immer wieder an die sich wandelnden Bedürfnisse seiner Nutzer angepasst. Bereits im Gutachten der Denkmalpflege vor dem Umbau durch das Architekturbüro Burkard Meyer findet sich das übergeordnete Ziel, das auch diesem zugrunde lag: Der Entwurf von Armin Meili solle «weitergedacht» werden. Weniger «die detailtreue Rekonstruktion des Originals» sollte man anstreben «als das Wiedererstellen der ursprünglichen Atmosphäre und des Charakters des Hauses». Schwer genug beim Umfang der nötigen baulichen Eingriffe.
Da wäre zunächst einmal die unmittelbare Umgebung, die durch den Bau des benachbarten Sporthallenkomplexes der gleichen Architekten praktisch vollständig umgedeutet wird (Bild 2). Stand das Gemeinschaftshaus in einem leicht abgetreppten, parkartig gestalteten Hang, so ist das Schulhaus nun Teil einer von hohen Stützmauern geprägten Kunstlandschaft. Diese neue Rolle mag der von Meili angestrebten «erholsamen, heiteren Note» zunächst widersprechen. Andererseits passt sich das Gebäude durch seine strukturelle Erscheinung gut in den veränderten Ort ein. Die unsichtbare Seite des Hauses – die enormen Hangsicherungs- und Fundierungsmassnahmen, denen die «Schweizerische Bauzeitung» im März 1955 allein mehrere Seiten widmete – tritt so zu Tage, und die Stadtkrone erhält mit den Sporthallen ihr Postament – auch wenn es daneben steht.
Fassadensanierung
Äusserlich gleicht das Haus nun wieder mehr seiner ursprünglichen Erscheinung, trotz umfangreicher, energetisch und programmatisch bedingter Eingriffe. Die prägnant strukturierten Süd- und Ostfassaden – von den ersten Curtain-Walls der Schweiz – waren ursprünglich in Holz ausgeführt (Bild 1). Sie wurden bis auf ein Teilstück durch eine Holzmetallkonstruktion ersetzt. Die übrigen doppelverglasten Holzfenster der Hauptfassaden blieben erhalten, wurden sorgfältig saniert, teilweise mit Isoliergläsern ergänzt und wieder eingesetzt. Zudem konnten die einst entfernten blauen Sonnenstoren rekonstruiert und der noch vorhandene Reinigungslift überholt werden.
Die erforderliche neue Dämmung beschränkt sich in der Hauptsache auf die Nordfassade, die vom Schulgelände nur wenig zu sehen ist. Deren Aussendämmung ermöglicht es nun in der Gesamtenergiebilanz, die Sichtbetonfassaden der Süd- und der Ostseite lediglich minimal im Inneren zu dämmen und so zu erhalten.
Innere Eingriffe
Auch die inneren Eingriffe wollen die Architekten nicht als neu erkannt wissen. Stattdessen schälen sie die Substanz des Meili-Baus aus zahlreichen Um- und Einbauten heraus und bemühen sich bei neuen Einbauten, analog zum eingangs genannten Ziel, seine Stimmung zu treffen. So wird zum Beispiel der auffällig gemusterte Boden des Foyers, Gartensaal genannt, erhalten und mit neuen keramischen Platten ergänzt (Bild 7). Ein kleiner Teil der alten Garderobenstangen konnte erhalten werden. Die gesamte hintere Hälfte des Foyers wurde allerdings als Mediathek umgenutzt und durch eine Holz-Glas-Wand abgetrennt. Auch wenn der Bodenbelag und die der alten Decke nachempfundene Akustikdecke die beiden Raumteile zusammenbinden – bei der neuen Trennwand steht nicht die Transparenz im Vordergrund. Stattdessen kokettiert sie, gelblich gestrichen, mit dem Baustil des Hauses.
Auch die enormen Abmessungen der anderen Haupträume – einst das Hauptcharakteristikum des Hauses – mussten für die neue Schulnutzung leider verringert werden. Da die Täfer aus Lärchensperrholz und das Eichenparkett in Aula und Mensa in schlechtem Zustand waren, mussten die originalen Oberflächen ersetzt werden. In der Aula im bergseitigen Quertrakt wurden die in den 1970er-Jahren hinzugekommene Quergalerie entfernt und die Wände neu mit Holz verkleidet (Bild 8). Lediglich die neue Technik verlangte ihren Tribut, am sichtbarsten in Form von Leuchtschienen, die über der originalen schlangenförmigen Lampenstange hängen. Ausserdem wurde der Raum um eine Fensterachse gekürzt, um so zwischen heraufkommender Treppe und Aula einen Stichgang zur Dachterrasse anlegen zu können.
Die eindrucksvolle Länge der Mensa musste leider gekappt werden (Bild 9). Wie im Gartensaal betritt man nunmehr knapp die Hälfte des ehemaligen Raumes, der mit seiner Doppelgeschossigkeit und der zur ornamentierten Fensterwand hin hochklappenden Decke jedoch noch immer grosszügig ist. Die Wände sind nicht mehr mit Holz, sondern mit einer weiss gestrichenen Plattenstruktur verkleidet, und die überdimensionierten weissen Lampenschirme zitieren Meilis verschwundene Originale, die einst den «Eindruck einer grossen Stube» vermitteln sollten.
Veränderte Raumfolge
Die heimelige Mensa und die festliche Aula standen ursprünglich in einem unmittelbaren funktionalen wie räumlichen Zusammenhang: Lediglich eine grosse Faltwand trennte die beiden Säle. Beim mittäglichen Mahl stand sie offen und ermöglichte so einen durchgehend möblierten Raum, der die Küche an drei Seiten umschloss. Hier fügten die Architekten nun einen Vorraum ein, links und rechts von geschlossenen Wänden gebildet. Beim Gang die Treppe hinauf blickt man heute daher nicht mehr in die Weite des Speisesaales, sondern an eine geschlossene Wand und wendet sich oben nach links, um Aula oder Mensa durch neue Türen zu betreten. Dies ist der wohl grösste Eingriff der Architekten, verändert er doch die Hauptwegführung massiv. Trotzdem: Die neue Raumfolge ist selbstverständlich und logisch und gibt auch im Detail nur dem genauen Beobachter einen Hinweis auf ihr Baujahr.
Das gilt auch für die Eingriffe im hinteren Teil des Hauptgeschosses und in allen darunter liegenden, die nun vor allem klassischen Schulzwecken dienen. Die nicht tragenden Wände bilden eine klare Folge von Räumen – klarer als selbst im Urzustand des Hauses. Lediglich die ungewohnte, aber nicht störende Gedrungenheit der Klassenräume zeugt von der Enge des gegebenen Rahmens – nicht zuletzt gewannen Burkard Meyer den Wettbewerb, weil es ihnen gelang, alle geforderten Nutzungen im Altbau unterzubringen und auf störende Anbauten zu verzichten. Insgesamt ist der Umbau des ehemaligen Gemeinschaftshauses ein gelungenes Beispiel dafür, dass sich ein behutsamer Umgang mit einem Baudenkmal und dessen selbstbewusste Neuinterpretation nicht widersprechen müssen.