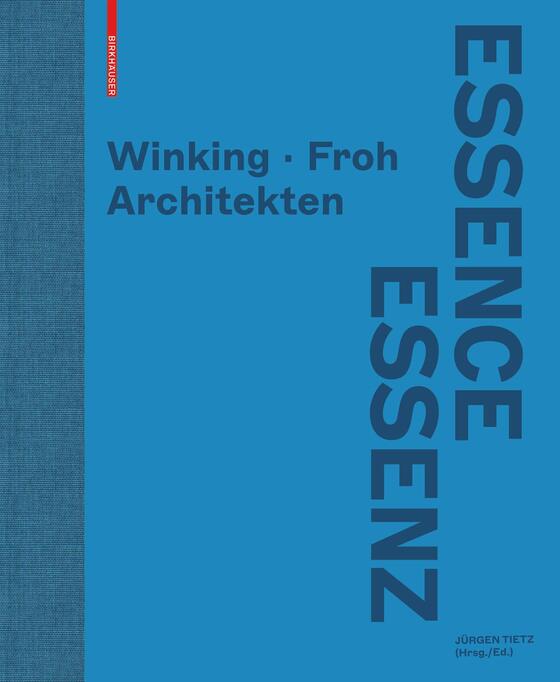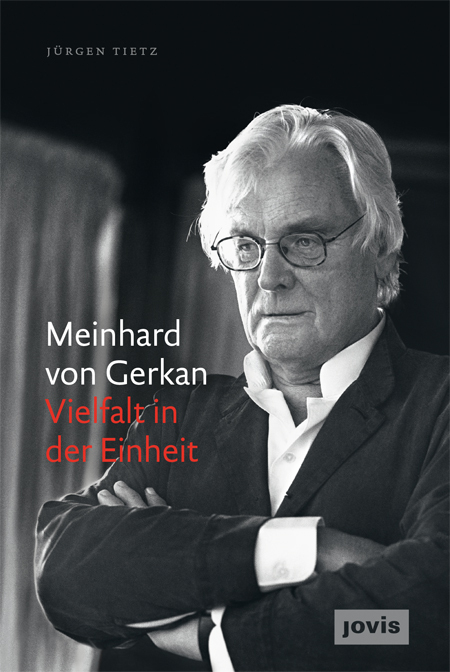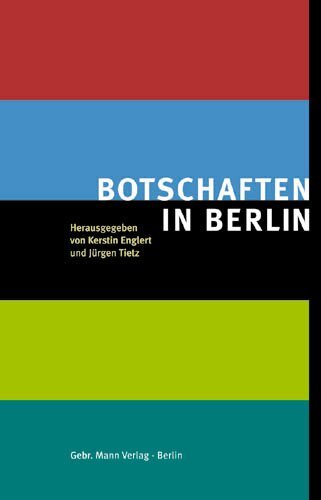Raumblöcke für das Eiswerk
Eisfabrik in Berlin
In der Abfolge von drei unterschiedlichen Bausteinen definieren GRAFT ein gemischtes Quartier, das durch seinen Städtebau sowie seine Gebäudefigur und Architektursprache abwechslungsreiche Raumwirkungen erzielt und unterschiedliche Zeitschichten verbindet.
Kurz vor 9 Uhr morgens herrscht Hochbetrieb an der Köpenicker Straße 40. Menschen strömen zu Fuß oder auf dem Rad zum Eiswerk. Unter der abgetreppten Durchfahrt im Vorderhaus hindurch führt ihr Weg in die Tiefe des Grundstücks, das sich fast bis zum Ufer der Spree erstreckt. Ein Stück Berliner Blockkultur des 19. Jahrhunderts. Ob jemand von ihnen etwas mit dem Namen Carl Bolle anfangen könnte? Dem legendären Berliner Unternehmer und Meiereibesitzer des 19. Jahrhunderts?
Auf Bolle, der wegen des werbenden Läutens seiner Milchwagen in Berlin »Bimmel-Bolle« genannt wurde, geht die Entstehung der Eisfabrik 1896 zurück. Damals hatte sich das Spreeufer zwischen Mitte und Rummelsburger Bucht als wichtiger, innenstadtnaher Industriestandort etabliert. Nach der Wiedervereinigung 1990 war die Gegend direkt am ehemaligen Mauerstreifen Club- und Partyareal. Bis ihre städtebaulichen Potenziale wachgeküsst wurden, dauerte es erstaunlich lange. Das gleich neben der Eisfabrik liegende Deutsche Architektur Zentrum (DAZ) war viele Jahre einsamer Vorreiter. Doch inzwischen reihen sich auf dem Streifen zwischen Köpenicker Straße und Spree die unterschiedlichsten Nutzungen aneinander, wird dort gewohnt und gearbeitet.
Eiskalt transformiert
In der Eisfabrik war 1995 nach fast einem Jahrhundert Schluss mit der Produktion von Stangeneis zur Kühlung. Seitdem wurde intensiv um die künftige Nutzung des Industrieareals gerungen. Bedauerliche bauliche Verluste inklusive. So wurden die bedeutenden Hochkühlhäuser von der Treuhand Liegenschaftsgesellschaft kurzerhand entsorgt. 2017 erhielten schließlich die Berliner GRAFT Architekten den Auftrag, auf dem Gelände für den Investor Trockland ein neues Quartier zu entwickeln. Stellt sich die Frage: Was braucht eigentlich ein gelungenes Quartier? Natürlich, die richtige Mischung macht’s. Daran hat sich seit Carl Bolles Zeiten wenig geändert. Wie damals fügt sich das Quartier aus unterschiedlichen Bausteinen zusammen. Zur Straße hin wird gewohnt, zur Spree hin wird gearbeitet.
Baustein eins ist die straßenbegleitende Wohnbebauung, die sich um einen klassischen Berliner Hof legt. Das historische Wohngebäude wurde von GRAFT saniert und um eine Lückenschließung zur Köpenicker Straße hin ergänzt. Die Fassade mit ihren stehenden Fensterformaten samt Glasbrüstungen ist mit dunklen Aluminiumblechen verkleidet. Gegliedert wird sie durch unterschiedlich große Balkone sowie ein System aus gegeneinander verschobenen Rahmen, die mal nur ein, mal zwei Geschosse zusammenbinden. Ergänzt wird diese Fassadenbewegung durch das charmante Farbspiel der Rahmen. Je nach Lichtstimmung schimmern sie stärker golden oder eher grünlich. Zum Hof hin, der nach historischem Vorbild denkmalgerecht wiederhergestellt wurde, zeigen sich Alt- und Neubau unaufgeregt mit hellem Verputz.
Baustein zwei des Eiswerk-Quartiers ist sein Querriegel. Ursprünglich Eislager, nimmt er nun Büros auf. Er schließt sich auf der Rückseite des Wohnhofs an und bildet die Schnittstelle zur gewerblichen Nutzung des Grundstücks. Spreeseitig zeigt das ehemalige Eislager eine typische Industriefassade des ausgehenden 19. Jahrhunderts, die durch Ziegellisenen und Putzfelder strukturiert wird. In die einst geschlossenen Wände haben GRAFT für die neue Nutzung Fensteröffnungen eingebracht, die dem industriellen Charakter des Denkmals entsprechen.
Der dritte Baustein ist der spektakulärste des Eiswerks, das Bürogebäude für den Onlinebroker Trade Republic. Der annähernd u-förmige Baukörper ist von sieben Geschossen im Inneren des Quartiers zur Spree hin auf vier Geschosse abgetreppt. Die U-Form des Baukörpers wird durch die mal auskragenden, mal zurückspringenden Geschossebenen markant aufgelockert. Unterstützt wird diese Wirkung durch die Alu-Elemente der Fassade: Je nach Ausrichtung wirken sie geschlossen oder offen. Ihre Farbe greift dabei auf den an der Köpenicker Straße eingeführten, chamäleonhaft changierenden gold-grünen Ton zurück und bindet die Bauteile bei unterschiedlicher Gestaltung und Nutzung optisch zusammen. Zugleich übersetzen die horizontalen Elemente der Bürohausfassade Struktur und Ornamentik des gegenüberliegenden ehemaligen Maschinen- und Kesselhauses, das derzeit von Robertneun als Veranstaltungsort ergänzt und hergerichtet wird. So entsteht ein reizvoller Dialog zwischen Alt und Neu in Formfindung und Materialverwendung.
Quartiersbildung als Raumbildung
Neben der Mischung der Funktionen ist deren angemessene Differenzierung in öffentliche, halböffentliche und privatere Bereiche konstituierend für das Quartier. Doch GRAFT führen am Beispiel des Eiswerks auch vor, welche Rolle Architektur und Städtebau bei der Raumbildung für die Qualität eines Quartiers zukommt. Anstatt einfach eine »klassische« Berliner Blockbildung durchzudeklinieren, definieren sie mit Gebäudeform und Architektursprache unterschiedliche Räume und schaffen unterschiedliche Qualitäten. Auf der überschaubaren Grundfläche des Quartiers entsteht so im Wortsinn auf Augenhöhe eine interessante Abfolge von Raumcharakteren, die subtil modelliert sind.
Dieses Spiel der sich mal weitenden, mal verengenden Räume wird durch die Ausrichtung der Fassaden und den Wechsel von offenen und geschlossenen Bereichen begleitet. Die Blicke werden gelenkt und kleinteilige räumliche Geschichten erzählt. Dabei kommt GRAFT zugute, dass ihr Grundstück nicht durch einen Zaun von dem des ehemaligen Maschinenhauses abgetrennt ist, sondern trotz unterschiedlicher Eigentümer eine räumliche Einheit bildet. Geradezu verblüffend ist, dass dieses abwechslungsreiche Raumerlebnis durch die Fotografien nur begrenzt transportiert werden kann. Man sollte es vor Ort erleben.
Einer der entscheidenden Unterschiede zu Carl Bolles Zeiten ist nämlich, dass die Raumwelt des Eiswerks öffentlich zugänglich ist. Hier zeigen sich Verantwortung und Potenziale einer klugen Stadtentwicklungspolitik. Eine ursprünglich städtebaulich ebenfalls angedachte Durchwegung der Grundstücke zwischen Spree und Köpenicker Straße im Bereich des Hofes voranzutreiben, konnte leider nicht umgesetzt werden. Das führt dazu, dass es keinen zusätzlichen Eingang zum benachbarten Deutschen Architektur Zentrum DAZ gibt, das mittlerweile eng umbaut in seiner Hofinnenlage sanft dahindämmert.
Offen ist, wann es den geplanten öffentlichen Uferweg entlang der Spree geben wird. Vielleicht würde dann ja auch eine mögliche Gastronomie im EG des Trade-Republic-Gebäudes einziehen. Bis dahin säumen weiter wilde Tippis das Spreeufer. Det is Berlin. Einen ordentlichen Espresso gibt es allemal in dem Mikro-Café des Quartiers, gleich neben dem Durchgang von der Köpenicker Straße. Dort lässt es sich gut darüber philosophieren, dass eine spannungsvolle Raumbildung zentrale Bedeutung für eine gelungene Quartiersbildung besitzen kann.