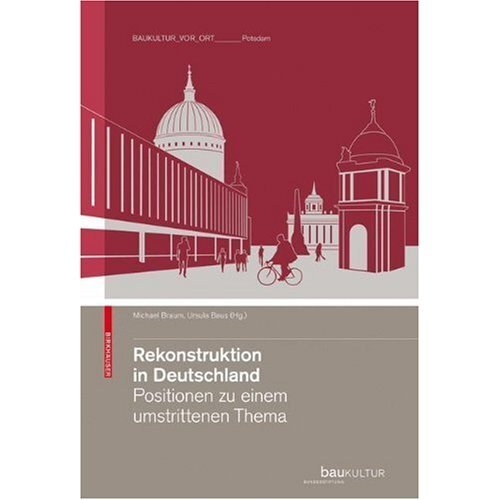Artikel
Insel der Farben
Wohn- und Gewerbeblock Saint-Urbain in Straßburg (F)
Nahe der Innenstadt ist unter Federführung des Architekturbüros LAN ein ganzer Straßenblock neu errichtet worden. Einheit und Vielfalt halten sich die Waage: Während ein gemeinsames Fassadenraster die acht Baukörper trotz ihrer teils unterschiedlichen Nutzungen gestalterisch zusammenfasst, sorgen verschiedene Farben für eine Differenzierung.
Im Januar 2021 trat eine Gebietsreform in Frankreich in Kraft, bei der unter anderem. die Région Grand Est geschaffen wurde. In dieser Region ist Straßburg mit fast 300.000 Einwohnern in der Kernstadt und 760.000 im Umfeld, der aire urbaine, deutlich die größte Stadt. Und sie wächst weiter, weil die gesamte Region als Zentrum europäischer Institutionen – Europarat, Europäisches Parlament, Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte und mehr – an Bedeutung gewinnt und Straßburg als »Hauptstadt Europas« anzusehen ist. Zu ihr gehören 15 Stadtteile, so auch Neudorf im Südosten des Zentrums auf halber Strecke nach Kehl. 2011 startete in Straßburg das epochale Projekt »deux rives«: Auf 250 ha sollen unter anderem 9.000 Wohnungen entstehen, wobei das Gebiet zwischen Straßburgs Zentrum und Kehl umstrukturiert wird. Planerisch weitsichtig ging dem Transformationsprozess eine Veränderung der Infrastruktur voraus, indem neue Straßenbahnlinien angelegt wurden, etwa nach und durch Neudorf, seit 2017 sogar über die Grenze und den Rhein nach Kehl. Dem ÖPNV wird in Frankreich eine weit höhere Bedeutung beigemessen als in Deutschland. Und weil Straßburg zu den fahrradfreundlichsten Städten Frankreichs gehört, kamen dabei auch die Drahteselwege nicht zu kurz.
In Neudorf liegt nun eine Art urbane Insel, eine île urbain auf dem Ilot ZD6, das nach dem benachbarten Friedhof »Saint-Urbain« benannt ist. Im Westen vom Parc de l’Étoile, im Osten vom Friedhof, im Süden von der Avenue Jean Jaurès und im Norden von der Avenue du Rhin begrenzt, kann man bei Saint-Urbain tatsächlich von einer isolierten Lage sprechen. Immerhin ist der Verkehr so diszipliniert, dass man fußläufig die Umgebung erreicht, ohne in Unterführungen verbannt zu werden. Mit acht unterschiedlich hohen Baukörpern ist Saint-Urbain nun sehr dicht, funktional sehr gemischt und sehr farbig bebaut worden.
Auf einer Nutzungsfläche von über 21.500 m² fanden hier 178 Wohnungen, ein Hotel, einige Büroflächen und in den EGs Handel und Gastronomie Platz. Die Heterogenität des Raumprogramms packten die Architekten ungeachtet funktionaler Besonderheiten in die acht einander ähnelnden Baukörper, sodass die Nutzungsvielfalt in den gerasterten Fassaden mit weitgehend gleichformatigen Fenstern kaum zu erkennen ist. Büros und Hotelzimmer, kleine und große Wohnungen mit und ohne Loggien sind einer stadtrelevanten Ordnung unterworfen, die in Frankreich eine lange Tradition hat, aus Baron Haussmanns Paris ins globale Bewusstsein gelangte und auch in Straßburgs Zentrum faktisch präsent ist. Allerdings ist das Terrain Saint-Urbain nicht als geschlossene Blockrandbebauung konzipiert, sondern in die erwähnten acht Baukörper unterschiedlicher Höhe gegliedert. Sie lassen als Ensemble eher an ein kleines Manhattan denken. Ein intimer Hofbereich entsteht immerhin dadurch, dass auf EG-Niveau eine Garage Platz gefunden hat, deren Dach als quartiersinterne, halbprivate Fläche begrünt ist und eine Aufenthaltsqualität aufweist, die ausschließlich den Bewohnern vorbehalten bleibt.
Farbe stiftet Identität
Die Fassaden signalisieren durch ihre Gleichförmigkeit eine Art Gleichheit der dahinter liegenden Räume – die aber nur im Sinne einer Zusammengehörigkeit interpretiert werden soll. Zu dieser gleichförmigen Ordnung gehören traditionell die vertrauten, bodentiefen Fenster an den Straßenfassaden, die nun eins der beiden Gestaltungsmotive des Ilot ZD6 bilden, die Dominanz der Farbe das andere. Die konsequente Farbgebung intensiviert die skulpturale Wirkung der unterschiedlich dimensionierten Gebäude und beschert reizvolle Durchblicke und Lichtverhältnisse. Die Farben verleihen den Baukörpern im Einzelnen und dem Ensemble in der Gesamtwirkung auch ein bemerkenswertes Maß an Identität.
Die Gebäudefarben, so die Architekten, korrespondieren im Sinne Josef Albers’ miteinander. Josef Albers (1888-1976), der einflussreiche Lehrer am Weimarer Bauhaus, war 1933 in die USA geflohen und hatte dort an der Kunsthochschule Black Mountain College unterrichtet; zu seinen Schülern gehörten Robert Rauschenberg, Donald Judd und Cy Twombly. Berühmtheit erlangten Albers’ Experimente mit der farbig zauberhaften »Homage to the Square« aus den frühen 1950er Jahren und das 1963 erschienene Buch »Interaction of Color«: Auf derart intensive Farbwirkungen rekurrieren auch die Architekten hier bei ihrem Straßburger Projekt. Ihre Farbauswahl bezieht sich auf Nuancen aus der Nachbarschaft – etwa mit dem Braun des Hotels auf die gegenüberliegende Cité de la Musique et de la Danse oder mit einem hellen Blau auf das Eingangsgebäude zum Friedhof. Außergewöhnlich ist, wie radikal die Farbgebung die Architektur dominiert. Wandflächen, Türen, Fensterrahmen und -sprossen, Loggiengeländer – jegliche Materialität verschwindet hinter der hervorstechenden Farbe, auch wenn es leichte Unterschiede in den Tonwerten etwa zwischen Holzbeize (Keim) und Fassadenfarben (RAL) gibt. Die Anpassung an die jeweilige Baukörperfarbe geht sogar so weit, dass Stühle eines Bistros im Außenbereich die Farbe seines Hauses haben und sich der Ton auch ins Innere hineinzieht: Foyerwände, Briefkästen und Geländer entsprechen den jeweiligen Gebäudefarben. In den EGs wird ohnehin keine Farbvielfalt geduldet; die Wandflächen für Restaurant- oder Ladennamen sind klein und nur dezent bestückt. Leuchtreklame und Markenpräsenz bleiben tabu. Das ist per se angenehm und tut der Urbanität des Ensembles keinen Abbruch.
Gebäudeformen und -größen sowie die Farbintensität erzeugen im flachen Straßburg einen von der Ferne erkennbaren Orientierungspunkt. Von den Straßen und Straßenbahnlinien aus betrachtet bleiben ein Ort, eine Adresse im (Bild-)Gedächtnis; eine semiotische Bedeutung der Quartiersilhouette als Signet der Stadttransformation ist nicht auszuschließen. Denn das Farbenspiel auf der île urbain findet seinesgleichen in Straßburg nicht und wird es auch kaum bekommen. Die farbige Skyline hat also das Zeug zur Landmark.
Schließlich stellt sich die Frage, ob einem die Farbe des jeweiligen Hauses, in dem man sein Zuhause oder seinen Arbeitsplatz findet, auch gefällt. Das ist schwer zu beantworten, denn Farbvorlieben gehören zu den Geschmacksfragen. Sucht man nach Namen für die Farben, lassen sich Wertungen schon nicht vermeiden: Lind-, Reseda- oder Salbeigrün? Terrakotta oder Aubergine? Lila, Flieder oder Pink? Türkis oder Mint? Im Ganzen ein Sortiment aus Bonbon-Farben? Die Wertigkeit der einzelnen Töne wird sich auch in ihrer Namensgebung im Alltag spiegeln.
Wertarbeit
Schönberghalle in Pfullingen
Für eine klassische Bauaufgabe im kleinstädtischen Kontext fand das junge Architekturbüro eine klassische Lösung. Klare Strukturen in Sichtbeton, funktionale Angemessenheit, angenehme Materialkontraste und ortsbezogene Durchlässigkeit heben die robuste Dreifeld-Sporthalle weit über den Durchschnitt hinaus.
Pfullingen liegt am Fuße der Schwäbischen Alb, charmant umgeben von einem Biosphärengebiet. Streuobstwiesen und eine beschauliche, hügelige Landschaft charakterisieren die idyllische Lage des Orts, um dessen Kern die üblichen Einfamilienhausgebiete gewachsen sind. Auch den legendären baden-württembergischen Mittelstand findet man hier; über ein Gewerbegebiet ist die Siedlungsfläche mit der Nachbarstadt Reutlingen zusammengewachsen. Das Vereinsleben ist rege – die Pfullinger Handballer spielten einst sogar in der Bundesliga –, und mit sechs Schulen empfiehlt sich Pfullingen als familientauglicher Wohnort für derzeit 19 000 Einwohner. Und – das ist ungewöhnlich – man erlaubt sich einen Gestaltungsbeirat.
In Louis Laiblin (1861-1927), dem Sprössling einer Pfullinger Papierfabrikanten-Familie, fand der Ort zu Beginn des 20. Jahrhunderts einen Förderer der Künste und den Bauherrn eines bemerkenswerten Aussichtsturms (1905) sowie der Ton- und Turnhalle (1904-07). Mit beiden Bauten war der damals an der TH Stuttgart lehrende Theodor Fischer beauftragt worden. Seine »Pfullinger Hallen« bilden mit einer Eisenbeton-Tonne den Kern eines Schul-, Freizeit- und Sportgeländes, das nun jüngst um eine Sporthalle erweitert worden ist. Diese Dreifeldhalle für Schul- und Vereinssport ist das Ergebnis eines Wettbewerbs im Jahr 2013, wobei es auch darum ging, das Terrain zwischen den Pfullinger Hallen im Süden, der Laiblin-Schule im Osten, dem Stadion im Norden und dem Freibad im Westen neu zu ordnen.
Selbstbezogene Perfektion
Nach Norden steigt das Gelände an, sodass es nahelag, den zweigeschossigen Baukörper hier ein Stück weit ins Gelände zu schieben. Längsseitig bildet seine Südseite das Gegenüber des Theodor Fischer-Gebäudes. Nun lässt Fischers kompakter Bau bereits in seinem Grundriss eine differenzierte Baukörperstruktur erkennen, die auf die Eigenheiten des Orts abgestimmt ist und funktionale Unterschiede im Baukörper ablesbar macht – etwa die Turnhalle und die mit Wandmalereien angereicherte Tonhalle. Dem setzt sein neues Gegenüber leider wenig entgegen, was ernsthaft oder spielerisch einen räumlichen Dialog aufnehmen würde. Auch wenn es in der Schönberghalle vorrangig um Sport geht – Ramba-Zamba zu Fasching oder Hochzeitsanfragen werden abschlägig beschieden, Messeveranstaltungen immerhin akzeptiert –, gäbe das Raumprogramm durchaus eine plastisch wirksamere Baukörperkontur her. So ist die neue Schönberghalle als Baukörper zunächst konventionell zu nennen – ein Quader mit klaren Kanten, ein Beton-Flachdachbau mit verglastem EG, auf sichere Distanz zur Umgebung gesetzt.
Mit derartigem Konzept kann man weder in Pfullingen, noch in Wuppertal oder am Prenzlauer Berg etwas grundsätzlich falsch machen. Der Banalität entkommt die Halle in Pfullingen allerdings deutlich, weil sie aus der Funktionalität gestalterische Qualität gewinnt. Die funktionale Perfektion tritt außenräumlich mit zwei separierten, gestalterisch wichtenden Zugängen in Erscheinung: Die Sportler gehen im EG hinein, und dieser Zugang sieht als Holzfassaden-Stück eben nicht wie ein Dienstbotenzugang oder eine Anlieferung aus. Der Besucher-Eingang hangaufwärts trumpft daneben nicht mit Opulenz auf, sondern gewinnt durch – einmal mehr – Funktionalität an Ausdruckskraft. Neben dem verglasten Haupteingang ist eine kleine, außen mit Holz in Erscheinung tretende Küche gelegt, die bei entsprechenden Anlässen außenräumlich genutzt werden kann und Gastlichkeit vermuten lässt. Auf der Gebäudesüdseite lässt sich durch einen verglasten Fassadenanteil im OG der Gymnastiksaal ablesen, von dem aus man durch ein internes Fenster auch in die große Halle schauen kann.
Leider ist hangaufwärts entgegen den Wünschen der Architekten noch ein weiterer Parkplatz angelegt worden. Obwohl überall jetzt vom kostenlosen ÖPNV die Rede ist – wenn es ihn denn gäbe, mit vielen halbstündlich von 6-23 Uhr verkehrenden Buslinien.
Innenräumlich führt die Architektur mit zwingender, selbstverständlicher Konsequenz die Nutzer dorthin, wo sie hingehören. Besuchern und Sportlern sind ihre eigenen Bereiche bestens erschlossen. Die Zuschauertribüne kommt mit drei holzbestückten Reihen unprätentiös daher. Sehr klein in Schwarz auf Grau gesetzte Raumbezeichnungen wurden von den Nutzern zwar mit großen Symbolbildern ergänzt, aber nirgends sind die Sichtbeton-Wände durch angeklebte Plakate, Kritzeleien oder sonstiges Dekor verunstaltet.
In der Halle verschwinden Lagerräume hinter einer holzbekleideten Wand, was ein harmonisches Bild ergibt und gut funktioniert. Das atmosphärische Zusammenspiel von Beton und Holz ist ausgewogen, Farbe vermisst man an keiner Stelle. Haustechnik tritt nicht auf Teufel komm raus in Erscheinung, keine Lüftungsrohre, Kabelkanäle und dergleichen stören den Raumeindruck. In der akustisch wirksamen Lamellendecke (ballwurfsicher, nicht-brennbar) sind Technikelemente und allerlei Sportgeräte eingelassen. Die Holzbekleidung rangierte im Gemeinderat als heißer Streichkandidat; über den Sparwillen siegte letztlich der Wunsch nach Ästhetik und Nutzungsflexibilität. Von den Hauptbindern aus vorgespannten Stahlbeton-Fertigteilen und den Nebenträgern aus Stahl ist nichts zu erahnen.
Die großflächigen Verglasungen auf der Nordseite im EG und auf der Südseite im OG erlauben reizvolle Durchblicke durchs ganze Gebäude – das alles ist räumlich sehr gut gefügt.
Die Architekten arbeiteten raumbildend mit unkaschierten Materialien – Beton, Sichtestrich mit chemischer Oberflächenverdichtung, Holz und Glas. Und so richtet sich unverzüglich die Aufmerksamkeit auf die Ausführungsqualität. Die Sichtbeton-Fertigteile sind nicht lasiert, sondern anthrazit eingefärbt, außerdem hydrophobiert, sodass sie nach nunmehr zwei Jahren immer noch makellos aussehen.
Die Öffentliche Hand muss europaweit ausschreiben, was immer mal wieder hinterfragt werden kann. Denn unter ökologischen Gesichtspunkten wäre es womöglich sinnvoll, nur die am Ort sitzenden Unternehmen zu beauftragen. Nichts müsste von weit her über die Autobahnen oder mit den Güterzügen herbeitransportiert werden; Referenzprojekte von Firmen ließen sich en passant in Augenschein nehmen. Aber nun kommt beispielsweise die Decke aus der Nähe von Leipzig. Wer genau auf den Innenausbau schaut, sieht hier und da nicht ganz Perfektes – Argusaugen entdecken z. B. in den Sanitärräumen, dass das Fugenbild nicht überall aufgeht. Hat man doch beim Materialpurismus und bei klaren Kisten im Süddeutschen stets die Perfektionsarchitektur der Schweizer vor Augen.
Zur energetischen Versorgung steht das Blockheizkraftwerk der benachbarten Schule zur Verfügung, das auch die Hallen, das Freibad und ein Wohnquartier mit Wärme und Strom beliefert. In dasselbe Netz speist die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Sporthalle ein.
Die Schönberghalle ist ein den örtlichen Verhältnissen leicht angepasster Klassiker und eine funktional angemessene Bereicherung im stadträumlichen Kontext. Sie überzeugt als Lösung einer Standard-Aufgabe weit über Durchschnitt – sie ist Tag für Tag von 7.30-22 Uhr belegt, weist nach zweijähriger Benutzung keine Verschleißspuren auf und zeichnet sich insofern auch durch Robustheit aus: im besten Sinne Wertarbeit.
Stuttgart, deine Bauingenieure
Stuttgart: Wiege der Ingenieurbaukunst
Auf den Spuren der Ingenieurbaukunst besuchte unsere
Autorin Ursula Baus sieben Stuttgarter Bauingenieurbüros älterer und jüngerer Generation und sammelte bei ihnen Ideen für ein lebenswertes Stuttgart von morgen ein. Unbefangene Vorschläge frei von politischen Regularien und planerischen Zwängen.
Stuttgart ist unbestritten ein geschichtsträchtiger Ort der Ingenieurbaukunst. Emil Mörsch, Fritz Leonhardt und Wolfhart Andrä, Frei Otto, Jörg Schlaich und Rudolf Bergermann, Peter und Lochner, Werner Sobek, Jan Knippers und Thorsten Helbig, Stephan Engelsmann, Thomas Auer und Matthias Schuler von Transsolar und die jüngere Equipe wie beispielsweise Michael Herrmann und Alexander Michalski vom Büro str.ucture – hier wirkt eine Dichte des who-is-who der Zunft, die es andernorts nicht gibt.
Wenn es irgendwo in der Welt kompliziert mit dem wird, was Bauingenieure zur Baukunst beizutragen haben, ruft man gern in Stuttgart an. Und wer in Stuttgart als Architekt baut, hat die Qual der Wahl, wenn es um exzellentes Zusammenarbeiten mit Ingenieuren geht.
Auch wenn der Fernsehturm von Fritz Leonhardt und Erwin Heinle zum Wahrzeichen gereift ist, der Killesbergturm und alle Brücken von Schlaich Bergermann von einzigartiger Ingenieurbaukunst zeugen und die hippen Automuseen für Mercedes und Porsche ohne diese nicht entstanden wären und auch, wenn es mit dem kleinen Haus B10 (Werber Sobek) in der Weißenhofsiedlung wieder eine energetisch relevante Pionierleistung anzuschauen gibt, so sieht man der Stadt die Segnungen konstruktiven Erfindergeistes an vielen Stellen kaum an und spürt keine Aufbruchsstimmung.
Schon Jörg Schlaich war vor Jahrzehnten – und das macht das Einzigartige aus, ohne je damit beauftragt worden zu sein – Pionier solarer Energiegewinnung. Auch sein einstiger Mitarbeiter Werner Sobek verschrieb sich diesem Anliegen. Aber damit, dass Ingenieurbaukultur zur Identität Stuttgarts beiträgt, identifiziert sich die Stadt nicht. Tübingen als Stadt Hölderlins, Pforzheim als Schmuckstadt und Stuttgart eine Stadt der Ingenieurbaukultur? Vielleicht möchte die Stadt diesen Ruf gar nicht, weil er sie zu mehr verpflichten könnte.
Ingenieure, Gesellschaft und Politik
Andererseits ist den Bauingenieuren – das zeigte sich in Gesprächen, die ich in sieben Ingenieurbüros geführt habe – durchaus bewusst, dass dem Berufsstand insgesamt Kreativität und Bereitschaft fehlen, sich in Diskussionen zur Stadtentwicklung einzumischen oder auch ungefragt Vorschläge zu erarbeiten, die öffentlich diskutiert werden sollten. Ausnahmen bestätigen die Regel. Werner Sobek mischt sich auf vielen Ebenen in politische, gesellschaftsrelevante Diskurse ein, gründet Vereine und Stiftungen.
Durch sein berufspolitisches Engagement tauscht sich auch Stephan Engelsmann mit Kollegen anderer Disziplinen aus; er plädiert seit Langem dafür, dass ein kommunikativer Ort, eine Art Schaufenster für Architektur, Stadtentwicklung, Ingenieurbaukunst und Design gegründet wird. Zudem arbeitet er an der Neuauflage von Jörg Schlaichs »Ingenieurbauführer Baden-Württemberg«, der in dem Zuge um ein Drittel an Projekten und neue Rubriken erweitert wird.
Unisono wurden in den Gesprächen Reformen auch der Ingenieurausbildung gefordert, weil Ingenieurbaugeschichte, das Bewusstsein für eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung in der Lehre keine nennenswerte Rolle spielt – Ausnahmen sollten die Regel werden.
Handlungsbedarf und IBA
Denn in der Stadtentwicklung mit unerlässlicher Unterstützung der Bauingenieure steht eine immense Zeitenwende an. Nach einer im August 2017 veröffentlichten Umfrage des Statistischen Amts der Stadt Stuttgart nennen die Bürger als größte Probleme: 75 % zu viel Straßenverkehr, 73 % zu hohe Mieten, 67 % zu viele Baustellen, 59 % schlechte Luftqualität, 37 % zu hohe Lärmbelästigung. Hier zeigt sich die Dringlichkeit, mit der Stuttgart von und mit Bauingenieuren verändert werden müsste. Vergleiche mit Berlin seien erlaubt: 43 % der Befragten favorisieren, v. a. in den ÖPNV zu investieren. 29 % fordern mehr Geld für den Fahrradverkehr und 17 % für den Autoverkehr. (Quelle: Berlin Monitor, Civey)
Zugleich wird immer wieder anerkannt, dass sich Stuttgart in den letzten zwei Jahrzehnten auch zum Positiven verändert habe – atmosphärisch, weil viel mehr Menschen den öffentlichen Raum beleben. Noch sei auch der Charme der Topografie zu erkennen, der unter ökonomischem Druck extrem bedroht ist. Bemerkenswert dann aber doch: Wohl möchten viele junge Ingenieure in den Stuttgarter Büros arbeiten, aber nicht in Stuttgart, sondern lieber in Niederlassungen andernorts.
Alle Ingenieure sind sich der Probleme Stuttgarts bewusst und haben viel beizutragen, um die Stadt im Sinne der Lebensqualität, des Notwendigen und Modellhaften mit Einfallsreichtum und Risikobereitschaft zu entwickeln. Wo, wenn nicht in Stuttgart, wo Pioniere des Bauingenieurwesens und des Autobaus, außerdem vielfältig agierende Zulieferer zuhause sind, sollte eine Art Modellstadt für eine neue Mobilität und Stadtqualität in Angriff genommen werden? Jan Knippers und Achim Menges – Professoren an der Architekturfakultät der Uni –, erforschen und experimentieren nicht nur neue Material- und Konstruktionsweisen, sondern regen Interventionen an, mit denen Gewerbebetriebe auch in der Stadt gehalten werden könnten.
Manche Hoffnung auch der Ingenieure ruht auf der IBA, innerhalb derer sich u. a. die Ingenieurkammer engagiert. Dass sie dazu führt, Stuttgart zur international beachteten Modellstadt in umweltverträglicher Mobilität und neuem Zusammenwirken von Wohnen und Arbeiten reifen zu lassen, erwartet nach dem Fehlstart dieser IBA – noch – niemand.
Initiativen
Bis auf Leonhardt, Andrä und Partner waren alle Büros dabei, spontan und dadurch anregende, realisierbare Ideen für Stuttgarts Zukunft beizusteuern, ohne als weltfremde Utopisten abgekanzelt werden zu können. Bereits 2001 hatte Werner Sobek mit einem Vorschlag für die Überbauung der B14 – die »Kulturmeile« Stuttgarts zwischen Opernhaus und Museen – eine lange Diskussion aufgegriffen. Übrig blieb von seinen Ideen immerhin ein kleines Deckelchen über die B14, sodass Fußgänger und Fahrradfahrer einen überirdischen, angenehmen Weg durch den Verkehrsdschungel am Charlottenplatz finden können. Kleinmut und Regelungswut der Politik, so wird oft beklagt, degradieren den Erfindungsreichtum der Ingenieure nicht nur in der Landeshauptstadt beschämend. Bemerkenswert ist deswegen ein unbefangener Vorschlag des jungen Büros str.ucture, das sich auch in internationalem Rahmen forschend der Leichtbausparte widmet, für wandelbare Schirme auf der B 14.
Wandelbare Möblierung der B 14
Wandelbare Schirme könnten funktional und mit zeichenhafter Wirkung den Aufenthaltscharakter an der Kulturmeile erheblich stärken. Die Schirme sollen als Landmarke auf der B 14 zwischen der Oper auf der einen und der Staatsgalerie auf der anderen Seite verortet werden. Wenn diese geöffnet sind, ordnet sich der Autoverkehr den Passanten unter (shared space). Der Straßenraum soll so Platz für »smarte Interventionen« bereitstellen, die Kultur in den öffentlichen Raum verlagern und die Zäsur, die durch den inneren Cityring entsteht, an dieser Stelle temporär aufheben.
http://www.str-ucture.com
Grünbrücke
Ergebnis der Studie ist ein Konzept für die weltweit erste leichte Grünbrücke in dieser Größenordnung. Damit könnte künftig die Autobahn A 8 bei Stuttgart überspannt werden. Der Clou: Eine bestehende 5 m breite Massivbrücke wird durch die Addition von zwei Seilnetzen auf eine Gesamtbreite von 45 m erweitert. Hierdurch lässt sich im Vergleich zur herkömmlichen überschüttenden Tunnelbauweise eine Massenersparnis von über 90 % erzielen. Diese Lösung schont den Geldbeutel der Bauherren und die Umwelt. Für Fußgänger, Radfahrer und Tiere eröffnen sich durch das neue grüne Tor der Stadt im wahrsten Sinne neue Wege.
Die für das leichte Flächentragwerk notwendige doppelte Krümmung der Oberfläche wird mithilfe von Druckbögen und Randseilen erzeugt. Eine über dem Seilnetz liegende Membrane bildet den Untergrund für den extensiven Vegetationsaufbau. Für eine homogene Untersicht von der Autobahn wird zwischen dem Randseil und der Bestandsbrücke eine zusätzliche Membrane aufgespannt.
http://www.str-ucture.com
Mobilität und Stadtklima
Nahezu alle Stuttgarter Bauingenieure räumen einer Aufwertung des öffentlichen Raums und besserer Luft in Stuttgart nur Chancen ein, wenn Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor aus der Stadt ausgeschlossen und der Individualverkehr ohnehin drastisch reduziert wird.
Mit Verboten – auch darin herrscht Einigkeit – gehe es nicht. Thomas Auer von Transsolar fordert klipp und klar: Nur wenn der ÖPNV enorm an Quantität und Qualität und damit Akzeptanz gewinnt, kann sich in Stuttgart etwas ändern. Gewiss implizieren diese Szenarien politische Entscheidungen, aber mit Konzepten, was zur Bereicherung der Lebensqualität in Stuttgart geschehen kann, warten auch Bauingenieure auf.
Thomas Auer sieht dabei in Stuttgarts dezentralen Strukturen exzellente Entwicklungschancen – beispielsweise am Neckar-Hafen, wo modellhaft die Transformation der alten Industriestrukturen zu gut verträglichem Miteinander von Wohnen und Arbeiten gelingen könnte. Für die dicht bebauten, innerstädtischen Quartiere fordert er – der Klimaexperte – dringend viel mehr vernetzte Flächen für Pflanzen und Bäume, die für das schwierige Stadtklima unerlässlich seien.
»Die« Stuttgarter Ingenieurbautradition lässt sich kaum auf den Punkt bringen, weil sie sich dankenswerterweise mit oder besser noch: vor der Zeit vielfältig entwickelt. Es fehlt jedoch ein öffentliches Bewusstsein für die Bedeutung des Ingenieurbauwesens für die Transformation der Stadt – eine Aufgabe für die Politik und die Ingenieure selbst. Zu überlegen, wie die autogerechte Stadt zu transformieren ist, duldet allerdings keinen Aufschub mehr.
Politikwechsel
Neugestaltung der »Place de la République« in Paris (F)
Bei der konsequenten Neuordnung des zweitgrößten Platzes von Paris wiesen Politiker und Planer den Autoverkehr in seine Schranken, sehr zum Gewinn von Fußgängern und Radfahrern. Seine neue unaufgeregt, großzügige Gestaltung lässt von der ruhigen Mittagspause bis hin zur Großveranstaltung beinahe alles zu.
Frankreichs Staatspräsident François Mitterand suchte seinen Ruhm u. a. mit dem »Grand Louvre« zu mehren, Nicolas Sarkozy mag das für Kinderkram gehalten haben und lancierte gleich das epochale Projekt »Grand Paris«. Die Präsidenten der Grande Nation hoffen nicht zu Unrecht, als Bauherren vom Glanz ihrer Hauptstadt etwas abzubekommen. Doch derzeit läuft ihnen der Maire de Paris klar den Rang ab. Bertrand Delanoë, seit 2001 Bürgermeister – und das als erster »Linker« nach 1871 – setzte sich für seine Amtszeit ganz andere Ziele: Die Luftverschmutzung in Paris soll bis 2020 um 50 % gesenkt, der Autoverkehr um 40 % reduziert werden. Und die Bilanz Delanoës, der bei den Kommunalwahlen 2014 nicht mehr kandidiert, kann sich sehen lassen: Er ließ eine neue Tram als fast geschlossenen Ringverkehr um das Zentrum bauen, das Fahrradverleihsystem »Vélib« einrichten, autofreie Tage verordnen, 700 km neue Fahrradwege bauen, Strandanlagen am rechten und Fußgängerzonen am linken Ufer der Seine anlegen. Delanoë verhalf Paris in rasantem Tempo zu einer urbanen Qualität, die mehr und mehr unter Autodreck- und -lärm sowie der Aggressivität genervter Autofahrer verloren schien.
Der gesamte öffentliche Raum in Paris profitiert nun von einem Paradigmenwechsel, dem sich auch Boris Johnson in London oder Michael Bloomberg in New York verschrieben haben: Eine neu organisierte Mobilität bietet die Voraussetzung dafür, dass sich Menschen auf Plätzen und Straßen – und damit in ihrer Stadt – wieder wohlfühlen können und nicht wie gehetzte Hasen ihre Haken durch das Verkehrsgestrüpp schlagen müssen.
Der Paradigmenwechsel in der Stadtreparatur bedarf des angesprochenen politischen Willens und der Machtfülle, um ihn durchzusetzen. Vor diesem Hintergrund ist nicht nur die Place de la République sondern auch das Projekt des Uferabschnitts Les Berges, das ebenfalls in dieser Ausgabe vorgestellt wird (s. S. 26-31), zu sehen.
Republikanische Werte
Mit der stattlichen Größe von 280 x 120 m gehört »République« zu den großen Plätzen von Paris. Baron Haussmanns Verwaltung hatte 1865 eine längsrechteckige Kontur vorgesehen, die von Gabriel Davioud geplant wurde – einem erfahrenen Architekten, dem man schon die Places Saint Michel und du Châtelet verdankte.
Zu dieser Zeit hieß République noch »Place du Château d'Eau«, und man baute schnell, um zur Weltausstellung 1867 etwas vorzeigen zu können. Doch als am 4. September 1870 die neue Republik ausgerufen wurde, war der Platz noch eine Baustelle. Erst die Weltausstellung 1878 drängte zur Entscheidung. Eugène Viollet-le-Duc, seit 1874 im Conseil Municipale, wurde zur dominanten Figur des »Second Empire«, und gerade hier, an der Place du Château d'Eau, betonte er die soziale Struktur der Umgebung, die von Arbeitern bewohnt wurde und sich als Ort republikanischer Werte und Einrichtungen eignete. So wurde ein Wettbewerb für eine »Marianne« mit drei Figuren – Liberté, Fraternité, Égalité – ausgelobt, den die Brüder Léopold und François Morice gewannen. Seit dem 14. Juli 1883 dominiert die Marianne als 9,5 m hohe Bronzestatue auf einem mehr als 15 m hohen Sockel den Platz, den man 1889 zur Place de la République umbenannte.
Belastet
Bei République stoßen drei Arrondissements mit eigenen Maires aneinander, heute kreuzen sich hier fünf Metro-Linien, vier Buslinien und sieben Verkehrsachsen. Zuletzt nahm der motorisierte Verkehr zwei Drittel der Platzfläche in Beschlag – ein unhaltbarer Zustand in einem dicht bebauten und bewohnten Quartier, den das Atelier Parisien d’Urbanisme und die Direction de la Voirie et des Déplacements der Stadt zusammen mit dem Verkehrsverbund RATP grundlegend analysierte. Anschließend begannen 2008 die politischen Planungsgespräche, und bereits 2009 wurde der Umbauwettbewerb für fünf eingeladene Arbeitsgemeinschaften aus Architekten und Landschaftsarchitekten ausgelobt. 2010 folgte eine Überarbeitungsphase und 2011 stand die Planungskonzeption fest – im Juni 2013 eröffnete Delanoë den Platz.
Platz für alle(s)
Als ich mich mittags mit dem Projektleiter Vincent Hertenberger auf der Südostseite der Marianne treffe, steht die Sonne bereits im Süden und verleiht der glatten Platzoberfläche einen hellen, aber nicht grellen Schimmer – schöneres Licht kann man sich kaum vorstellen. Wer Paris noch aus den 90er Jahren kennt, staunt: Als Fußgänger ist man hier auf einmal König, und es ist nicht mehr lebensgefährlich, vom Rand zur Mitte des Platzes zu gehen. Im Gegenteil, es bereitet Vergnügen, denn die Aufmerksamkeit wird nicht mehr vom Verkehr beansprucht, man kann die Augen gefahrlos schweifen lassen, darf stehen bleiben, Skatern zuschauen und wer weiß was. Und was noch mehr beeindruckt: Es sieht so aus, als sei alles schon immer so gewesen.
Das Wichtigste: Der motorisierte Verkehr, der zuvor den Platz einschnürte und um die Marianne herum halbierte, ist im Wesentlichen an die nordwestliche Seite verlegt worden. Dadurch ließ sich der gesamte Platz als Fläche für Fußgänger, Fahrradfahrer und Skater freiräumen, die im Sinne eines »shared space« aufeinander Rücksicht nehmen müssen. Konsequent ließen die Architekten den ganzen, 2 ha großen Platz mit unterschiedlich großen Betonplatten belegen (12 beziehungsweise 14 cm dick, drei Größen: 192 x 68 cm, 95 x 34 und 48 x 17 cm). Richtung Osten ist der Platz kaum spürbar abschüssig, was aber partiell mit deutlich sichtbaren Stufen aufgefangen wird.
Im Sommer beschatten teilweise erneuerte Platanenreihen den Platz, auch Zierkirschen sind dazugekommen. Alt und Neu ergänzen sich auch im Stadtmobiliar aufs Beste. Auffällig sind 24 neue, robuste Massivholzbänke; hier setzt man sich nicht vorübergehend hin, hier möchte man eigentlich gern sitzenbleiben – so grob die Bänke im ersten Moment wirken, so deutlich tragen sie zur erstaunlich ruhigen Alltagsatmosphäre des Platzes bei. Im Sommer stehen zusätzlich Stahlstühle zur Verfügung. Die alten Métro-Eingänge blieben genauso erhalten wie einzelne, restaurierte Leuchten. Vereinzelt und am Platzrand durchgängig, ragen neue, nadelförmige Leuchten empor, die mit farbigen Lichtspielen dezent für Ab- wechslung sorgen können. Das ganze Stadtmobiliar ist harmlos, unauffällig, sympathisch – »comme il faut«.
Nicht aus Angst vor der Leere, sondern um auf dem Platz eine Differenzierung zu schaffen, entstand auf der Westseite ein kleiner Pavillon in sehr zurückhaltender Architektursprache. Das rundum verglaste Medien-Café »Mode & Médias« (mit den Architekten NP2F) steht in der Längsachse am Rande eines sehr flachen Wasserfelds, das mit Nebeldüsen bestückt ist und auf dem sich im Sommer Kinder en masse vergnügen. Jetzt im Winter ist es jedoch nicht gefüllt, weil es ebenfalls mit Betonplatten belegt ist, erweisen sich die Beckenränder dann allerdings als kleine Stolperkanten. Das Café bietet geschützte Außenplätze mit einem weiten Blick über dieses Becken hinweg auf den ganzen Platz – sofern keine Veranstaltungen stattfinden.
Die Freude am leeren, ruhigen Platz darf über eine seiner Funktionen nämlich nicht hinwegtäuschen. Ob öffentliche Konzerte, Ausstellungen, Feste, Versammlungen: Für all das ist die Place de la République explizit auch gedacht. Salopp gesagt: Es soll auch Leben in die Bude.
Verkehrt
Paris setzte mit Baron Haussmann im 19. Jahrhundert Stadtplanungsmaßstäbe. Die deutschen Stadtplanungsstrategen dieser Zeit, Camillo Sitte, Karl Henrici und Josef Stübben, kannten Paris, schätzten aber v. a. die Rolle des Verkehrs sehr unterschiedlich ein. Stübben erwies sich als Realist und maß ihm hohe Bedeutung bei. Wer konnte ahnen, dass Menschen mit dem Automobil ihre Städte ruinieren würden? Was mit der Place de la République gelungen ist, setzt erneut Maßstäbe. Die Fläche des motorisierten Individualverkehrs wurde um ein Drittel reduziert – und dieses Drittel den Fußgängern und Radfahrern unspektakulär und nicht auftrumpfend zugeschlagen. Auf höchster politischer Ebene wird ohne Umschweife benannt, dass eine Stärkung der Fußgänger und Radfahrer zulasten der Autofahrer gehen muss – eine Erkenntnis, die in Deutschland ein Tabu bricht. Fritz Kuhn, grüner Oberbürgermeister von Stuttgart, ließ in den gegenwärtigen Debatten um ein neues Verkehrsentwicklungskonzept seiner Stadt wissen: »Eine pauschale Politik gegen das Auto ist mit mir nicht zu machen.« Schade eigentlich.
Community centre
Netzwerk have created a successful interplay of architecture and town planning.
Neuhermsheim near Mannheim, a town with a population of 300,000, is a cheerless expanse of urban sprawl. A modest heart has now been implanted into this architectural no-man’s-land in the form of a new protestant community centre. At the transition between detached houses from the 1960s and mediocre multi-storey housing from the 1990s, St. Thomas’s Church owned a piece of land that became the site for the single-storey, flat-roofed building. In 2003, netzwerk architects from Darmstadt won a two-stage competition against 440 other entries. netzwerk (German for network) live up to their name: the six partners are all in their early forties, all come from the Darmstadt area, and set up a joint office in 1997. Since then they have worked alongside one another, boldly realizing a string of unconventional projects.
In this case, they won with a design that is immediately recognizable in the built result, having remained almost unchanged. In Germany, with a heterogeneous decision-making group including the pastor, representatives of the congregation and members of the town council, this amounts to a small miracle. All the more surprising since the snow-white outer shell with its curvy shapes is an unusual sight – resistance to the unfamiliar would not have come as a surprise.
Surrounded by a row of upright supports that recall plants, the community centre attracts passers-by, offering views of the interior and what lies beyond. It is set around a semi-public garden courtyard; rather than shutting itself off from its mundane surroundings, the structure of meeting hall, meeting rooms and youth centre seeks contact. The eye-catching, load-bearing outer shell consists of two basic modules: prefabricated unclad concrete components that could be installed either way up, and an all-round glass facade. The perfectly moulded concrete parts with their sophisticated geometry called for experienced and extraordinarily precise production, supplied by a manufacturer located some 200 km away.
Inside, this glaringly bright atmosphere continues. Of course, a cosy, solid atmosphere with plenty of wood and coloured walls was discussed with the community, but the architects were able to persuade all involved of the potential benefits of a white, apparently high-maintenance interior. The generously proportioned space can also be used for a range of purposes, thanks to conventional partition walls and full-length white curtains running along serpentine rails set into the ceiling. The items required for church services – organ, font, etc. – are on wheels, allowing the room to be structured and furnished differently as needed.
In this ambience of variegated white, one is easily reminded how thin the line can be between the religious and the clinical – the light of Germany’s southwest supports this balancing act. The extravagant formal idiom marks the community centre out as something special and creates a feeling of being in a town centre that is, for once, not occupied by commerce. A successful interplay, then, of architecture and town planning.
Islamic centre, Penzberg, Germany
Jasarevic Architekten’s contemporary mosque contributes to the gradual integration of different beliefs into the village of Penzberg.
South of Munich, where the Alps rise beyond Lake Starnberg, one is in deepest Bavaria, a region known for its conservative Catholicism. Here of all places, a small Muslim community has built itself a forum with prayer room in a contemporary architectural style – a courageous undertaking based on a desire for integration. The aim is to overtax neither the local residents nor the members of the community in their willingness to tolerate and engage with one another. Admittedly, the building is not right next to the church in the centre of the village, but it is within walking distance on the well-groomed periphery, a residential area on one side of the street, a DIY store on the other. With its distinctive but in no way provocative or confrontational appearance, the building and its delicate tower fit into the surroundings, where the traditional village structure has already been disrupted by deviating roof lines and ornamentation ranging from rusticity to post-war monotony.
Jasarevic Architekten from Augsburg arranged the prayer room, the communal and administrative rooms and an apartment under a single roof on an L-shaped ground plan. But the facades, which are clad in pale stone, give a clear indication of the different functions of the rooms behind – especially the slightly recessed, full-height decorative blue glass window on the east side. The entrance features two concrete slabs that swing out of the wall like open gates, inviting visitors into the house in German and Arabic script; the actual door, made of stainless steel, is open to all. Inside, one is greeted by a classical, open-plan staircase that is flooded with daylight. To the right, the view opens up into the prayer room. Shoes must be removed, but anyone may enter – women are not even required to wear a headscarf. From the side, daylight enters between curved concrete slabs, at the front the light is filtered through the blue glass. The atmosphere in this space is unusually friendly. The way the light falls draws attention to the ceiling and wall panels, where ornaments applied to the exposed concrete can be read as expressions of divine infinitude. The abstract star motifs contain the 99 Names of God – such as „The Most Merciful“ and „The Utterly Just“ – in calligraphy. This design was developed jointly by the artists Lutzenberger Lutzenberger from Bad Wörishofen and Mohammed Mandi from Abu Dhabi. The forum’s other rooms can be compared with a parish community centre: they offer German lessons, discussion and prayer meetings, the usual things.
The architect is familiar with the religion, culture, customs and mentality of Islam, and such knowledge is essential in the development of a modern religious architecture. Here in Penzberg, contemporary architecture is contributing with wise restraint to the gradual integration of different beliefs into village structures. Where places of worship cautiously distance themselves from traditional, dogmatic structures and offer comparatively free spatial interpretations of the spiritual, they genuinely promote mutual understanding between believers. What succeeded in the design of modern churches can, as here in Penzberg, be equally fascinating in contemporary Islamic architecture.