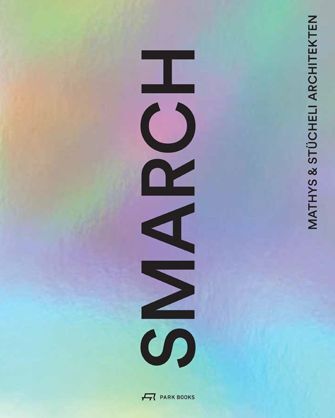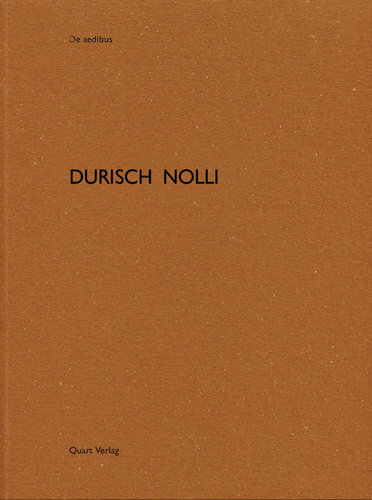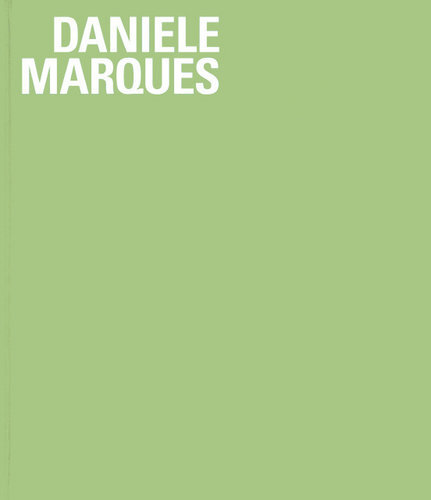Artikel
Schweizerisches Architekturmuseum unter neuer Leitung
„Deutschlandschaft“, der deutsche Beitrag zur Architektur-Biennale in Venedig 2004, katapultierte die Journalistin Francesca Ferguson ins Rampenlicht der Öffentlichkeit. Nach vielen missglückten Versuchen in den Jahren zuvor, den deutschen Pavillon zu bespielen, war der Kuratorin eine Ausstellung gelungen, die aufgrund der Auswahl der Objekte ebenso überzeugte wie durch deren Präsentation. Selbst eiligen Besuchern – und das sind angesichts der Überfülle des Angebotenen in Venedig die meisten – lieferte sie einen attraktiven Überblick über die deutsche Gegenwartsarchitektur. Umso mehr enttäuschte die im vergangenen Herbst von Ferguson und ihrem in Berlin ansässigen Produktionsbetrieb „urban drift“ realisierte Schau „Talking Cities“ im Rahmen des auf Zollverein veranstalteten Großprojekts „Entry 2006“. Die Ökonomie der Aufmerksamkeit, welche die Kuratorin in Venedig so überzeugend benutzt hatte, missachtete sie in der Essener Ausstellung gänzlich. Bedenkenswerte Konzepte verloren sich dort in einem modisch-chaotischen Arrangement, das wie ein mit philosophischen Zitaten garnierter Abenteuerspielplatz wirkte. Natürlich: Eine zeitgenössische Architekturausstellung muss nicht zwangsläufig als klassisch-kunsthistorische Dokumentation daherkommen. Aber inzwischen ist man der vorgeblich hippen Präsentationen überdrüssig, die eigentlich Kunst sein wollen, den Organisatoren viel Spaß gemacht haben, beim Besucher aber Ratlosigkeit hinterlassen.
Nun wirkt Francesca Ferguson in Basel, als neue Leiterin des dortigen Architekturmuseums. Die rührige Institution, die bereits 2005 neue Räume in der Kunsthalle Basel bezog, hat sich unter ihrer langjährigen Leiterin Ursula Jehle-Schulte-Strathaus vornehmlich der Schweizer Architektur gewidmet. Immer wieder fanden hier wichtige Präsentationen statt: frühe Ausstellungen von Herzog & de Meuron, eine Schau mit Modellen von Christian Kerez; vor zwei Jahren startete eine von Monographien begleitete Reihe über die Bauten des Novartis-Campus. Naturgemäß war ein Schwerpunkt das Baugeschehen in Basel selbst.
Doch Ferguson will mehr. Eine Namensänderung hat sie schon erreicht. Das Architekturmuseum Basel heißt nun S AM – Schweizerisches Architekturmuseum. Welch ein Etikettenschwindel! Erstens besitzt die Institution – abgesehen vom Nachlass der Basler Architekten Rasser und Vadi und der Berliner Fehling und Gogel – keine Sammlung. Und zweitens stellt das Adjektiv „schweizerisch“ gelinde gesagt eine Übertreibung dar. Das S AM erhält weder finanzielle Unterstützung durch die Kantone noch durch den Bund. Die bescheidenen Mittel werden durch eine Stiftung bereitgestellt, die weitgehend durch große Basler Architekturbüros gespeist wird.
Dass das S AM aus der regionalen Nische heraus will, ist verständlich. Laut Programm möchte Ferguson nun ihr Augenmerk auf „zeitgenössische Architektur und urbane Gestaltung aus einem transdisziplinären Blickwinkel“ richten und sich nicht mehr wie ihre Vorgängerin auf einzelne Objekte und Preziosen fixieren. Für März ist die Ausstellung „Unaufgeräumt/As found“ angekündigt, eine Schau über „Urbane Reanimationen und die Architektur minimaler Interventionen“ – das klingt wie eine Neuauflage von „Talking Cities“. Und im Sommer soll dann die Schau Instant Urbanism „den Einfluss der situationistischen Avant-Garde auf Architektur und urbane Gestaltungspraxis“ thematisieren, bevor im Herbst ei-ne gemeinsam mit dem Museo Serralves in Porto konzipierte Werkschau des portugiesischen Architekten Pancho Guedes folgt.
Bis dahin findet – zeitlich zwischen Swissbau und Basler Fasnacht – in den Räumen des S AM die Reihe „Freezone“ statt, 25 Veranstaltungen, an denen Schweizer Hochschulen, Architekturforen und Büros beteiligt sind. Laut Programm soll es „eine eklektische Reihe von Diskussionen, Workshops, Screenings und Dialogen“ sein, konzipiert von „zahlreichen Partnern und Institutionen in der Schweiz“. Dabei herrscht ein neuer Stil: Jeder, der in der Schweiz in Architektur und Architekturvermittlung tätig ist, kann mitmachen – vorausgesetzt, er finanziert seine Veranstaltung selbst. Und wer nicht selbst zahlen will, kann eben auch nichts anbieten.
Monument für ephemere Medien
Das Institut für Bild und Ton von Neutelings Riedijk in Hilversum
Hilversum gilt als die Radio- und Fernsehstadt der Niederlande. Hier nun konnte kürzlich ein nach den Entwürfen des Architekturbüros Neutelings Riedijk realisierter Bildspeicher für die audiovisuelle Kultur des Landes eröffnet werden.
Als Radios noch mit Frequenzskalen und Ortsnamen versehen waren, galt Hilversum - wie seinerzeit auch Beromünster - im Ausland als ein Sehnsuchtsort. In der Tat verdankt die Stadt auf halbem Weg zwischen Utrecht und Amsterdam ihre Bekanntheit dem Rundfunk und den Medien. Dank der idyllischen Lage in Wald und Heide des Gooilands hatte Hilversum mitsamt den Nachbarorten Bussum, Laren, Naarden oder Blaricum schon um 1900 einen Aufschwung als Gartenvorstadt von Amsterdam erlebt - Villenquartiere mit ausgedehnten Grünanlagen zeugen auch heute noch von dieser Zeit der Prosperität. Doch zu einer eigentlichen Blüte gelangte die Stadt erst, nachdem das 1916 gegründete Radio Holland sich entschlossen hatte, Produktion und Sendebetrieb nicht in Amsterdam, sondern in Hilversum anzusiedeln.
Unter der Ägide des Architekten Willem Marinus Dudok erhielt die expandierende Stadt ein eigenes Gesicht. Im Stadterweiterungsgebiet jenseits der Bahnlinie nach Amsterdam und Utrecht entstand nach 1918 das ausgedehnte Produktionsgelände der Nederlandse Seintoestellen Fabriek NSF, die später von Philips übernommen wurde. Die Rundfunkanstalten selbst entsprangen gesellschaftlichen, politischen oder religiösen Initiativen: die unabhängige Algemene Vereniging Radio Omroep (AVRO), das Arbeiterradio VARA, der christliche Rundfunk NCRV sowie die Radioanstalten der Protestanten (VPRO) und Katholiken (KRO). Die grossen Studiokomplexe aus den dreissiger Jahren liegen nördlich der Innenstadt verstreut im Siedlungsgebiet und zeugen mit ihrer eleganten und grosszügigen Architektur in hellem Klinker vom Anspruch, der sich mit dem neuen Medium verband.
Von der Radio-City zum Mediapark
Als die Rundfunkgesellschaften nach dem Zweiten Weltkrieg sich auch mit Fernsehproduktionen befassten und deshalb erhöhten Raumbedarf verzeichneten, kam es zu Erweiterungen der bestehenden Baulichkeiten. Zudem wurde die Radio-City als gemeinschaftlich nutzbares Produktionsgelände nördlich des Bahnhofs angelegt. Hier steht auch das Betriebsgebäude des Auslandradios Wereldomroep (Weltrundfunk), das van den Broek en Bakema 1961 als elegante Kreuzstruktur errichteten.
Neue private Produktionsgesellschaften haben sich inzwischen ebenfalls auf dem Areal niedergelassen, so jene von John de Mol, welche den Talk- und Quizboom der vergangenen Fernsehjahre mit prägenden Formaten gefördert hat. Mit der Neuordnung der Senderlandschaft in den neunziger Jahren sind auch die klassischen Sender in die nunmehr zum «Mediapark» erhobene Radio-City übersiedelt. Als Inkunabel der zeitgenössischen niederländischen Architektur gilt der neue Sitz von VPRO, das Erstlingswerk des erfolgreichen Architekturbüros MVRDV aus dem Jahr 1997. Höfe, Terrassen sowie wellenartig bewegte Böden und Decken bilden eine dem eher unkonventionellen Charakter des Senders entsprechende Arbeitslandschaft. Hinter dem VPRO-Gebäude wurden seither zwei weitere Neubauten realisiert: das als aufgeständerte Box in den Hang eingelassene Sendegebäude RVU, ebenfalls von MVRDV entworfen, sowie der nach Plänen von Koen van Velsen in den Wald integrierte Sitz des Rundfunkkommissariats.
Neues Wahrzeichen des Mediaparks aber ist das vor vier Wochen eröffnete Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (Niederländisches Institut für Bild und Ton), ein bunt schimmerndes Volumen über quadratischem Grundriss. Es liegt exponiert an der stadtseitigen Zufahrt zum Mediapark, gegenüber der Multatulischool von Dudok. Den Wettbewerb des Jahres 1999 hatte das Büro Neutelings Riedijk gewonnen, das zu den wichtigsten Exponenten der niederländischen Architekturszene der Generation nach Rem Koolhaas zählt. Willem Jan Neutelings und Michiel Riedijk sind bekannt für eine in starkem Masse bildhafte Architektur mit kraftvollen Formen, einer komplexen inneren Organisation sowie grafischen Oberflächentexturen. Zu ihren wichtigen Werken zählen ein Wohnturm im östlichen Hafengebiet von Amsterdam (1998), in dessen kubisches Volumen 16 unterschiedliche Wohnungstypen eingeschachtelt sind, sowie fünf sphinxartig in das Wasser des Gooimeers vorstossende Wohnbauten in Huizen, einer Vorortgemeinde von Hilversum (2003). Ein neuer öffentlicher Bau ist das Schifffahrtskolleg in Rotterdam (2005); das turmartige «Museum aan de Stroom» in Antwerpen soll in den kommenden Jahren realisiert werden.
Die private Stiftung Beeld en Geluid wurde 1997 als Zusammenschluss verschiedener audiovisueller Archive und des Rundfunkmuseums gegründet. Das Institut mit seinen 200 Mitarbeitern sammelt und konserviert die nationalen Ton- und Bildbestände, wobei in der digitalen Ära gerade die Frage des Erhalts historischer Medien die grösste Herausforderung darstellt.
Canyon, Foyer, Blackbox
Das Raumprogramm, mit dem Neutelings Riedijk sich konfrontiert sahen, vereint drei Nutzungen: ausgedehnte Magazine, Büros für die Mitarbeiter und Publikumsbereiche. Zunächst dachten die Architekten an einen Turm, wie sie ihn auch in Antwerpen errichteten, doch liess die für das Areal geltende Baugesetzgebung nur eine Höhe von maximal 26 Metern zu. Daher entschied man sich, den Turm zur Hälfte versinken zu lassen und grosse Teile des Raumprogramms im Untergrund anzusiedeln. Betritt man das Gebäude durch den Haupteingang, so quert man zunächst auf einer Brücke eine Art Canyon. Atemberaubend ist der Blick hinunter in die Tiefe auf fünf terrassiert gestaffelte Geschosse für das Archiv. Die Idee der Abtreppung kehrt im grossen Foyer wieder, das sich quer durch das Gebäude erstreckt und dessen gesamte Höhe einnimmt: Der vertikalen Raumschicht mit den Büros im Westen steht die geschlossene, mit Metallelementen verkleidete Front der Ausstellungsbereiche gegenüber, die von Geschoss zu Geschoss weiter auskragt. Das zur Südfront mit dem Wasserbecken orientierte Selbstbedienungsrestaurant besteht ebenfalls aus einem abgetreppten Katarakt aus Sitzbereichen.
Über der Ebene mit zwei Film- und Vortragsräumen sowie einem grossen Saal für Wechselausstellungen erreicht man die «Media Experience», die als Blackbox in einem nachtblau gestrichenen Raum von 52 Metern Länge, 28 Metern Breite und 12 Metern Höhe eingerichtet ist und durch diverse Emporen und Einbauten gegliedert wird. Nach der Art eines Science-Museums finden sich hier 15 Themenpavillons, die Wissen vermitteln und zugleich unterhalten sollen. Die Besucher können hier den Betrieb eines Fernsehstudios erleben, sollen aber auch zu kritischer Reflexion animiert werden. Ob das funktioniert, bleibt fraglich: Manches wirkt allzu seicht, und die historischen Exponate gehen in der Masse von Hands- on-Displays unter, welche um die Aufmerksamkeit des Publikums buhlen.
Höchst eindrucksvoll indes sind die Fassaden des Baus. Der Videokünstler Jaap Drupsteen hat aus der niederländischen Fernsehgeschichte Hunderte von Bildern ausgewählt, diese durch digitale Modifikation horizontal verwischt und mit Farbpulver auf die Glasscheiben aufgedruckt. In einem durch Matrizen vorbereiteten Sandbett wurden die Scheiben anschliessend erneut gebrannt. Während die Fassade aus der Ferne wie ein unscharfes Testbild erscheint, lassen sich aus der Nähe einzelne Details erkennen. Eine Ausstellung im Museum Hilversum informiert über das Werk von Jaap Drupsteen und den aufwendigen Herstellungsprozess der Fassadenhaut. Ergänzend sind auch beleuchtete Modelle der wichtigsten Projekte von Neutelings Riedijk zu sehen.
[ Die Ausstellung «Over Beeld en Geluid» ist im Museum Hilversum bis zum 6. Mai zu sehen; kein Katalog. ]
Licht und Klarheit
Bis Mitte des 20. Jahrhunderts blieb das Gebiet des Tisner Mittelgebirges eine abgelegene Region Südtirols. Obwohl nur jeweils etwa 15 Kilometer von Bozen und Meran entfernt, konnten die Gemeinden hier weder von der Verwaltungshauptstadt noch vom weltberühmten Kurort profitieren. So wurde auch Prissian erst entdeckt, als es die Massenmobilität erlaubte, in ent-legene Gegenden vorzudringen. Mit dem Salus-Center, das sich geschickt in die Struktur des Ortes und die umgebende Landschaft einpasst, gibt es nun – zumindest für Architekturinteressierte – einen weiteren Grund, diese Region aufzusuchen.
Orte, die nahe an Meran liegen, gerieten bereits gegen 1900 in den wirtschaftlichen Sog des Modebades – so etwa Algund oder Lana, wo Theodor Fischer zwischen 1909 und 1911 ein Schulhaus mit Beetsaal errichtete. Tisens und Prissian liegen unweit von Lana, aber 300 Meter höher in einer Mulde, die durch einen bewaldeten Höhenzug vom traditionell verkehrsreichen Etschtal abgegrenzt ist. Ein Eisenbahnanschluss war unmöglich, und bis zur Einweihung der Straße auf den Gampenpass verbanden einzig Karrenwege die Orte mit dem Tal. Die Stunde für die touristische Entdeckung – und damit den Strukturwandel des Gebietes – schlug im Zusammenhang mit der zweiten touristischen Entdeckung Südtirols nach dem Zweiten Weltkrieg. Es waren vornehmlich Deutsche, die auf dem Weg mit dem Privatwagen in der Region von Etsch und Eisack Zwischenstation machten. Doch der Massentourismus zeigte sich janusköpfig, hier wie anderenorts. Gewiss war er in einer Zeit des sukzessiven Strukturwandels in der Landwirtschaft Quelle neuen Wohlstandes, mehr noch: eines flächendeckenden Wohlstandes überhaupt. Andererseits ging er einher mit einer willfährigen Ausrichtung auf die Südtirol-Klischees der Besucher: Pseudo-Tirolererstil umhüllte die Apartmentkomplexe.
Auch die Orte Prissian und Tisens wurden erst im Zuge der einsetzenden Massenmobilität entdeckt. Trotz der wuchernden Apartmenthäuser und mancher historisierenden Verkitschung haben die Ortsbilder ihren historischen Charakter bewahren können – was besonders ins Auge sticht, wenn man vom zersiedelten Lana aus hinauffährt. Heute ist es die Südtiroler Weinstraße, die hier entlangführt. Rebberge und Apfelplantagen säumen den Weg, der zunächst nach Tisens führt, in den Gemeindehauptort; dann folgt die Straße den sanften Kanten der voralpinen Berge in die benachbarte Fraktion Prissian, gelegen auf gut 600 Metern Höhe. Markant haben sich zwei alte befestigte Wohnsitze in das Weichbild des Ortsteils eingeschrieben: Das Geviert des Schlosses Katzenzungen, exponiert etwas außerhalb des Siedlungsgebiets gelegen, sowie die Fahlburg, die sich an die Dorfstruktur anschließt. Ihnen antwortet seit jüngstem die Rehabilitationsklinik Salus-Center am westlichen Dorfrand.
Christoph Mayr Fingerle, der sein Büro in Bozen betreibt, ist ein Architekt, der sich schon um die Südtiroler Architektur
verdient machte, als der Aufschwung der letzten Jahre noch nicht abzusehen war. Er leitete einen neu gegründeten Kunstverein, engagierte sich für den Sextener Wettbewerb »Neues Bauen in den Alpen« – und konnte nur vergleichsweise wenig bauen.
Auftrag per Zufall
Zu dem Auftrag für die Rehabilitationsklinik – behandelt werden hier orthopädische, kardiologische, onkologische, neurologische und pneumologische Leiden – kam er eher durch einen Zufall: Die Betreiber der neuen Einrichtung, die in ähnlicher Weise schon ein umgebautes Hotel in Prissian nutzen, waren mit dem Konzept eines von ihnen in Auftrag gegebenen Neubaus für eine Rehabilitationsklinik am westlichen Dorfrand unzufrieden und konsultierten daher den Bozener Architekten. Eines der grundlegenden Probleme bestand darin, dass gemäß dem vorliegenden Entwurf die Erschließung von Norden, von der Talmulde aus erfolgte – obwohl bei den historischen Bauten wie dem Schloss Katzenzungen eine genau umgekehrte Strategie verfolgt worden war. Man betritt das Schloss bergseitig, also von Süden, so dass sich Richtung Norden das Panorama Richtung Etschtal ungestört zeigt. Am Ende der Konsultation war das Bauprojekt an Christoph Mayr Fingerle übertragen worden, der sich nun allerdings an einen knappen Terminplan und an ein streng limitiertes Kostenbudget gebunden sah.
Die Aufgabe bestand darin, ein Gebäude für ein Rehabilitationszentrum mit 90 Betten und den nötigen medizinischen und therapeutischen Einrichtungen zu realisieren. Derlei Bauaufgaben werden heutzutage gerne spezialisierten Fachplanern anvertraut. Doch Mayr Fingerle ist es gelungen, bei aller geforderten binnenorganisatorischen Effizienz zwei Grundgedanken in Architektur umzusetzen: Eine klare, fast könnte man sagen simple Organisationsstruktur, die allen Patienten die Orientierung erlaubt sowie die Einbeziehung der umliegenden Landschaft. Aus gutem Grund, weiß man doch, dass das Wohlbefinden der Menschen sowie der Heilungsprozess wesentlich von psychosomatischen Faktoren bestimmt werden.
Grosses Volumen geschickt integriert
Der Architekt bündelte das geforderte Raumprogramm in einem kompakten orthogonalen, durchaus mächtigen Volumen, das sich am Rande des Dorfes auf einem schon für das Vorgängerprojekt fixierten Platz erhebt. Horizontal übereinandergeschichtet und durch Form und Materialisierung voneinander abgesetzt sind drei Raumbereiche: das geschlossene Sockelgeschoss, welches das abfallende Terrain ausgleicht, das zurückgesetzte, großflächig verglaste Erdgeschoss – und schließlich das auskragende zweigeschossige Volumen der Zimmergeschosse. Dieser Bettentrakt ist als Winkel entlang der Nord- und Westseite organisiert, so dass das Rehabilitationszentrum von der Ferne aus kompakt wirkt, während es sich zum Dorf hin öffnet.
Die klare und übersichtliche Organisation findet im Inneren, das sich um einen verglasten Hof gruppiert, ihre Fortsetzung. Das Erdgeschoss umfasst die öffentlichen Bereiche: die Rezeption, eine Bar an der Eingangsseite, das Restaurant an der Nordwestecke mit Blick Richtung Meraner Becken, außerdem Massageräume, Bereiche für die Ärzte und Behandlungszimmer. Im Sockelgeschoss sind Fitnessräume, Therapiebereiche und ein Hallenbad integriert, das erst relativ spät Eingang in das Bauprogramm fand. Die beiden Obergeschosse sind den Patienten vorbehalten: Die Ein- und Zweibettzimmer werden durch mittige Flure erschlossen, und jedem Zimmer ist ein Bereich der Terrasse zugewiesen, so dass man sich an die klassische Sanatoriumsarchitektur des alpinen Raumes erinnert fühlt. Den spekatulärsten Ausblick haben die nach Norden hin orientierten Zimmer; hinter der Talmulde und dem vorgelagerten Höhenrücken ist das Etschtal zu erahnen, und der Blick schweift von der Meran überragenden Texelgruppe bis hin zu den Bergen östlich und südlich von Bozen. Der Blick aus den nach Westen, Osten und Süden ausgerichteten Räumen ist nicht ganz so spektakulär, dafür besitzen diese Zimmer den Vorteil der direkten Sonneneinstrahlung. Trotz eines knappen Budgets etwa 10 Millionen Euro ist es dem Architekten gelungen, ein Maximum an Aufenthaltsflächen zu schaffen. Die Patienten sollen – nicht zuletzt aus therapeutischen Gründen – animiert werden, im Haus umherzugehen und das Haus zu umrunden; daher der wie ein Kreuzgang funktionierende, mit 150 Birken bepflanzte Innenhof und die weite talseitige Auskragung, die es erlaubt, auch bei schlechtem Wetter die Außenbereiche zu nutzen. Großzügigkeit und Helligkeit prägen die Innenbereiche, und man fühlt sich eher an ein Hotel oder Seminarzentrum erinnert als an ein Krankenhaus. Überall kann der Blick in die sich je nach Jahreszeit wandelnde Umgebung schweifen, auf die Obstwiesen und die fernen Gipfel; und wo das nicht möglich ist, orientieren sich die Räume zum Lichthof.
Zusammenspiel der Disziplinen
Zur Anmutung des Baus tragen in erheblichem Maße die Interventionen des Künstlers Manfred Alois Mayr bei, den Mayr Fingerle als künstlerischer Leiter der Arge Kunst in Bozen Mitte der achtziger Jahre kennen gelernt hat und der seither bei den meisten Projekten als Gesprächspartner und Künstler mitwirkt. Aus diesem kreativen Dialog zwischen Architektur und Kunst enstand für Südtirol eine Vorreiterfunktion, die in der Folge zu einer neuen Interpretation des Landesgesetzes und auch zu Aufträgen von anderen Architekten geführt hat. Mayr hat die in leichtem Albicocca-Farbton gestrichenen Zimmer mit jeweils zwei Vorhängen versehen, einem orangefarbenen und einem grünen. Je nach Wunsch können die Patienten den einen, den anderen oder beide nutzen und damit die Raumstimmung verändern. Mayr war außerdem für die Farbgebung des Foyer- und Empfangsbereichs verantwortlich. Die vergleichsweise niedrige Decke, die schon Mayr Fingerle mit runden Öffnungen durchbrochen hat, um den Raum transparenter, lichter und großzügiger erscheinen zu lassen, hat der Künstler in einem leichten Rosa gestrichen. Wenn die Sonne scheint, ist das kaum spürbar, aber in der Dämmerung, wenn sich das Kunstlicht dem Tageslicht beigesellt, entsteht eine Stimmung, welche die Raumgrenzen zu transzendieren scheint.
Eine Kommandobrücke für die Kunst
Das neue Institute of Contemporary Art in Boston
Museumsarchitektur ist in den USA zum wichtigsten Betätigungsfeld innovativer Architekten geworden. Für das Institute of Contemporary Art realisierten Diller & Scofidio im Hafen von Boston ein neues Domizil. Bekannt geworden sind die Architekten durch ihre Expo-Wolke.
Vor gut zwanzig Jahren fing Boston an, die historischen Hafenareale zu reaktivieren. Zur touristischen Attraktion wurde das Gebiet von Long Wharf, wo sich heute das New England Aquarium befindet. Ringsum zeugen Neubauten mit luxuriösen Condominiums vom Interesse an wassernahen Wohnlagen, die überdies durch die unmittelbare Nachbarschaft zum Financial District begünstigt sind. Auch die südlich anschliessende Gegend am Fort Point Channel unterliegt der Transformation: Inmitten des als Hafenbecken ausgebildeten Stichkanals entsteht das Museum der «Boston Tea Party» neu, in der Nähe hat unlängst das Children's Museum in einem alten Lagerhaus eröffnet, und weiter östlich liegt das neue Kongresszentrum von Rafael Viñoly. Unweit davon befindet sich das städtebauliche Entwicklungsgebiet des Fan Pier, wo sich seit neustem inmitten von Brachen und Parkplätzen, aber direkt am Quai der Neubau des Institute of Contemporary Art (ICA) erhebt. Dieser führt den internationalen Boom im Bereich der Kulturbauten fort und beweist einmal mehr, dass Museumsarchitektur in den USA zum wichtigsten Betätigungsfeld innovativer Architekten geworden ist.
Maschine der Wahrnehmung
Die 1936 als Boston Museum of Modern Art gegründete und 1948 in ICA umbenannte Institution war die erste in den USA, die das Adjektiv «contemporary» im Titel führte. Lange Jahre nutzte das ICA, das sich mit vielbeachteten Wechselausstellungen zeitgenössischer Kunst sein Renommee erwirkte, einen umgenutzten Altbau im Stadtviertel Back Bay, bis sich mit der Parzelle auf dem Fan Pier die Chance zu einem Neubau ergab. In einem Wettbewerb des Jahres 2001 konnte sich das New Yorker Architekturbüro von Elizabeth Diller und Richard Scofidio gegen die Konkurrenz von Office dA aus Boston, Studio Granda aus Reykjavik und Peter Zumthor durchsetzen. Diller & Scofidio, denen sich 2004 Charles Renfro beigesellte, wurden mit Projekten im Grenzbereich zwischen Kunst und Architektur bekannt, etwa dem als Expo-Wolke bekannten «Blur Building». Obwohl sie sich derzeit mit einer Reihe grosser Projekte wie dem Umbau des Lincoln Center oder der Umnutzung eines S-Bahn- Trassees in New York befassen, ist das ICA ihr erstes eigenständiges Gebäude in den USA.
Der «Harbor Walk», der künftig durch die ausgedehnten Hafenareale von Boston führen soll, bildete den Ausgangspunkt für die Idee des Gebäudes. Eine dem Baukörper seeseitig vorgelagerte, mit Holz beplankte Plattform verwandelt sich in eine grosszügige Freitreppe, die sich im Inneren in den Sitzstufen eines Auditoriums mit 325 Plätzen fortsetzt und schliesslich, in die Horizontale umgelenkt, die darüber befindlichen Ausstellungsbereiche trägt. Auf der Ausstellungsebene erreicht das Gebäude seine maximale Ausdehnung: Während es im Süden, Westen und Osten der Geometrie des dreigeschossigen Sockels folgt, kragt es nach Norden, also seeseitig, weit über den Vorplatz aus und definiert diesen als überdeckten Aussenraum; die Planken des Bodens finden ihren Widerhall in der Holzverkleidung der Untersicht der Auskragung.
Unverkennbar orientierten sich Diller & Scofidio bei der Grundkonzeption ihres Baus an der neusten niederländischen Architektur, und wie bei Rem Koolhaas oder Ben van Berkel entwickeln sich Boden, Wand und Decke als Kontinuum, das in den Seitenansichten ablesbar wird. Konstruktiv arbeiteten sie mit einer Tragstruktur aus Stahlbeton, über der das Stahlfachwerk der oberen Ausstellungsebene lagert. Fassadenelemente aus transparentem und transluzentem Glas umhüllen das gesamte Volumen, das sich zunächst ansteigend im Sockel konzentriert, um dann in einer grossen Geste Richtung Wasser vorzustossen. Es ist eine Maschine der Wahrnehmung: eine Kommandobrücke für die Kunst, die sehnsüchtig die Blicke aufs Meer lenkt und doch die nötigen Räume für die Konzentration bereithält. An diesem heterotopischen Ort mag man an Michel Foucault denken, der einst formulierte, das Schiff sei die Heterotopie schlechthin, und in Zivilisationen ohne Schiffe versiegten die Träume.
Blicke auf das Wasser
Foyer, Shop und Restaurant befinden sich im Erdgeschoss, in den beiden Ebenen darüber das Theater sowie die Verwaltung. Die abschliessende, zenital belichtete Ausstellungsebene gliedert sich in zwei parallele Raumstrukturen, welche durch einen zum Meer hin panoramisch verglasten Gang verbunden sind. Der westliche Bereich ist als gewaltiger stützenfreier Saal grossen Wechselausstellungen vorbehalten, während auf der Ostseite Teile der permanenten Sammlung zu sehen sind. Aus der Mittelzone heraus entwickelt sich das Medienzentrum, das wie ein Schwalbennest unter dem Boden hängt; durch ein Fenster hindurch blickt man auf das Wasser, sieht aber weder Boden noch Himmel oder Horizont.
Nach einer heute beginnenden Serie von privaten Openings empfängt das neue, von Jill Medvedow geleitete ICA vom 10. Dezember an das breite Publikum. «Super Vision» heisst - passend zum Gebäude - die Hauptschau, die 27 künstlerische Positionen zur Frage heutiger Wahrnehmung versammelt. Vertreten sind unter anderem Chantal Akerman, Tony Cragg, Harun Farocki, Anish Kapoor, Tony Oursler und James Turrell. Kleinere Ausstellungen gelten dem argentinischen Künstler Sergio Vega und den Finalisten des diesjährigen ICA-Preises. Schliesslich hat die Japanerin Chicho Aoshima die jährlich neu zu bespielende «Art Wall» im Erdgeschoss gestaltet.
Zurück an die Schelde
Vielfältige Ansätze zu einer Stadterneuerung in Antwerpen
Obwohl in Antwerpen Rechtsextremisten immer wieder für Schlagzeilen sorgen, ist die Stadt weiterhin weltoffen - auch auf dem Gebiet der Architektur. Davon zeugen die Pläne für die Bebauung der historischen Hafenareale - und der neue Justizpalast von Richard Rogers.
Lange galt die Schelde als Lebensader Antwerpens. Dem Handel verdankte die 60 Kilometer vom Meer aus flussaufwärts gelegene Stadt ihren Wohlstand, und der Hafen ist nach Rotterdam der zweitgrösste Europas. Allerdings hat die Stadt den Bezug zum Wasser verloren, seit der Hafen sich flussabwärts in Richtung niederländische Grenze verlagert. Wie in den meisten Häfen der Welt wurden auch hier mit dem Siegeszug des Containerschiffs eine tiefgreifende Veränderung der Verladelogistik und eine Ausweisung neuer Hafenareale nötig - mit der Konsequenz, dass die stadtnahen historischen Quaianlagen nicht mehr benötigt werden.
Stadt am Strom
Während es Hamburg überaus erfolgreich gelungen ist, seinen Hafen als wichtigsten Identitätsfaktor zu positionieren, und auch Rotterdam mit der Bebauung auf Kop van Zuid am Südufer der Maas internationale Aufmerksamkeit erzielen konnte, erfolgt der Transformationsprozess am Ufer der Schelde eher zögerlich. Die meisten Besucher, die vom grandiosen Fin-de-Siècle-Kuppelbau der Centraal Station durch die Einkaufsstrasse Meir in die Altstadt mit ihrer Platzfolge aus Groenplaats, Koornmarkt und Grote Markt gehen, nehmen wohl den Fluss nicht einmal wahr. Ohnehin ist das jüngste Image Antwerpens das der Modemetropole. Vor 25 Jahren graduierten die legendären «Antwerp Six» - Walter van Beirendonck, Ann Demeulemeester, Marina Yee, Dirk van Saene, Dries van Noten und Dirk Bikkembergs - an der Modeabteilung der Kunstakademie und verhalfen der Stadt zu einem neuen Selbstverständnis: Die Ateliers der Modeschöpfer, die Ausstellungen des Modemuseums MoMu und Events wie der «Fashion Walk» ziehen ein junges, trendorientiertes Publikum in die Stadt der flämischen Renaissance.
«Stad aan de Stroom» heisst ein von Stadtverwaltung und Hafenbehörde gemeinsam erarbeitetes Leitbild für die Umnutzung der historischen Hafenareale. Waren die Schiffe zuvor direkt an den Scheldequais vor Anker gegangen, entstanden - nach der durch die französische Besatzung (ab 1792) angeordneten Schleifung der Befestigungsanlagen - von den Gezeiten unabhängige, durch Schleusen abgetrennte Hafenbecken unmittelbar nördlich des Zentrums. Westöstlich ausgerichtet sind Bonaparte- und Willemdok, nach Norden schliesst sich rechtwinklig dazu das Kattendijkdok mit seinem Gefieder aus Trockendocks an, von dem aus eine Reihe weiterer Becken zu erreichen ist. «Eilandje» heisst das Areal mit seinen insgesamt 172 Hektaren Fläche. Die Umnutzung begann Mitte der neunziger Jahre mit einer Studie des spanischen Architekten Mauel de Solà-Morales, die 1998 in einen Masterplan mündete. In einer ersten Phase konzentriert man sich auf die südliche Hälfte des Gebietes, die sich wiederum in drei unterschiedliche Teilbereiche gliedert. «Oude Dokken» ist der Bereich um Bonaparte- und Willemdok, der unmittelbar an das historische Zentrum angrenzt.
Die noch vorhandenen Lagerhäuser des 19. Jahrhunderts - zu den eindrucksvollsten zählt das Stapelhuis Sint-Felix aus dem Jahr 1863 - werden zu Lofts und Büros umgewandelt und durch Bebauungen ergänzt, welche die Blockstruktur ergänzen. Zum Wahrzeichen des Areals soll das auf der Halbinsel zwischen beiden Hafenbecken geplante Museum aan de Stroom (MAS) werden. In dem turmartigen Gebäude über quadratischem Grundriss finden die Sammlungen des Nationalen Schifffahrtsmuseums, des Volkskundemuseums und des Museums Vleeshuis ihr neues Domizil. «Stapelhuis» nennt das Architekturbüro Neutelings Riedijk sein im Jahr 2000 zur Ausführung bestimmtes Konzept für den Hanzesteden Plaats. Schichten, Stapeln und Verbinden sind zentrale Themen der Planer aus Rotterdam, und so besteht das markante Volumen aus übereinander placierten Boxen, die durch spiralförmig entlang der Aussenfassade sich in die Höhe schraubende Treppen erschlossen werden.
Das MAS besitzt künftig eine Reihe von Dépendancen. Dazu zählen ein Seezeichenpark im Stadtteil Linkeroever auf der anderen Seite der Schelde, der historische Hafen im Bonapartedok, vor allem aber das Red Star Line Memorial. Zwischen 1873 und 1935 brachten die Dampfer der Reederei Red Star Line drei Millionen Auswanderer in die USA und nach Kanada; Antwerpen avancierte neben Bremerhaven und Hamburg zum wichtigsten europäischen Auswandererhafen. Nicht zuletzt das zunehmende Interesse der Amerikaner an den Wurzeln in der Alten Welt hat die Emigrationsströme in den letzten Jahren zu einem wichtigen Forschungsgegenstand werden lassen. Davon zeugen das unlängst eröffnete Auswandererhaus in Bremerhaven - und demnächst auch die zu einem Museum umgewidmeten, eher unscheinbaren Ziegelhallen der Red Star Line in Antwerpen.
Das auf den Umgang mit historischen Bauten spezialisierte New Yorker Architekturbüro Beyer Blinder Belle, welches schon das Immigrationsmuseum auf Ellis Island konzipiert hat und auch für die Renovierung des Grand Central Terminal verantwortlich zeichnete, gewann im April 2006 den Wettbewerb für die Antwerpener Gedenkstätte. Die Lagerhäuser ringsum, welche inzwischen eine Reihe kultureller Institutionen beherbergen, prägen das Quartier Montevideo, das sich zwischen Schelde und Kattendijkdok erstreckt. Die Hangars am Scheldeufer mit einer Phalanx alter Kräne haben inzwischen neue Nutzungen gefunden, während die Realisierung von sechs das Westufer des Kattendijkdoks flankierenden Hochhäusern noch auf sich warten lässt. Weit vorangeschritten ist die Planung der beiden Bauten von Diener & Diener, es folgen die Turmpaare von David Chipperfield sowie von Gigon Guyer. Mit Blockrandbebauungen vorrangig dem Wohnen vorbehalten bleibt das Quartier Cadix auf der anderen Seite des Hafenbeckens.
Segel über der Stadt
Antwerpens Stadtentwicklung konzentriert sich neben dem Eilandje auf fünf weitere Gebiete, so die Umgebung der Centraal Station, wo Michael Graves schon 1997 am Koningin-Astrid-Plein ein Hotel realisierte, oder das aufgelassene Gleisareal im Nordwesten der Stadt («Spoor Noord»). Von besonderer Bedeutung ist der «Zuidrand», die südliche Stadtkante zwischen Scheldeufer, Innenstadt und Autobahn. Als markantes Bauwerk und städtebauliches Scharnier ist hier in der Achse der Amerikalei der im vergangenen Frühjahr eingeweihte Justizpalast entstanden, in dem die über verschiedene Standort verteilten Justizbehörden vereint wurden. 1998 hatte der inzwischen zum Spezialisten für Justizgebäude gewordene Richard Rogers den internationalen Wettbewerb für sich entscheiden können.
Die radial auf den Bolivarplaats zustrebenden Strassen haben mit Rogers' Bau ein Gegenüber, ja einen Point de vue gefunden. Dabei bleibt der Londoner Architekt seiner Skepsis gegenüber Pathosformeln treu, auch wenn er mit der Tradition des Repräsentativen spielt. Der Gerichtskomplex mit seinen sechs Trakten ist spiegelsymmetrisch angelegt und wird von einer zentralen Halle aus erschlossen, zu der auch eine Freitreppe hinaufführt. Doch die Treppe, gestützt von schwefelgelben Stahlträgern, besteht aus Holzplanken und führt in eine lichtdurchflutete Foyerhalle. Von hier aus erreicht man die 6 grossen und 26 kleinen Gerichtssäle, welche die oberste Ebene der jeweils drei Trakte zur Rechten und zur Linken einnehmen und die gesamte Justizverwaltung mit den drei Geschossen darunter gleichsam in den Sockel zwingen. Dachelemente aus hyperbolischen Paraboloiden überdecken die Säle. Sie bestehen aus einer Holzfachwerkkonstruktion und sind aussen mit Stahlblech überzogen. In die Höhe gezogen und auf der sonnenabgewandten Seite verglast, dienen sie zugleich der Belichtung. Die sich aufgipfelnde Dachlandschaft mag an Haifischflossen erinnern. Richard Rogers war indes laut eigenem Bekunden von den Segelschiffen auf den Seestücken des niederländischen Barock inspiriert. So kann man auch den neuen Gerichtshof als eine Hommage an die neu zu entdeckende maritime Tradition der Scheldestadt verstehen.
Helvetischer Höhenrausch
Die Schweiz erlebt das Comeback der Hochhäuser
Während Jahrzehnten waren Hochhäuser in der Schweiz kein Thema mehr. Nun aber sollen sich wieder Türme in die Skylines unserer Städte einschreiben. Jüngste Beispiele für diese Entwicklung sind die Projekte skulpturaler Hochhäuser in Zürich, Basel, Locarno oder Davos.
Der vor gut drei Jahren eingeweihte Messeturm in Basel, der vom ortsansässigen Büro Morger & Degelo zusammen mit Daniele Marques aus Luzern entworfen wurde, gilt mit seinen 105 Metern als das höchste Haus der Schweiz. Der Höhe zum Trotz übten sich die Architekten in Zurückhaltung: Schon der enge Kostenrahmen erlaubte keine formalen Eskapaden. Klare, kubische Geometrien bestimmen den Bau, der ein unübersehbares Wahrzeichen darstellt und sich doch in die städtebauliche Struktur Kleinbasels einfügt. Aber lange wird der Turm seine Spitzenposition unter den Schweizer Hochhäusern kaum behaupten können: Auf dem Maag-Areal an der Zürcher Hardbrücke planen Gigon/Guyer den 126 Meter hohen «Prime-Tower», und das wohl aussergewöhnlichste Projekt stellt der schlicht «Bau 1» genannte Turm von Herzog & de Meuron dar, der sich im Jahr 2011 auf dem Basler Roche-Areal 160 Meter in den Himmel recken soll.
Renaissance des vertikalen Bauens
Mit einiger Verspätung erlebt die Schweiz derzeit das, was in anderen Ländern längst Tatsache ist: die Renaissance der Hochhäuser. Wolkenkratzer und helvetisches Selbstbewusstsein schienen sich lange kaum zu vertragen: Das lange Zeit eher rural geprägte Selbstverständnis des Landes widersprach dem Drang in die Vertikale. Das änderte sich vorübergehend in den fünfziger und sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts. In Zürich läuteten 1952 die skandinavische Vorbilder adaptierenden Wohnhochhäuser von Heinrich Albert Steiner eine neue Ära ein; sie fand ihre Fortsetzung im Stakkato der Bürotürme am Schanzengraben und kulminierte schliesslich in der Bebauung des Locherguts und in den von Max P. Kollbrunner 1978 realisierten Hardau-Türmen. Mit den bis zu zwanziggeschossigen Wohnkomplexen Tscharnergut, Fellergut und Gäbelbach entstand im Westen Berns seit 1958 die wichtigste Satellitenstadt der Schweiz; dass sich auch kleinere Städte dem Höhenrausch nicht versagten, wird offenbar, wenn man offenen Auges eine Fahrt durch das Mittelland unternimmt.
Gegen Ende der siebziger Jahre hatten die Türme hierzulande eine - im Vergleich mit anderen Ländern - eher moderate Höhe von 70 bis 90 Metern erreicht; danach war erst einmal Schluss. Die Grenzen des Wachstums dämmerten am Horizont auf, bauliches Korrelat war die Stadtreparatur. «Die Stadt ist gebaut», lautete die Devise - keine günstige Zeit also für himmelstürmende Visionen. Zwei Jahrzehnte später hat sich die Situation grundlegend gewandelt. Die einst inkriminierten Betongebirge der sechziger und siebziger Jahre werden von einer jüngeren Planer- und Architektengeneration zumindest ästhetisch durchaus wieder goutiert; und das Hochhaus als Wohnform könnte Zukunft haben. Man erkennt, dass die Projekte vergangener Dezennien nicht an den Bauten selbst, sondern an einer falschen Mieterpolitik sowie an mangelnder Zielgruppenkompatibilität gescheitert sind.
Cockpit über der Stadtlandschaft
Heutige Wohnhochhaus-Konzepte zielen denn auch nicht auf kinderreiche Familien des unteren Mittelstands, sondern auf einen Lebensstil, der zu einem Cockpit über der Stadtlandschaft passt. Singles, Dinks (double income, no kids) und Angehörige von «Kreativbranchen» gehören zur avisierten Zielgruppe der neuen «Urbaniten». Das im Auftrag der Stadt Zürich von Theo Hotz geplante kleeblattförmige Hochhaus am Escher- Wyss-Platz, dessen Ausführung nun durch Rekurse verhindert werden soll, zählt mit seinen 90 Metern zu den neuen Projekten für das Wohnen in der Höhe. Noch aussergewöhnlicher ist das Neubauprojekt von Herzog & de Meuron für ein zylindrisches Turmhaus hoch über Davos, das neben Hotelräumen vor allem Apartments aufnimmt, die zur Querfinanzierung des altehrwürdigen Schatzalp-Hotels beitragen sollen.
Hochhäuser mit Mietwohnungen, für die es in den städtischen Agglomerationen durchaus Bedarf gäbe, könnten den überhitzten Wohnungsmarkt entlasten - wenn es ein Ausnützungsbonus erlaubte, mehr Bruttogeschossfläche als mit einer niedrigen Bebauung zu realisieren. Die baurechtlichen Regelungen sehen diesen Fall indes nicht vor. Überhaupt gewinnt man den Eindruck, dass die Kommunen die Potenziale (und Risiken) des Hochhausbaus noch kaum erkannt haben und den Begehrlichkeiten von Investoren hinterherhinken. Immerhin wurde aber 2001 in Zürich ein Planwerk erlassen, das Areale definiert, innerhalb deren Hochhäuser errichtet werden können. Gleichzeitig fixiert es jene Gebiete, in denen vertikale Dominanten aus Sicht der Planer unerwünscht sind. Erwünscht sind sie dagegen in der Neustadt von Locarno, wo an der Megarotonda ein Palacinema genannter Turm für das Filmfestival mit Kino- und Hotelnutzung entstehen soll.
Unverwechselbarkeit
Bei den meisten der derzeit diskutierten Projekte handelt es sich um Bürohäuser. In Zeiten, da verstärkt von Branding, Identität und Marketing die Rede ist, schaffen Hochhäuser eine unverwechselbare Adresse. Diese mag für die von einer gewissen Gebäudehöhe an unvermeidlich wachsenden Baukosten entschädigen. Während in Städten wie London, Paris oder Frankfurt - ganz zu schweigen von amerikanischen oder asiatischen Metropolen - Hochhäuser nicht einzeln in Erscheinung treten, sondern sich zu Clustern ballen, werden sie in der Schweiz vorerst wohl Solitäre bleiben. Doch die Tendenz zu ungewöhnlichen Formen, die es erlaubt, in einem Rudel den Leitbau zu erkennen (wie Norman Fosters «Gurke» in London), bricht sich auch hierzulande Bahn: Das Potenzgerangel wird nicht mehr anhand des Metermasses ausagiert. Vielmehr gewinnt Zeichenhaftigkeit an Bedeutung.
So besitzt der in Zürich geplante «Prime- Tower» dank seiner Geometrie unterschiedliche Ansichten. Bei dem von Herzog & de Meuron für das Roche-Areal in Basel konzipierten Turm werden kompakte Cluster von jeweils fünf Bürogeschossen Einheiten bilden, die um den Erschliessungskern rotieren und mit anderen Nutzungen - Gastronomie, Lobby, Foyer, Archiv und Auditorium - zu einem Volumen verschmelzen. Als Grundelement für die Geschosse wurde der Kreis gewählt. Seine besondere Gestalt erhält der Turm, in welchem dereinst 2400 Menschen arbeiten sollen, durch zwei gratartig an der Fassade sich abzeichnende Erschliessungssysteme aus Rampen und Treppen. Es handelt sich dabei um eine Walkway genannte flache Spirale mit mehreren Umdrehungen und eine als Broadway bezeichnete steile, gegenläufige Spirale mit nur einer Windung. Der Roche-Turm wird sich als Insigne des Konzerns unübersehbar ins Stadtbild einschreiben - sofern die Öffentlichkeit den Wunsch des Pharmakonzerns nach einem dominanten Markenzeichen akzeptiert.
Patchwork-Urbanismus
Die Zukunft der Metropolen als globale architektonische Herausforderung
Die Metropolen der Welt wachsen, aber es sind auch Schrumpfungsprozesse zu beobachten. Die Zeit allumfassender Visionen und homogener Szenarien ist vorbei. Zu dieser Feststellung gelangt auch die Architekturbiennale, die derzeit in Venedig über die Bühne geht.
Die globale Verstädterung ist das Thema der diesjährigen Architekturbiennale in Venedig. Rapide wachsende Boomstädte, ob im Fernen Osten oder auf der Südhalbkugel, stellen Urbanisten vor neue Herausforderungen. Die eigentlichen Probleme sind dabei nicht primär urbanistischer oder gar architektonischer Natur, sondern berühren den sozialen Sektor. Richard Burdett als Kurator der Biennale lässt seine Ausstellung daher in Postulate münden; er fordert Architektur, die sich dem Ausschliessen von Bevölkerungsteilen verweigert, ein leistungsfähiges öffentliches Verkehrssystem, nachhaltigen Städtebau, öffentliche Räume für alle - und schliesslich eine verantwortungsvolle Regierung. So begrüssenswert die Postulate auch sind, so wenig konkret bleiben sie, wenn man derart unterschiedliche Städte wie Los Angeles, São Paulo, Berlin oder Schanghai miteinander vergleichen will.
Scrumpfung als Chance?
Natürlich ist die Entwicklung von Städten durch eine spezifische Gemengelage unterschiedlicher Faktoren bestimmt. Ohne Zweifel aber lässt sich London leichter mit Paris oder mit Mailand vergleichen als mit Peking oder Lagos. Der entscheidende Unterschied besteht in der demographischen Entwicklung: Während die Metropolen der hochentwickelten Industriestaaten nur ein geringes Bevölkerungswachstum zu verzeichnen haben, mitunter auch stagnieren oder gar schrumpfen, erleben die wahren Boomtowns eine Bevölkerungsexplosion. Das rapide Wachstum von Städten wie Mumbai - im Jahr 2050 mit 40 Millionen Einwohnern vermutlich der grösste Agglomerationsraum der Welt - erinnert an Entwicklungen, wie sie die europäischen Metropolen im Verlauf des 19. Jahrhunderts erlebt haben. Die Londoner Slums, die etwa Charles Dickens beschrieb, haben ihre Nachfahren in den Favelas von Caracas und Mexiko-Stadt gefunden.
Kriege, Naturkatastrophen und Epidemien haben in der Menschheitsgeschichte immer wieder zur Entvölkerung von Städten und Landstrichen geführt; eines der jüngsten Beispiele hierfür (und überdies für ein Versagen des Katastrophenmanagements auf politischer Ebene) ist die Zerstörung von New Orleans im Sommer 2005 durch den Wirbelsturm «Katrina». Doch hat das Thema des Schrumpfens in den vergangenen Jahren insbesondere vor dem Hintergrund eines ökonomischen Strukturwandels öffentliche Aufmerksamkeit erfahren. Aus dem mehrjährigen Forschungsprojekt «Shrinking Cities», finanziert von der deutschen Kulturstiftung des Bundes, sind zwei von voluminösen Begleitpublikationen flankierte Ausstellungen und unlängst ein informativer «Atlas der schrumpfenden Städte» hervorgegangen. Dass das Projekt von Deutschland ausging, ist kein Wunder: Nach dem Zusammenbruch der DDR und der Wiedervereinigung des Landes leiden die ostdeutschen Städte massiv unter Abwanderung. Letztlich verbirgt sich dahinter ein postindustrieller Strukturwandel, wie ihn auch das Ruhrgebiet erlebt und bis heute nicht völlig verwunden hat - mit dem Unterschied, dass durch die Abschottung der DDR eine letztlich nicht wettbewerbsfähige Ökonomie über eine viel längere Zeit künstlich am Leben erhalten wurde als die ebenfalls subventionierte Montanindustrie in Westdeutschland.
Nach der Lektüre der «Shrinking Cities»- Bücher, aber auch nach Gesprächen mit den Protagonisten des Projekts bleibt eine gewisse Ratlosigkeit. Umfangreiche Analysen der heutigen Situation - die Autoren beschränken sich nicht auf Deutschland, sondern thematisieren schrumpfende Regionen weltweit - können nicht darüber hinwegtäuschen, dass eigentlich niemand tragfähige und überzeugende Ideen für schrumpfende Städte und Regionen hat. Immerhin gibt es Ansätze. «Raumpioniere» heisst eine weitere, von dem Berliner Landschaftsarchitekten Klaus Overmeyer erstellte Studie, die demnächst als Buch erscheint. Dokumentiert werden all jene Zwischennutzungen, mit denen urbane Restflächen in Berlin in Beschlag genommen werden. Dabei kann es sich um improvisierte Strandbars am Spreeufer, Golfanlagen in der Innenstadt, Ponyfarmen auf der Stadtbrache oder informelle Partykultur handeln. Undeterminierte Räume besitzen ein grosses Potenzial, und auch wenn manche Zwischennutzungen noch der Aussteigerideologie der siebziger Jahre verhaftet sind, so geschieht inzwischen vieles, was als Ankerpunkt neuer Mikroökonomien taugt.
Nicht wenigen informellen Zwischennutzungsprojekten eignet eine Tendenz zur Institutionalisierung, und so stossen sie verstärkt auf das Interesse lokaler Behörden oder Investoren. Allerdings siedeln sich «Raumpioniere» nur dort an, wo sich ohnehin ein urbanes, zumeist junges Publikum befindet. In Berlin sind trendige innerstädtische Quartiere wie die Stadtteile Mitte, Kreuzberg oder Friedrichshain beliebt, während der Aussenbezirk Marzahn-Hellersdorf wenig Attraktivität besitzt. Ähnlich verhält es sich mit den Städten untereinander: Berlin und im geringeren Masse auch Leipzig sind die Städte Ostdeutschlands, in denen informelle Stadtnutzungen erprobt werden, während in anderen Gebieten schlicht die für das Funktionieren derartiger Strukturen nötige kritische Masse fehlt.
Zukunft der europäiscen Stadt
Schrumpfen bedeutet, ökonomisch betrachtet, das Nachlassen des Verwertungsdrucks auf Immobilien. Ausschlaggebend dafür ist ein Überangebot an Grundfläche oder an Liegenschaften. Das führt mitunter zu der Annahme, das Schrumpfen der Städte erlaube es, urbanistische Verfehlungen vergangener Jahrzehnte zu korrigieren. Insbesondere, so liesse sich vorschnell vermuten, könnte man der funktionalen Segregation der Städte entgegenwirken, die inzwischen zumeist dem Kommerz und allenfalls Freizeitnutzungen vorbehaltenen Innenstädte zu reanimieren und zugleich den Suburbanisierungstendenzen entgegenzusteuern, durch die viele europäische und nordamerikanische Städte seit der automobilen Ära der fünfziger Jahre Bevölkerungs- und natürlich auch Steuerverluste erlitten haben. Ob derlei Strategie aufgeht, ist mehr als fraglich: Denn wo Grundstücke brach fallen, fehlt es an Attraktivität und damit auch am Wunsch, in die Stadt zurückzukehren.
Wo Städte Anziehungskraft besitzen, sinkt der Verwertungsdruck kaum. Immerhin werden mancherorts in Deutschland Szenarien erprobt, die mit den bisherigen Stadtvorstellungen kaum als kompatibel galten. In Leipzig läuft ein erfolgreiches Programm, unbebaute Brachflächen in Gründerzeitquartieren zu parzellieren und als Kleingärten an die Wohnbevölkerung der Nachbarschaft zu verpachten; in Hannover ist auf dem innerstädtischen Gelände einer früheren Brauerei ein Reihenhausquartier entstanden, wie man es sonst nur am Stadtrand findet. Derartige Beispiele belegen, dass eine Zukunft der europäischen Stadt vielleicht jenseits eingefahrener Wege zu finden ist. Zumindest scheinen die antithetischen Droh- und Hoffnungsszenarien der neunziger Jahre ausgedient zu haben: Weder ist es gelungen, urbane Agglomerationen im Sinne einer kompakten «europäischen Stadt» zu verdichten, noch blieb der Trend zur Suburbanisierung unbestritten. Die Zukunft gehört wohl eher einem Patchwork-Urbanismus, bei dem Stadtquartiere unterschiedlicher Dichte und heterogenen ökonomischen Potenzials koexistieren. Schrumpfen und wachsen schliessen einander nicht aus.
Kultur als urbaner Generator
Tatsächlich gibt es parallel zu Schrumpfungsprozessen bestimmte Tendenzen, die auf ein Wiederaufleben von Metropolen deuten. Ein Indikator dafür ist der «Bilbao-Effekt». Seit der Eröffnung des von Frank O. Gehry entworfenen Guggenheim-Museums zählt die zuvor international kaum positionierte baskische Industriestadt zum absoluten Must auf der Agenda globaler Kulturtouristen. Der Boom der Stadt hat sich keineswegs als Strohfeuer erwiesen, der Strom der Besucher dauert an, wenn auch mit verminderter Intensität. Selbstverständlich bedurfte es einer Reihe weiterer flankierender Massnahmen und nicht des Museums allein - Tatsache aber ist, dass die Umwegrentabilität durch Investitionen in den Kultursektor durchaus ein funktionierendes Modell für die Belebung von Städten sein kann.
Bestes Beispiel hierfür ist London, das sich als wichtigste Finanzdrehscheibe Europas etabliert hat. Mit der Umwidmung der früheren Bankside Power Station zur Tate Modern ist auch die Regeneration des der City gegenüberliegenden südlichen Themseufers gelungen. Tatsächlich hat hinsichtlich Besuchergunst die Tate Modern längst allen anderen Museen für zeitgenössische Kunst weltweit den Rang abgelaufen: 4,1 Millionen Kunstliebhaber und Zaungäste besuchten im Vorjahr den von Herzog & de Meuron umgebauten Ziegelsteinkoloss des Architekten Giles Gilbert Scott, lediglich 2,67 Millionen das MoMA in New York und 2,5 Millionen das Centre Pompidou. Damit ist die Rechnung, welche die Berater von McKinsey 1994 der Stadt und dem Borough of Southwark gemacht haben, längst aufgegangen: Die Tate Modern, so liess man seinerzeit verlauten, werde 2400 neue Arbeitsplätze nach sich ziehen und der Stadt jährliche Mehreinnahmen von bis zu 90 Millionen Pfund verschaffen, wovon ein Drittel Southwark zugute käme. Zumindest in seinen themsenahen Bereichen ist Southwark inzwischen ein Boombezirk sondergleichen.
Inzwischen setzen viele Städte auf Kultur als urbanen Generator - nicht zuletzt in den USA. Minneapolis versucht mit dem Walker Art Center von Herzog & de Meuron, dem Guthrie Theater von Jean Nouvel und weiteren Kulturbauten sein Zentrum zu reaktivieren; in Boston soll das kurz vor der Eröffnung stehende Institute of Contemporary Art der New Yorker Architekten Diller & Scofidio zur Wiederbelebung der stadtnahen Hafenbrachen beitragen. Aber auch kleinere Städte haben das Potenzial der Label-Architektur erkannt - etwa Des Moines im Westen von Iowa. Hier wurde unlängst eine Bibliothek von David Chipperfield eröffnet, welche dem von Grossparkplätzen, aseptischen Bürohäusern und einigen verbliebenen historischen Bauten bestimmten Stadtkern neues Leben einhauchen soll.
Wohnen in den Städten
Städte wie Boston, dessen Downtown von einem schier endlosen Gürtel aus Brachflächen umgeben ist, zeigen die verheerenden Auswirkungen jahrzehntelanger Tendenzen zur Suburbanisierung. Wer immer es sich leisten kann, wohnt in einer der reichen Vorortgemeinden. Wenn auch in schwächerem Ausmass, lassen sich vergleichbare Prozesse auch in Europa diagnostizieren. Inwieweit es gelingen kann, die abgewanderte Bevölkerung zurückzugewinnen, darüber wird derzeit noch gestritten. «10 000 Wohnungen in zehn Jahren» heisst beispielsweise das Wohnungsbauprogramm der Stadt Zürich. Ziel ist primär die Schaffung grosszügiger Wohnungen, um die Abwanderung einer urbanen Klientel zu verhindern. Tatsache ist allerdings, dass der Erfolg der Massnahme durch die sukzessive gestiegene Pro-Kopf- Wohnfläche relativiert wird.
Genossenschaften erleben mit unkonventionellen Wohnkonzepten in der Schweiz eine Renaissance, in Deutschland etablierten sich sogenannte Baugruppen oder Baugemeinschaften: Mehrere Interessenten tun sich zusammen, suchen sich einen Architekten und realisieren gemeinsam ein Bauvorhaben. Baugruppen entstehen aus Pragmatismus; zu Visionen kollektiven Wohnens, wie sie die siebziger Jahre prägten, wahren sie Distanz. Und noch etwas ist ermutigend: In vielen europäischen Städten entstehen neue, zumeist hochwertige Wohnquartiere in zentraler Lage, beispielsweise die «Hafen City» in Hamburg. Bedenklich ist dabei der Trend, dass manche Städte allein die Bereiche entwickeln, die sich imagekompatibel vermarkten lassen, während an Interventionen in Problemstadtteilen nur wenig Interesse besteht. Dieser Inselurbanismus befördert Tendenzen zur Segregation, die überall auf der Welt stärker sind als in Europa.
Das eigentliche Erfolgsmodell des Wohnens stellt derzeit die Gated Community dar. In Städten mit hoher Kriminalitätsrate, etwa São Paulo, mögen auf Abschottung beruhende Wohnkonzepte plausibel sein. Der Erfolg von Gated Communities beruht aber nicht auf realer, sondern auf gefühlter Bedrohung - und überdies auf Lifestylekompatibilität. Beinahe sämtliche Wohnungen für den neuen chinesischen Mittelstand werden in Form von zugangskontrollierten Apartmentkomplexen errichtet, deren Zweck es ist, Sozialprestige zu vermitteln. Das gleiche Bild auch in Moskau oder Mumbai: Stadtteile als Konglomerate unverbundener Wohneinheiten. Auch das ist eine Form von Patchwork-Urbanismus.
Kirchen und Hallen
Der Architekt Gottfried Böhm - eine Ausstellung in Frankfurt
Seit sechzig Jahren prägt der 1920 geborene und in Köln ansässige Architekt Gottfried Böhm das deutsche Baugeschehen. Nun zeigt das DAM in Frankfurt eine Retrospektive seines Schaffens.
Im Kontext der deutschen Architekturszene ist Gottfried Böhm in mancherlei Hinsicht eine Ausnahmeerscheinung. Er ist der einzige Architekt des Landes, der (im Jahr 1986) den hochangesehenen Pritzker-Preis erhalten hat. Dennoch beschränkt sich sein umfangreiches uvre nahezu ausnahmslos auf Deutschland. Weiter ist Böhm Mitglied einer Architektendynastie: Sein Vater Dominikus gilt als Hauptvertreter des expressionistischen Sakralbaus in der Zeit der Weimarer Republik, und architektonisch tätig sind auch seine Frau Elisabeth sowie die drei Söhne Stephan, Peter und Paul.
Boomjahre des Sakralbaus
Gemeinsam mit dem Nachlass von Dominikus Böhm, dem im vergangenen Jahr eine Schau gewidmet wurde, hat das Deutsche Architektur- Museum auch das Büroarchiv von Gottfried Böhm mit seinen insgesamt 27 000 Objekten erwerben können. Ein kleineres Konvolut, das vor allem die Zeit bis 1970 umfasst, war schon zuvor an das Historische Archiv der Stadt Köln gelangt. Auch wenn somit die Dokumentation der früheren Jahre Lücken aufweist, fallen diese in der jetzigen Retrospektive kaum ins Gewicht. Wolfgang Voigt, der stellvertretende Direktor des DAM und seit Jahren für die historischen Ausstellungen verantwortlich, führt die Besucher in 30 Stationen durch die Schau, die unter dem Titel «Felsen aus Beton und Glas» mehr als sechzig Schaffensjahre widerspiegelt. Gottfried Böhms erster Bau war die Kapelle «Madonna in den Trümmern» in den Ruinen der kriegszerstörten Kirche St. Kolumba in Kölns Innenstadt. Der filigrane achteckige Bau (1947-50) mit dem leichten Betongewölbe über einer Unterkonstruktion aus Eisengewebe ist eine Inkunabel des deutschen Wiederaufbaus und wird derzeit von Peter Zumthor in das neue Kölner Diözesanmuseum integriert.
Die fünfziger Jahre - 1955 übernahm Böhm das Architekturbüro des verstorbenen Vaters - werden in Frankfurt zu Recht als Zeit des Experimentierens dargestellt. Wesentliche Impulse vermittelte 1951 eine halbjährige Studienreise in die USA, während deren Böhm mit Walter Gropius und Mies van der Rohe zusammentraf. Das eigene Wohnhaus, kurz darauf in Köln entstanden, zeigt die Faszination eines modernen Rationalismus. Doch Böhms eigentliche Domäne waren die Kirchen. 39 Sakralbauten konnte der Architekt allein bis 1959 realisieren. Die erdenschwere Monumentalität, welche die Kirchen seines Vaters bestimmte, wich konstruktiver Leichtigkeit. In ständig neuen Varianten widmete sich Gottfried Böhm den Dach- und Tragwerk-Konstruktionen: Schalen und Faltwerke, Hängedächer, Membrandecken und Zeltstrukturen wechseln ab; die Volumina gewinnen an materieller Kraft, nähern sich dann dem Brutalismus.
In den Bauten der sechziger Jahre kulminiert die Recherche des Architekten in der grandiosen Wallfahrtskirche Neviges (1966-68) im Bergischen Land. Über einem polygonalen Grundriss, der von einem Kranz von Kapellen umgeben ist, erhebt sich ein schroff aufgipfelndes Zeltgebirge aus sandgestrahltem Sichtbeton. Die kristallinen Visionen des Expressionismus, welche in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg die Grenzen des technisch Machbaren sprengten, fanden ihren Widerhall - wenn auch im Schoss der katholischen Kirche. Doch auch im profanen Bereich widmete sich Böhm der Vision einer Stadtkrone, am überzeugendsten beim Rathaus von Bensberg (1962-67). In das von einer Ringmauer vorgegebene Oval einer Burgruine integrierte er die neue Baumasse, die von einem skulptural sich aufgipfelnden Treppenturm als Pendant zu den historischen Türmen überragt wird.
Struktur und Glashaus
Die kristallin-neoexpressionistischen Arbeiten der sechziger Jahre mag man als den eigentlichen Höhepunkt ansehen. Doch die Schalungsarbeiten für den Beton erwiesen sich als so aufwendig, dass Böhm neue Konstruktionsweisen erproben musste. Er fand sie in präfabrizierbaren Strukturen, etwa für die als Zeltstadt aus Metall verwirklichte Wallfahrtskirche Wigratzbad (1972-76).
Seit dem Umbau der Godesburg hatte sich Böhm mit profanen Bauaufgaben auseinandergesetzt; sie rückten ins Zentrum seiner Aktivitäten, als die kirchlichen Aufträge um 1970 zu versiegen begannen. Einige Entwürfe folgen dem architektonischen Strukturalismus der Zeit - etwa ein Konzept für die Neuorganisation des Bonner Regierungsviertels oder Wettbewerbsentwürfe für die neu gegründeten Universitäten in Bielefeld und Dortmund. Mit grossen Erschliessungshallen verfolgte Gottfried Böhm ein Konzept, das sich fortan durch sein Werk ziehen sollte und das Voigt als «eingehausten Stadtraum» tituliert. Böhm war einer der Ersten, die den verglasten Innenraum, wie man ihn in den USA schon kannte, nach Deutschland importierten; mal bekam er die Form eines Atriums, mal die einer Passage. Die Hauptverwaltung der Firma Züblin bei Stuttgart (1981-85) wirkt wie ein gigantisches Glashaus mit zwei seitlichen Büroflügeln. Auch wenn die Halle heute ästhetisch befremdlich wirkt, so hatte der Architekt doch das überzeugend geschaffen, was sich die Firma wünschte: ein kostengünstiges, ökologisch vorbildliches Beispiel für eine auf Fertigteilen beruhende Verwendung von Beton.
Qualitätssprünge im Spätwerk
Nicht alle Gebäude der späteren Jahre überzeugen: Der Sitz der Deutschen Bank in Luxemburg wirkt etwas ungeschlacht, die Steintorgalerie in Hannover verblasst neben Fritz Högers Anzeiger- Hochhaus, und die WDR-Arkaden in Köln zeugen von einem eher vordergründigen Flirt mit dem Dekonstruktivismus. Doch es gelingt Böhm immer wieder, auf intelligente, selbstbewusste, aber sensible Weise Alt und Neu zu versöhnen. Jüngere Beispiele hierfür sind der in Glas nachgebildete Mittelrisalit des Schlosses von Saarbrücken (1981-89) oder die Stadtbibliothek neben dem Ulmer Rathaus (1998-2004). Interessant ist die schon 1987/88 im Auftrag der Bundesregierung erarbeitete Studie für den Umbau des Reichstagsgebäudes von Paul Wallot in Berlin. Böhm legte den Plenarsaal höher, um den Nachkriegs-Wiederaufbau von Paul Baumgarten zu erhalten, und bekrönte das Gebäude mit einer transparenten, für die Öffentlichkeit begehbaren Kuppel - ein Gedanke, der im ausgeführten Projekt von Norman Foster wiederkehren sollte. Die Auseinandersetzung mit Kuppel- und Schalenstrukturen prägt auch Böhms jüngstes Werk, das soeben eingeweihte Hans-Otto-Theater in Potsdam.
Ein Genuss ist die materialreiche Ausstellung schon aufgrund des zeichnerischen Talents, das Gottfried Böhm von seinem Vater geerbt zu haben scheint. Aktualität besitzt Böhms Architektur auch aufgrund ihrer Gefährdungen - nicht in erster Linie wegen des bedenklichen Zustands mancher Betonbauten, sondern wegen der Profanierung von Kirchen in Folge schwindender Mitgliederzahlen. So wurde ein Bau in Hürth-Kalscheuren als Showroom zweckentfremdet. Nächste Kandidatin dürfte St. Gertrud in Köln (1961-65) sein, eine Kirche, die gleichsam als Vorstufe zum Betonmassiv von Neviges zu verstehen ist.
[ Bis 5. November. Katalog: Gottfried Böhm. Hrsg. von Wolfgang Voigt. Jovis-Verlag, Berlin 2006. 272 S., Euro 32.-. ]
Weltreise durch die Megastädte von morgen
Die 10. Architekturbiennale von Venedig
Der Londoner Architekt und Stadtplaner Richard Burdett ist Kurator der diesjährigen Architekturbiennale von Venedig. Für einmal huldigt der Grossanlass, der an diesem Wochenende eröffnet wird, nicht baulichen Preziosen, sondern beleuchtet die Probleme der Megastädte.
Heute lebt die Hälfte der auf 6,5 Milliarden Menschen geschätzten Erdbevölkerung in Städten. Im Jahr 2050 dürften es 75 Prozent der dannzumal 8,5 Milliarden Erdbewohner sein. Dadurch entstehen nicht nur mehr, sondern auch immer grössere Städte. Der Grossraum Tokio, heute mit 35 Millionen Menschen der bedeutendste der Welt, wird 2050 einwohnermässig von Bombay überholt werden. Boomstädte entstehen vor allem in Süd- und Ostasien sowie auf der südlichen Hemisphäre, während die europäischen Grossstädte zwar einen Attraktivitätsgewinn verbuchen können, aber nur mehr geringfügig wachsen. Einen Überblick über die globale Verstädterung zu geben und zur Einflussnahme auf die unvermeidlichen Prozesse aufzurufen, ist das Ziel der 10. Architekturbiennale von Venedig, die unter dem Titel «Città. Architettura e società» an diesem Wochenende ihre Pforten öffnet. Kuratiert und konzipiert wurde sie von dem Londoner Architekten und Stadtplaner Richard Burdett, der an der London School of Economics lehrt und als Berater des Mayor of London tätig ist.
Globale Verstädterung
Der Gegensatz zwischen der jetzigen Schau und der von Kurt Forster in Rauminstallationen von Hani Rashid präsentierten Biennale 2004 könnte kaum grösser sein. Burdett hat die 300 Meter lange Halle der Corderie in lockere Kojen gegliedert, die jeweils einer Stadt gewidmet sind. So begeben sich die Besucher auf eine Weltreise. Sie führt von Süd- nach Nordamerika (São Paulo, Caracas, Bogotá, Los Angeles, New York), dann über Afrika (Kairo, Johannesburg) nach Europa (Berlin, London, das Städtedreieck Mailand - Turin - Genua, Istanbul) und Asien (Bombay, Schanghai, Tokio). Es ist eine Ausstellung über Statistik, über die Entwicklung der Gesellschaft und die Form der Städte. Dank pointiert eingesetzten Informationen und exzellentem Ausstellungsdesign (Cibic & Partners zusammen mit dem Grafikbüro Fragile) gelingt der schwierige Spagat zwischen möglicher Kürze und nötigem Tiefgang. Projektionen, Luftbilder, Karten und Grossfotos zeigen die Strukturen der Städte, Texte und Grafiken verdeutlichen die Probleme, und schliesslich werden kurz einige vorbildliche architektonische Interventionen vorgestellt.
Dabei geht es weniger um Hochglanzarchitektur als vielmehr um oft bescheidene, aber wirkungsvolle urbane Interventionen - etwa ein Programm für öffentliche Toiletten in Bombays Spontansiedlungen oder um jene vom Caracas Urban Think Tank realisierte vertikale Sporthalle an der Grenze zwischen Slum und formaler Stadt, welche die Kriminalität in der Gegend um 45 Prozent gesenkt hat. Aber es finden sich auch Projekte wie die Transformation des New Yorker «High Line»-Eisenbahntrassees durch Diller & Scofidio oder die Visionen von Kees Christiaanses Büro KCAP für Londons Osten. Am Ende der Stadtpräsentationen stellt Burdett die Frage «Can we change the world?». Er nennt fünf Interventionsfelder, die gleichsam das Destillat der Weltreise darstellen. So unterschiedlich die jeweilige Ausgangslage auch sein mag, sind doch die essenziellen Forderungen an die Metropolen des 21. Jahrhunderts gleich: eine Architektur der Inklusion (und nicht der Segregation), ein funktionierendes Transportsystem, nachhaltiger Städtebau, allen zugängliche öffentliche Räume und schliesslich «good governance».
Nach Jahren sich im Formalästhetischen erschöpfender Biennalen - selbst Massimiliano Fuksas hatte im Jahr 2000 sein Motto «Less Aesthetics, more Ethics» nicht einlösen können - veranstaltet Burdett eine Schau, die sich den Problemen der Gegenwart widmet. Da wird man einige Schwächen verzeihen: Das Kapitel Berlin etwa fällt etwas gar kümmerlich aus, und eine postsowjetische Stadt hätte den Reigen durchaus bereichert. Dass Norditalien über Gebühr präsentiert wird und Renzo Piano seinen Masterplan für die Entwicklung des Hafens von Genua in maximalen Dimensionen präsentieren darf, mag dem veranstaltenden Land geschuldet sein. Auf dessen Konto geht auch die von Claudio D'Amato Guerrieri aus Bari kuratierte Ausstellung «Città di Pietra» in den Artiglierie, die unreflektiert faschistisches Bauen mit Wettbewerben für neue Steinarchitekturen im Süden des Landes konfrontiert und ein einziges Ärgernis darstellt.
Im italienischen Pavillon in den Giardini setzt Burdett seine Schau fort. Es dominiert nicht mehr die kuratorische Stringenz; vielmehr dürfen hier ausgewählte Forschungsinstitute ihre Ergebnisse präsentieren. Nicht allen gelingt ein sinnvoller Umgang mit der Ökonomie der ausstellerischen Mittel und damit ein wirkungsvoller Beitrag. Das von der deutschen Kulturstiftung des Bundes finanzierte Projekt «Shrinking Cities», das - ausgehend von der Situation in Ostdeutschland - die Schrumpfung von Städten untersucht hat, zählt ohne Zweifel zu den wichtigsten urbanistischen Forschungsunternehmungen der letzten Jahre. Die Wände mit einigen Fotos maroder Plattenbauten zu tapezieren und die (unbestritten hervorragenden) Publikationen auszulegen, ist jedoch für eine Architekturbiennale zu wenig. Ähnlich uninspiriert wirkt das Gastspiel des ETH-Studios Basel. Das Berlage Institut aus Rotterdam hingegen schafft eine kommunikative Atmosphäre, stellt aber vor allem sich selbst ins Zentrum. Die Präsentation «Gulf City» von OMA/AMO über die Arabischen Emirate wirkt etwas unfertig; hier muss man auf die Publikation warten, die - ebenso wie die Lagos-Studie - im Herbst bei Lars Müller erscheinen wird.
Länderreigen in den Giardini
Wie üblich, hinterlässt ein Rundgang durch die Pavillons gemischte Gefühle. Die Wahl der Schweizer Auswahlkommission fiel auf Bernard Tschumi, der den Entwurf für ein «Elliptic City» genanntes internationales Finanzhandelszentrum in der Dominikanischen Republik präsentiert. Dabei lässt er die Besucher an den Überlegungen teilhaben, die sich einem Stararchitekten stellen, wenn er mit der Aufgabe konfrontiert wird, ein «globalisiertes» Raumprogramm in einem lokalen, von der Natur geprägten Umfeld zu placieren. Wie sich Tschumis strukturelles Denken in der Realität bewähren wird, bleibt angesichts des derzeitigen Bearbeitungsstandes offen.
Für den deutschen Pavillon zeichnen die Berliner Architekten Grüntuch Ernst verantwortlich. In eher unübersichtlichen Tischvitrinen präsentieren sie Konversions- und Umbauprojekte und machen überdies mit einer rot umhüllten Treppe das Dach des 1938 errichteten NS-Baus zugänglich. Mit zwei nachgebauten Modellen historischer Projekte - eines von Hans Hollein in die Landschaft integrierten Flugzeugträgers (1964) und von Friedrich Kieslers Raumstadt von 1925 - brilliert Österreich, während Spanien sich dem weiblichen Blick auf die Stadt widmet. Die USA stellen Projekte für den Wiederaufbau von New Orleans vor, und Israel zeigt die strukturellen Modelle von 16 Gedenkstätten. Zu den attraktivsten Länderbeiträgen zählt der irische, der Bezüge zwischen Bevölkerungswachstum und Umweltproblemen aufzeigt. Den lebendigsten Ort haben die Franzosen geschaffen, die ihren Pavillon durch die anarchische Architektengruppe Collectif Exyzt bespielen lassen. Einbauten machen das Gebäude bewohnbar: Links schlafen die Aktivisten, auf dem Dach duschen sie. In der Mitte stehen Küche und Speisesaal, in welchem sich Besucher und Bewohner vermischen - mit so einfachen Mitteln entsteht Gemeinschaft.
[ Bis 19. November. Doppelkatalog: Cities - Architecture and Society. Marsilio Editori, Venedig 2006. 388 und 200 S., Euro 60.-. ]
Kultur als Zukunftsfaktor
Jean Nouvels Guthrie Theater in Minneapolis
Minneapolis, in der Mitte der USA gelegen, sucht sich als kulturelle Metropole zu positionieren. Die Sequenz neuer Bauten kulminiert im Guthrie Theater, mit dem Jean Nouvel das postindustrielle Arkadien der Flusslandschaft am Mississippi ins Blickfeld rückt.
Als man im 19. Jahrhundert begann, die Wasserkraft zu nutzen und Mühlenbauten am Flussufer zu errichten, avancierte das 1867 zur Stadt erhobene Minneapolis zum wichtigsten Getreideumschlagplatz des Landes. Heute ist Minneapolis - das sich und das benachbarte St. Paul, die Kapitale von Minnesota, gerne als «Twin Cities» bezeichnet - dank wirtschaftlicher Prosperität eine kulturell attraktive Stadt. Gleichwohl zählt sie für Touristen kaum zu den Hot Spots des Landes: In der geographischen Mitte der Vereinigten Staaten gelegen und von den attraktiven Destinationen der West- wie der Ostküste gleichermassen weit entfernt, besass die Stadt bisher wenig Attraktionspotenzial, zumindest für überseeische Besucher. Fragte man einen Durchschnittsamerikaner nach Minneapolis, so käme diesem wohl zuerst das Stichwort Shopping in den Sinn. Mit dem von Victor Gruen geplanten Southdale Shopping Center (1956) steht hier die erste, mit der Mall of America (1992) von Jon Jerde die grösste Mall des Landes, die als touristische Destination ersten Ranges gilt.
Kultureller Kraftakt
Dass die Innenstädte veröden, ist ein Phänomen, mit dem sich Minneapolis wie viele amerikanische Grossstädte konfrontiert sieht. In den achtziger Jahren entstand «downtown» die obligatorische Silhouette, hier mit Hochhäusern unter anderem von SOM, Cesar Pelli und Philip Johnson. Und wie in anderen Städten auch gilt Kultur derzeit als probates Gegenmittel, um das Image der fragmentierten City mit ihrem Patchwork aus spiegelverglasten Wolkenkratzern, historischen Bauten und zu Parkplätzen umgewidmeten Brachen aufzupolieren. In einem gewaltigen Kraftakt haben verschiedene Institutionen zusammengespannt, um ihre Häuser zu erneuern, zu erweitern oder gar neu zu errichten. Den Anfang machte schon im April des vergangenen Jahres die Erweiterung des Walker Art Center durch Herzog & de Meuron (NZZ 23. 5. 05), das sich am westlichen Rande der Innenstadt befindet.
Ein gutes Jahr später, am 20. Mai dieses Jahres, eröffnete die von Cesar Pelli geplante Minneapolis Public Library, die einen ganzen Block der Innenstadt beansprucht und weitgehend durch die öffentliche Hand finanziert wurde. Eine trichterförmige Galerie, von einem über die Front auskragenden Flugdach überdeckt, dient als grosszügige Erschliessungsachse, von der aus die Lesesäle und Auditorien auf vier Ebenen zugänglich sind. Minneapolis hat mit der Bibliothek vielleicht kein Wahrzeichen erhalten, doch ein überaus benutzerfreundliches Gebäude. Die Gesamtlänge der Regalfläche misst 38,5 Meilen, und fast alle Bestände sind als Freihandmagazine unmittelbar zugänglich. Die Lesesäle besitzen dank der umlaufenden Verglasung und dem Raster aus Pilzstützen eine luftige und freundliche Atmosphäre; und wenn es draussen dunkel wird, strahlt die Bibliothek wie ein funkelnder Kristall. Ein wenig skandinavisch mutet das Gebäude an, welches das Licht zum Thema macht - nicht ohne Grund, denn die dunklen und kalten Winter in Minneapolis sind berüchtigt.
Drei Wochen später öffnete das Minneapolis Institute of Art (MIA), das eine der bedeutendsten Kunstsammlungen der Vereinigen Staaten beherbergt, seine Erweiterung. Der Ursprungsbau von McKim, Mead and White aus dem Jahr 1915 zeigt mit Portikus und Freitreppe die seinerzeit für Kulturbauten in den USA typischen neoklassizistischen Formen. Der japanische Architekt Kenzo Tange fügte 1975 seitlich zwei schlichte Flügel an, die abgesetzt sind durch gläserne Verbindungsbereiche. Nun hat Michael Graves Tanges Westflügel erweitert.
Der neue Flügel des MIA besteht aus einer Enfilade von jeweils fünf Sälen in den zwei Hauptgeschossen (parallel zum Tange-Trakt) und einer südlich anschliessenden, quadratischen Erweiterung mit einem kuppelüberwölbten Atrium in der Mitte. Das gesamte Sockelgeschoss dient der Verwaltung, ausserdem sind hier die Grafische Sammlung und die Bibliothek untergebracht. Mit insgesamt 34 neuen Sälen ist die Ausstellungsfläche um 40 Prozent vergrössert worden - wovon moderne Kunst und Designs besonders profitieren. Graves hat sich in den Ausstellungsräumen bewusst zurückgehalten und das Konzept von Tanges Kunstlichtsälen adaptiert, so dass im Inneren kaum auffällt, wo man den neuen Flügel betritt. Klar als von der Hand Graves' erkennbar ist lediglich der für Empfänge genutzte Gewölbesaal im zweiten Obergeschoss. Moderat- klassizierend zeigt sich auch das Äussere: Schlichte Pilaster und Rundstützen gliedern die Kalksteinfassaden, die mit den früheren Bauphasen gut harmonieren.
Kreuzbestäubungen
Ohne Zweifel besitzt das neue Guthrie Theater den attraktivsten Standort unter den neuen Kulturbauten. Es befindet sich am Steilufer des Mississippi im «Milling District», der Keimzelle der Stadt, und reiht sich ein in die noch vorhandene Phalanx von Mühlengebäuden und Getreidesilos aus Stahlbeton. Die Bauten faszinierten zu Beginn des 20. Jahrhunderts Architekten in Europa; erstmals hatte Walter Gropius 1911 Fotos in einer Ausstellung zum Thema Industriebau präsentiert und dann im Jahrbuch des Deutschen Werkbunds 1913 als Werke veröffentlicht, die «in ihrer monumentalen Gewalt des Eindrucks fast einen Vergleich mit den Bauten des alten Ägyptens» aushielten. Dank ihrer stereometrischen Form avancierten sie in Europa zu Katalysatoren für die Suche nach einer neuen Architektur und galten für Erich Mendelsohn oder Le Corbusier als Inbegriff einer neuen Monumentalität.
Seit einiger Zeit wird der «Milling District» als historisches Erbe vor Ort wiederentdeckt. Am Ufer finden Ausgrabungen statt, und über einen stillgelegten Eisenbahnviadukt von 1883 gelangt man im weiten Bogen auf die andere Seite des Flusses. Die landschaftliche Situation diente Jean Nouvel, der den Direktauftrag für den Neubau des renommierten, 1963 von Tyrone Guthrie gegründeten Sprechtheaters europäischer Prägung erhalten hatte, als Ausgangspunkt. Um Aussicht über das Flussgebiet des Mississippi zu ermöglichen, hob er die beiden Theatersäle und das Foyer auf die Ebene des dritten Obergeschosses an. Während die Probenräume in den Ebenen darunter angeordnet sind, wurden Kulissendepot und Malersaal niveaugleich in einem mehrgeschossigen Parkhaus jenseits der Strasse untergebracht. Ein Gang führt hinüber in das Theater - und durch eine schwefelgelbe Glasscheibe hindurch kann man vom Foyer aus die Bühnenarbeiter beobachten.
Kontextuelle Bezüge
Perspektiven sind bei diesem Gebäude alles: Als Verlängerung des Foyers ragt die «Endless Bridge», in einem Aussichtsbalkon kulminierend, rüsselartig hinein in das Mississippi-Tal; Fenster, einmal hoch-, einmal querformatig, rahmen die Perspektiven in das postindustrielle Arkadien. Die «Thrust Stage» mit ihrem halbkreisförmigen Zuschauerrund von 1100 Plätzen lässt die Raumdisposition des alten Guthrie anklingen; die rechteckige «Proscenium Stage» ist für 700 Besucher ausgelegt. Ein wiederum gelb verglaster Raum mit atemberaubenden Ausblicken dient als Foyer für die Studiobühne auf dem Dach.
Aus europäischer Sicht steht Nouvels Guthrie Theater im Schatten des am gleichen Wochenende eingeweihten Pariser Musée Quai Branly. Zu Unrecht. Denn der mit dunkelblauen Metallplatten verkleidete Theaterbau, Nouvels erster Auftrag in den USA, darf als jüngstes Meisterwerk des Architekten bezeichnet werden. Als rätselhaft-technoides Gebilde lagert es über dem Flusstal, und es huldigt der Zukunft ebenso, wie es auf die Vergangenheit reagiert: Durch eine gelbe Scheibe der «endless bridge» gerät genau der Getreidespeicher aus Minneapolis ins Visier, den Gropius 1913 publizierte und der heute das «Mill Museum» beherbergt. In Zeiten politischer Entfremdung thematisiert Nouvel jene Kreuzbestäubungen, die Abendland und Neue Welt auf kultureller Ebene in Faszination verbinden.
Zwischen Arkadien und Grossstadtwelt
Der Architekt Franz Gustav Forsmann - Ausstellung in Hamburg
Als Hauptwerk des Hamburger Architekten Franz Gustav Forsmann (1795-1878) gilt das 1834 fertig gestellte Jenischhaus im - einstmals dänischen - Flottbek. Die westlichen Hamburger Elbvororte waren seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert vom wohlhabenden Bürgertum entdeckt worden; Sommerhäuser und Landsitze an den Hängen verwandelten die Gegend in ein hanseatisches Arkadien. Das spätklassizistische Landhaus, mit dessen Bau Forsmann von dem Senator Martin Johann Jenisch d. J. 1828 betraut worden war, dient seit langem als Dépendance des Altonaer Museums. Der Architekt hatte zu Beginn zwei unterschiedliche Entwürfe vorgelegt, die den Auftraggeber offenkundig nicht zufriedenstellten. Daher wurden die Entwürfe an Schinkel zur Begutachtung geschickt, der einen Gegenentwurf vorlegte. In den von Forsmann ausgeführten Bau - dreigeschossig, annähernd quadratisch und mit flachem Dach - sind einige Anregungen aus Berlin eingeflossen, so die abwechselnd hohen Quaderschichten, die nach oben abnehmende Geschosshöhe, das Flachdach und die Vergoldung der Gitter. Vermutlich entspricht das heute vielfach als synonym für den hamburgischen Klassizismus angesehene strahlende Weiss nicht der ursprünglichen Farbfassung, die man sich eher steinfarbig vorzustellen hat.
Für die jetzige Ausstellung im Rahmen des Hamburger Architektursommers wurde die ursprüngliche Raumstruktur, die vor allem im Bereich der Neben- und Personalräume verändert ist, durch Markierungen auf dem Boden wieder erlebbar gemacht. Zu sehen sind überdies die teilweise durch einen Brand in Mitleidenschaft gezogenen Entwurfspläne der verschiedenen Phasen. Anhand von Entwürfen und Fotos werden im obersten Geschoss die übrigen Werke von Forsmann dokumentiert, der nach einer Ausbildung an der Eutiner Zeichenschule von Johann Heinrich Wilhelm Tischbein eine Zimmermannsausbildung in Hamburg und ein Architekturstudium in München absolviert hatte. An der Elbe reüssierte er zunächst mit freien Aufträgen, so den Stadthäusern für Gottlieb Jenisch (1831-1834) an der Binnenalster oder den zwischen 1836 und 1843 geplanten und realisierten Landhäusern Weber in Othmarschen und in Nienstedten.
Darüber hinaus fungierte Forsmann über Jahrzehnte als Mitglied der städtischen Bauverwaltung. 1828 wurde er Assistent der Stadtbaumeisteradjunkten Hinrich Anton Christian Koch und Carl Ludwig Wimmel, 1845 übernahm er die Geschäfte des verstorbenen Wimmel, 1868 avancierte er schliesslich zum Stadtbaumeister. Mehr als 40 Jahre, bis zu seiner Pensionierung 1871, hat Forsmann als Beamter das Gesicht seiner Stadt geprägt, die sich in dieser Zeit - nicht zuletzt nach dem grossen Brand von 1842 - zur Metropole wandelte. Anfangs waren es Torhäuser und Brücken, später vornehmlich Schulen, die sich mit seinem Namen verbanden. Die wichtigsten Neubauten errichtete Forsmann (gemeinsam mit Wimmel) direkt in der Innenstadt. Es sind das zerstörte Johanneum am Domplatz (1837-1840) sowie die Börse hinter dem Rathaus (1837-1841), mit denen er den besonders von seinem Lehrer Friedrich von Gärtner in München eingeführten Rundbogenstil an der Elbe heimisch machte.
[ Bis 29. Oktober. Katalog: Franz Gustav Forsmann 1795-1878. Hrsg. Julia Berger und Bärbel Hedinger. Wachholtz-Verlag, Neumünster 2006. 176 S., Euro 17.-. ]
Baukünstlerischer Aufbruch
Neuer Urbanismus in China - drei Rotterdamer Ausstellungen
Eine Ausstellungstrilogie in Rotterdam wirft einen kritischen Blick auf die urbanistischen Entwicklungen in China. Ins Blickfeld geraten dabei auch die Arbeiten junger chinesischer Architekturbüros.
Wenn hiesige Architekten über China sprechen, so besiegt die Faszination zumeist die Skepsis. Gewiss entspricht das zum Turbokapitalismus konvertierte kommunistische System nicht eben westlichen Vorstellungen von Demokratie. Auch weiss man um die kulturelle Differenz: Aufträge dort zu erhalten und auszuführen, ist selbst bei intensiver Vorarbeit von kaum abzuschätzenden Unwägbarkeiten begleitet. Doch am Ende bleibt der Lockruf eines Landes, in dem Dimensionen und Geschwindigkeit des Bauens jegliches bekannte Mass übersteigen - und kaum ein Architekt vermag es, sich der Verlockung zu widersetzen.
Perspektivwechsel
Gerät aus europäischer Perspektive gemeinhin die bekannte westliche Prominenz ins Blickfeld, die sich gerne damit schmückt, die chinesische Architekturtradition eher zu respektieren als die Landsleute selbst, so präsentiert das Nederlands Architectuur Instituut (NAI) in Rotterdam nun unter dem Titel «China contemporary» eine unabhängige chinesische Architekturszene, die nicht mehr den marktbeherrschenden, von staatlicher Obhut in die partielle Eigenverantwortlichkeit entlassenen Architekturkombinaten entstammt. Erst 1993 konnte Jung Ho Chang das erste private Architekturbüro eröffnen, das als Atelier Feichang Jianzhu erfolgreich ist, und bis heute mag die freie Architektenszene - verglichen mit den gigantischen Bauvolumen - eher eine Marginalie darstellen. Bauaufgaben sind private Villen oder kleinere Kulturbauten; die typischen neuen Wohnquartiere oder Stadtplanungen werden eher an internationale Stararchitekten vergeben.
Insgesamt 40 Projekte von 18 Architekten sind im grossen Ausstellungssaal des NAI zu sehen. Die meisten der Planungen wurden unter dem Stichwort «Chineseness» subsumiert - anders als die grossen Architekturfirmen versuchen einige junge und kleine Büros, auf verschiedene Weise an die Bautradition des Landes anzuknüpfen. Dazu zählt der Campus der Nationalen Kunstakademie in Hangzhou (Amateur Architecture) ebenso wie die Neuinterpretation traditioneller Hofhaustypologien für ein touristisch zu nutzendes Jade-Dorf bei Xi'an, welches vom Büro Mada, das mittlerweile auch in europäischen Fachkreisen bekannt ist, konzipiert wurde. Eine Reihe der in der Ausstellung vertretenen Entwerfer hat im Ausland studiert oder gearbeitet - Quingyun Ma, Prinzipal von Mada, ist nach Jahren bei der amerikanischen Architekturfirma KPF in seine Heimat zurückgekehrt. Längst hat sich auch die Architekturszene globalisiert, Publikationen über die neuesten Trends sind überall auf der Welt erhältlich. In welchem Masse neue Konzepte sich in China durchsetzen können, bleibt unsicher, doch zeigt die Schau zumindest einige Versuche.
«Public Domain» ist ein weiterer Ausstellungssektor betitelt, in dem öffentliche Räume thematisiert werden. Plätze oder öffentliche, nicht religiös konnotierte Parkanlagen sind in der chinesischen Tradition nicht verwurzelt, sieht man von den Aufmarschflächen der kommunistischen Ära ab. Vom Wandel zeugen gestaltete Freiflächen inmitten neu errichteter Wohnkomplexe, vor allem aber der von dem Künstler und Architekten Ai Weiwei in der Stadt Jinhua gestaltete Hochwasserdamm des Flusses Jiwu mit einem dazugehörenden bandartigen Architekturpark. An den architektonischen Follies, die dort errichtet werden, sind neben den mit der Planung des Stadtviertels Jindong betrauten Architekten Herzog & de Meuron auch andere internationale und chinesische Architekten sowie die jungen Basler Büros Bucher Bründler, Christ & Gantenbein sowie Simon Hartmann beteiligt.
Kritisches Potenzial
Die Abteilung «Critical Urban Renewal» dokumentiert die noch zaghaften Versuche, der staatlichen Tabula-rasa-Mentalität entgegenzuwirken. Unter dem Titel «Urbanscape» werden alternative Modelle städtischer Transformation zur Diskussion gestellt. Die fotografische Studie «Informal China» von Jiang Jun widmet sich nichtoffiziellen, informellen privaten Bauvorgängen. Mit «Beijing Record» hat der Journalist Wang Jun 2003 eine als Bestseller gehandelte Untersuchung über die Zerstörung des kulturellen Erbes im Vorfeld der Olympischen Spiele Peking 2008 veröffentlicht. - Die vom niederländischen Architekturbüro Johan de Wachter gestaltete Rotterdamer Schau bietet eine Fülle von Material, das auf Podesten, Sockeln und Wänden präsentiert wird. Von der Decke abgehängte Elemente bilden eine zweite Schicht; zu sehen sind Ausschnitte aus kommerziellen Renderings der 800 Mitarbeiter beschäftigenden Firma Crystal Image, die Architekturprojekte visualisiert. Ein aus aufgeschichteten PVC-Röhren bestehender Lesepavillon wurde von Wang Hui (Neno 2529 Design Group) realisiert.
Die Schau im NAI wird ergänzt durch Ausstellungen im Museum Boijmans van Beuningen und im Nederlands Fotomuseum. Ausgewählt wurden Künstler, die sich weniger mit der kommunistischen Tradition oder dem Desaster der Kulturrevolution auseinandersetzen als vielmehr mit den gegenwärtigen Entwicklungen (die natürlich ohne die jüngere Vergangenheit nicht zu verstehen sind). Gezeigt werden Fotoarbeiten, Videos und Installationen, die den radikalen Wandel der vergangenen Jahre kritisch reflektieren. Als Beispiel erwähnt sei hier nur Shenzhen, das sich seit 1978 von einem 30 000 Einwohner zählenden Fischerdorf zu einer Megastadt mit mehr als 10 Millionen Menschen entwickelte.
[ Die Ausstellungen dauern bis zum 13. August (Boijmans van Beuningen) bzw. 6. September (NAI und Nederlands Fotomuseum). Katalog: China contemporary - Architecture, Art, Visual Culture. NAI Publishers, Rotterdam 2006. 416 S., Euro 29.95. ]
Wie bauen wir morgen?
UN Studio legt eine architektonische und städtebauliche Bilanz vor
Die digitale Revolution hat binnen weniger Jahre den Prozess architektonischen Entwerfens grundsätzlich verändert. Während sich der heutige Architekt immer mehr in einem hochkomplexen Gefüge sieht, das massgeblich von ökonomischen Kräften gesteuert wird, weiten sich zugleich seine Tätigkeitsfelder aus. Architektur, so heisst es daher in der jüngsten Publikation des Amsterdamer Büros UN Studio, sei «ein multifunktionaler Zwitter aus Infrastruktur und Stadtplanung».
DIGITALE ENTWURFSPRINZIPIEN
Der Architekt Ben van Berkel und die Kunsthistorikerin Caroline Bos gründeten 1989 ihr eigenes Büro, das seither nicht nur eine Reihe wichtiger Bauten realisieren konnte, sondern sich auch den Ruf erwarb, auf eigenständige Weise Praxis und Theorie zu verbinden. Zehn Jahre später unterzogen die Gründer ihr Büro «Van Berkel & Bos» einer grundsätzlichen Neuorganisation - die Funktion des Architekten als Koordinator und Netzwerkexperte habe das vormalige baumeisterliche Selbstverständnis abgelöst, bemerkt van Berkel rückblickend. Aus diesem zu neuer Agilität und Flexibilität führenden Häutungsprozess ging UN (United Network) Studio hervor. Das neue Konzept beruht nicht nur auf einer bewussten Anonymisierung der in ein Team integrierten Autoren, sondern war auch die Reaktion auf eine mehr und mehr global sich ausdehnende Tätigkeit - UN Studio ist in vielen Ländern Europas aktiv, aber auch in den Vereinigten Staaten und in Ostasien.
Gelang van Berkel & Bos 1996 mit der eleganten Erasmus-Brücke in Rotterdam, die alsbald zum Wahrzeichen der Stadt avancierte, der internationale Durchbruch, so kann das jüngst eröffnete Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart-Untertürkheim (NZZ 19. 5. 06) als bisher bedeutendstes Werk von UN Studio gelten. Es ist ein überzeugendes Beispiel dafür, dass digitale Entwurfsverfahren durchaus zu einer neuen Körperlichkeit, ja zeitgenössischen Monumentalität der Architektur führen können. Mitunter ist die von van Berkel proklamierte dynamische Doppelhelix von Kritikern sogar als barock tituliert worden. Das mag zunächst irritieren, wird aber plausibel, wenn man den Barock als Überwinder des Manierismus versteht. Im Gegensatz zu manchen seiner poststrukturalistisch inspirierten Zeitgenossen arrangiert und collagiert van Berkel von jeher nicht Formfragmente und Gedankensplitter der Moderne, sondern sucht nach einer Einheit auf höherer Ebene.
KONZEPTUELLE METHODEN
Soeben hat nun UN Studio eine opulent illustrierte Monographie vorgelegt, die mit «Designmodelle. Architektur Urbanismus Infrastruktur» betitelt ist. Wie schon das 1999 anlässlich des Büro-Relaunchs erschienene dreibändige Werk «Move» ist auch das neue Buch eine Mischung aus Werkmonographie, theoretischen Essays und Statements. Ausführlich präsentiert werden 34 Bauten und Projekte aus nunmehr 17 Jahren beruflicher Tätigkeit.
Gegliedert sind diese weder chronologisch noch typologisch, sondern nach den für ihr Entstehen massgeblichen «Designmodellen». Dabei handelt es sich gleichsam um eine Fortentwicklung der Diagramme, mit denen van Berkel & Bos in früheren Jahren operierten. Designmodelle sind gemäss dem Verständnis von UN Studio konzeptuelle Methoden, welche in Zeiten sich mehrender, den architektonischen Prozess bestimmender Faktoren gleichsam der Selbstvergewisserung dienen. Dank ihrer Abstraktheit erlauben sie Elastizität, ohne die Spezifik in der Konkretisierung zu unterbinden.
Zu diesen Modellen zählt etwa das Inklusivprinzip, also die Verschmelzung von Boden, Decke und Wand zu einer kontinuierlichen Form, wofür das NMR-Labor der Universität Utrecht ein Beispiel ist. Zu nennen sind aber auch mathematische Prinzipien, so das dem Möbius-Haus zugrunde liegende Möbius-Band, die Kleinsche Flasche (Projekt: Living Tomorrow, Amsterdam) oder die Kleeblattstruktur des Mercedes-Benz- Museums. Als «deep planning» bezeichnet UN Studio seit längerem Methoden, dreidimensionale Planung um den Faktor Zeit zu erweitern.
DAS GEBÄUDE ALS VISUELLER EINDRUCK
Ein abschliessender Essay widmet sich dem «Nachbild» (after image), der Vorstellung von einem Gebäude, die als Summe visueller Eindrücke beim Betrachter zurückbleibt. Die «Ikonizität» vordergründiger Label-Architektur könnte, so die Hoffnung der Autoren, einem komplexeren Verständnis von Architektur weichen. In Stuttgart ist das gelungen: Trotz seinem markanten Erscheinungsbild entzieht sich das Museum einer vorschnellen Charakterisierung. Umfassend dokumentiert - vom Digitalmodell über den Bauprozess bis hin zum realisierten Gebäude - wird das Mercedes-Benz-Museum in einer gerade in Barcelona erschienenen Baumonographie, die ebenfalls von UN Studio konzipiert wurde.
[ UN Studio: Designmodelle. Architektur Urbanismus Infrastruktur. Verlag Niggli, Sulgen 2006. 400 S., Fr. 88.-.
UN Studio: Buy me a Mercedes-Benz. Das Buch zum Museum. Actar, Barcelona 2006. 576 S., Euro 76.-. ]
Architekt der Architekten
Zum Tod von Kazuo Shinohara
Zu den populären Medienstars der Architektur hat Kazuo Shinohara nicht gehört: Dazu sind seine Bauten zu intellektuell, zu tiefgründig. Der 1925 geborene Japaner ist einer jener Architekten geblieben, die vor allem auf andere Architekten gewirkt haben. Entwerfer der mittleren Generation wie Toyo Ito und Kazuo Sejima haben von seinen Ideen gelernt, andere - wie Itsuko Hasegawa - bei ihm studiert. Ab 1970 unterrichtete er am Tokyo Institute of Technology, der Universität, deren markante Century Hall (1987) mit ihrem bekrönenden Halbzylinder als seine wichtigste spätere Arbeit gilt.
Kleine Einfamilienhäuser waren es, die Shinoharas Ruhm begründeten. Zunächst hatte sich der Architekt mit der fernöstlichen Tradition auseinandergesetzt: Das Haus in Kugayama (1954) wurde von Kritikern als eine Synthese aus der Formenwelt des Katsura-Palastes sowie derjenigen Mies van der Rohes verstanden; das «House in White» (1966) wirkt wie die Abstraktion eines japanischen Tempels. Shinohara reiste in den jungen Jahren nicht nach Europa oder in die USA. Er adaptierte die westliche Moderne als ein intellektuelles Konzept. Eine Auseinandersetzung mit den Prinzipien von Form, Geometrie und Raum bestimmte Shinoharas Schaffen; von klaren Strukturen der Anfangsjahre gelangte er zu zunehmend komplexeren Strukturen.
Bedeutung erlangte der Architekt überdies als Theoretiker, wobei er sich auch der «progressiven Anarchie» des Tokioter Urbanismus widmete. In den neunziger Jahre hat Shinohara seine Bewunderer nicht zuletzt unter jungen Schweizer Architekten gefunden. Ein von Christian Kerez herausgegebener Textkorpus soll Ende 2007 erscheinen. Am vergangenen Samstag ist Kazuo Shinohara im Alter von 81 Jahren in Kawasaki gestorben.
Nachtgesicht der Architektur
Die Ausstellung «Leuchtende Bauten» im Kunstmuseum Stuttgart
Die Nachtwirkung von Architektur wurde schon in früheren Jahrhunderten erprobt und fasziniert bis heute. Nun feiert das Kunstmuseum Stuttgart das Phänomen mit einem kulturhistorischen Panorama.
Bis weit ins 19. Jahrhundert hinein war die nächtliche Wirkung von Gebäuden kaum ein Thema für die Architekten, sieht man einmal von durch barocke Feuerwerke illuminierten ephemeren Festarchitekturen und von frühen Experimenten mit Gasbeleuchtungen ab. So nutzte beispielsweise der Fotopionier Nadar eine Gasleuchtschrift als Reklame für sein Pariser Atelier. Erst als die Elektrizität zur Verfügung stand, konnten Glühlampen die gebaute Umwelt des Nachts verwandeln. Zu Experimentierfeldern für die künstliche Beleuchtung wurden die Weltausstellungen. Der Eiffelturm galt als die Hauptattraktion der Pariser Schau von 1889 und war mit Scheinwerfern sowie mit einer Drehlaterne bekrönt, welche den Nachthimmel in den Farben der Trikolore erhellte. Elf Jahre später war - laut Julius Lessing, dem damaligen Leiter des Berliner Kunstgewerbemuseums - das Palais der Elektrizität der «Clou» der neuerlich in Paris veranstalteten Weltausstellung, auch wenn Hermann Muthesius konstatierte, das Gebäude gehöre aufgrund seiner eklektizistischen Formensprache mehr in den Bereich der Zuckerbäckerarchitektur als in jenen der Architektur. Aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang das Urteil von Julius Meier-Graefe, der bemerkte, dass der historistische Zierrat im Dunklen verschwinde: «Was bleibt, sind die grossen Umrisse, das ungeheuerlich Massige dieser Schöpfung. Ganz von selbst vollzieht dann die Nacht das, was wir von der neuen Baukunst erwarten: Konzentration und Grösse.»
Aktualität des Themas
«Leuchtende Bauten: Architektur der Nacht» heisst eine mit opulenten Exponaten aufwartende Ausstellung des Kunstmuseums Stuttgart. Ihr Konzept wurde zu grossen Teilen von dem an der Brown University im amerikanischen Providence lehrenden Architekturhistoriker Dietrich Neumann erarbeitet. Mit einem kulturhistorischen Panorama vom Siegeszug des elektrischen Lichts auf den Weltausstellungen bis hin zu aktuellen Beleuchtungskonzepten stützt sich Neumann auf eine eigene Publikation, die 2002 ebenfalls unter dem vom Architekten Raymond Hood 1930 geprägten Titel «Architektur der Nacht» erschienen ist. Für die jetzige Ausstellung gibt es - jenseits der unstrittigen Aktualität und Attraktivität des Themas - zweierlei Anlass: Zum einen ist das neue, mit einem von innen beleuchteten Glasmantel umgebene Kunstmuseum des Architekturbüros Hascher Jehle abends selbst ein leuchtender Bau. Zum anderen hat die Stadt Stuttgart einen Licht-Masterplan erarbeiten lassen, mit dessen Umsetzung gerade begonnen worden ist. Zu ersten Fixpunkten avancierten eine Inkunabel der Architektur der zwanziger Jahre, der unlängst restaurierte Tagblatt-Turm von Ernst Otto Osswald, sowie die Stiftskirche. Derzeit sind Licht-Masterpläne (wie etwa Zürichs «Plan Lumière») en vogue, kommen sie doch den Forderungen des Stadtmarketing ebenso entgegen wie dem Bedürfnis nach Orientierung und Sicherheit.
Die Stuttgarter Ausstellung setzt deshalb nicht im 19. Jahrhundert ein. Vielmehr werden heutige Beispiele der Nachtarchitektur mittels Fotos und Modellen präsentiert. Dazu zählen die Glashülle des Kunsthauses Bregenz von Peter Zumthor, die immer wieder von Künstlern unterschiedlich bespielt wird, aber auch die Installation aus kreisförmigen Neonleuchten von Peter Cooks Kunsthaus in Graz. Die aus Lichtpailletten bestehende Fassade eines Warenhauses in Seoul (UN Studio) und die Allianz Arena in München (Herzog & de Meuron) belegen das zeitgenössische Interesse an farblich wechselndem Licht.
Vorbei an einem riesigen Modell der «Tour Lumière Cybernétique», die der französische Künstler Nicolas Schöffer von 1963 an als 307 Meter hohe interaktive Plastik für die Pariser Défense plante, gelangt man in einen Saal, der das Erlebnis New York thematisiert. Zu den mit Flutlicht illuminierten Set-back-Hochhäusern Manhattans aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts trat die Leuchtreklame, die schon zu dieser Zeit in den Lichtorgien des Times Square kulminierte. Die Wahrnehmung europäischer Besucher war von Faszination und Skepsis gleichermassen bestimmt: Erich Mendelsohn, der 1924 auf dem gleichen Schiff wie Fritz Lang in die Vereinigten Staaten gereist war, druckte in seinem Bildband «Amerika» eine Foto des Regisseurs ab, die den Times Square zeigt. Die Impressionen aus der Neuen Welt sollte Lang mit dem Film «Metropolis» verarbeiten, während der Architekt mit seinen Warenhäusern eine spezifisch europäische Verwendung des Lichts erprobte. Neben milchig-weissen Lichtbändern ist es zunehmend die innere Beleuchtung, welche dem nächtlichen Baukörper Gestalt verleiht. Mit Mies van der Rohes Seagram Building von 1958 in New York begann sich dieses eher rational bestimmte Lichtkonzept auch gegenüber den amerikanischen Farblichtkaskaden durchzusetzen.
Ein Originalmodell des Eiffelturms aus dem Jahr 1888 verweist auf die Weltausstellungen als Marksteine für moderne Illuminationsstrategien. Wunderbare Gouachen von André Granet zeugen von der nächtlichen Verwandlung des Pariser Wahrzeichens im Jahr 1937, Entwürfe von Jean Labatut sowie Postkarten geben eine anschauliche Vorstellung von den Leuchtfontänen der New Yorker Weltausstellung 1939. Vom märchenhaften Lunapark am Strand von Coney Island lässt sich ein Bogen schlagen bis zu dem nächtlich beleuchteten «Blur Building» von Diller and Scofidio, der «Wolke» für die Schweizer Expo 02 in Yverdon.
Vision und Pragmatismus
Die ephemeren Wurzeln der Lichtarchitektur im Bereich von Spektakel und Vergnügen trugen dazu bei, dass sich europäische Architekten dem Licht als neuem Baumaterial nur langsam zuwandten. Bruno Tauts - wiederum ephemeres - Glashaus auf der Kölner Werkbundausstellung 1914 war gleichsam das Präludium für die Faszination von Kristall, Glas und Licht, welche den parareligiös aufgeladenen architektonischen Expressionismus in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg prägte.
Die ekstatischen Visionen auf dem Papier wichen einem gewissen Pragmatismus, sobald es wieder etwas zu bauen gab. In Berlin entstand ein neuer Typ von Grossstadtarchitektur, bei dem Licht als strukturell gliederndes Element eingesetzt wurde. Auch in Stuttgart fanden die neuen Konzepte ihren Niederschlag: mit Erich Mendelsohns Kaufhaus Schocken, dem konturbeleuchteten Tagblatt-Turm von Osswald oder Richard Döckers Lichthaus Luz; 1928 wurde gar ein offizielles Lichtfest gefeiert. Ein im gleichen Jahr von Mies van der Rohe vorgeschlagenes Büro- und Bankgebäude gegenüber dem Hauptbahnhof mit seiner radikalen Fassade aus mattiertem hinterleuchtetem Spiegelglas blieb leider ebenso unrealisiert wie das diesem vergleichbare Kaufhaus Adam in Berlin.
[ Bis 1. Oktober im Kunstmuseum Stuttgart, anschliessend vom 27. Januar bis 6. Mai 2007 im Nederlands Architectuurinstituut in Rotterdam. Katalog: Leuchtende Bauten. Architektur der Nacht. Hrsg. Dietrich Neumann und Marion Ackermann. Verlag Hatje Cantz, Ostfildern-Ruit 2006. 152 S., Euro 39.80. ]
Neue Stadt am Fluss
Die «Hafen-City» mitten in Hamburg gewinnt Konturen
In Hamburg schliesst die neue «Hafen- City» direkt an die Altstadt an. Die ersten Bauten stehen, der Wettbewerbsentscheid für das zentrale Areal fiel unlängst. Im Rahmen des gegenwärtigen Hamburger Architektursommers wird diesem viel Aufmerksamkeit zuteil.
Seit Mitte des 19. Jahrhunderts erlebte der Hamburger Hafen einschneidende Umgestaltungen. Mit dem von Wasserbaudirektor Johannes Dalmann massgeblich betriebenen Konzept eines «offenen Tidehafens» entschied man sich gegen das Londoner Modell des «Dockhafens», bei dem die Hafenanlagen gegenüber der dem Tidehub unterliegenden Themse durch Schleusen abgetrennt waren. Dass die britische Kapitale ihren Hafen längst aufgeben musste, während das gut 100 Kilometer von der Elbmündung entfernte Hamburg seine Umschlagkapazitäten weiterhin erhöht, ist nicht zuletzt der damals weitsichtigen Entscheidung für eine moderne Hafeninfrastruktur zu verdanken. Mit dem künstlich angelegten und seeschifftief ausgehobenen Sandtorhafen auf dem Grasbrook entstand 1862-1866 das modernste Hafenbecken der Welt. Quaischuppen flankierten die Hafenmauern, landseitig erfolgte der Abtransport durch die Eisenbahn. Die Verkürzung der Liegezeit, die ohnehin von Ebbe und Flut unabhängig war, führte zu einer Effizienzsteigerung des Hafens. Mit dem benachbarten Grasbrookhafen, dem rechtwinklig dazu angelegten Magdeburger Hafen und schliesslich dem weiter flussaufwärts gelegenen Baakenhafen fand Dalmanns Konzept seine Fortsetzung.
Hafen im Wandel
Aufgrund eines nach der Reichsgründung 1871 mit der Berliner Regierung ausgehandelten Zollvertrags entstand das grandiose Ensemble der Speicherstadt, das durch den Zollkanal von der gegenüberliegenden Altstadt abgeschnitten war. Mit der Einrichtung des Freihafens trennten sich Stadt und Hafen: Prägte das an den Fleeten gelegene Hamburger Kaufmannshaus mit seiner Verbindung von Kontor, Speicher und Wohnbereich einst die Innenstadt, so ereignete sich nun eine funktionale Entmischung und räumliche Separierung. Die Hafenbereiche blieben unbetretbar für alle, die nicht dort arbeiteten. Mit der Einführung der Containerschiffe - das erste legte 1968 im Hamburger Hafen an - begann ein neuerlicher und sukzessiver Prozess der Restrukturierung der Hafenareale. Wer vom idyllischen Strand Övelgönne am Altonaer Ufer auf die andere Elbseite blickt, sieht das gigantische Containerterminal Waltershof. Indem sich der Schwerpunkt des Hafens von der Innenstadt weg Richtung Westen verlagerte, ergab sich die Chance, die Hafenareale des 19. Jahrhunderts als «Hafen-City» neu zu nutzen.
Wie das nicht nur während des Hamburger Architektursommers gut besuchte, im einstigen Kesselhaus der Speicherstadt eingerichtete Besucherzentrum zeigt, nimmt die Hamburger Bevölkerung regen Anteil an der Entstehung der «Hafen-City». Zwischen Speicherstadt und Elbe wird das die alten Hafenbecken umgebende Areal von 155 Hektaren in den nächsten Jahren neu bebaut; die Fläche der Innenstadt erweitert sich dadurch um 40 Prozent. Nach jahrzehntelanger Trennung findet die Stadt wieder an den Fluss zurück - und das in einem vom Hauptbahnhof schnell zu Fuss erreichbaren Bereich. Ausgelegt ist die Gesamtplanung für 12 000 Einwohner und 40 000 Arbeitsplätze.
Auf Basis einer 1997 veröffentlichten Vorstudie von Volkwin Marg vom Hamburger Architekturbüro von Gerkan, Marg und Partner wurden seitens der Stadt, in deren beinahe ausschliesslichem Besitz sich die Areale befinden, in der Folgezeit wichtige Grundsatzentscheidungen getroffen. Diese betrafen den Nutzungsmix, aber auch die Art des Hochwasserschutzes. Um eine «Einpolderung» durch Hochwassermauern zu vermeiden, gilt ein «Warftenmodell»: Sämtliche Neubauten werden auf hohen Sockeln errichtet, die auch als Evakuierungswege dienenden Haupterschliessungsachsen liegen auf einem relativ hohen Niveau.
Der von der ortsansässigen Planungsgemeinschaft «hamburgplan» gemeinsam mit dem Büro Kees Christiaanse / ASTOC 1999 erarbeitete Masterplan stellt eine plausible Planungsgrundlage dar: Die Teilung der Gesamtfläche beugt der Monotonie vor, schafft eine Abfolge von zwölf Quartieren unterschiedlicher Nutzung und Atmosphäre und ermöglicht überdies eine etappenweise Realisierung. Die Bebauung erfolgt dabei von Westen nach Osten; sie begann mit dem inzwischen fertig gestellten, das Nordufer des Sandtorhafens begleitenden Quartier Sandtorkai unmittelbar südlich der Kehrwiederspitze der Speicherstadt - und wird gegen 2025 mit dem für Hochhäuser vorgesehenen Quartier Elbbrückenzentrum an den Norderelbbrücken ihren Abschluss finden.
Den Schwerpunkt öffentlicher Nutzungen soll der Bereich um den nordsüdlich ausgerichteten Magdeburger Hafen bilden, doch inzwischen ist zumindest von zwei Polen zu sprechen. Denn nachgerade hineingeschmuggelt in den Gesamtplan wurde die einer Privatinitiative erwachsene Idee der Elbphilharmonie am westlichen Ende des Planungsareals. Das visionäre Konzept der Basler Architekten Herzog & de Meuron, den denkmalwürdigen Ziegelsteinkoloss des Kaispeichers A mit einer zeltartigen Konzertsaalkonstruktion zu überbauen, hat nicht nur die lange Zeit mit Kleinmütigkeit der verantwortlichen Politiker konfrontierte Kulturszene begeistert, sondern auch den Segen der Bürgerschaft erhalten. Kein Zweifel, das neue Wahrzeichen beflügelt auch die Planung der übrigen Gebiete und setzt in qualitativer Hinsicht neue Massstäbe.
Stars und Lokalmatadoren
Acht sieben- bis achtgeschossige Bürogebäude, die über den Uferweg am Sandtorkai auskragen und als Solitäre den Blick auf die Speicherstadt frei lassen, sind neben den Platzgestaltungen von Benedetta Tagliabue die ersten realisierten Vorboten der «Hafen-City». Mit Architekten wie Spengler Wiescholek, Böge-Lindner, Jan Störmer und Bothe Richter Teherani sind die wichtigsten Platzhirsche vertreten; die Haltung oszilliert zwischen sauberer Solidität und verhalten-experimentellem Gestus. Gegenüber, auf der Südseite des Sandtorhafens, hat die Bebauung mit einem winkelförmigen Volumen von David Chipperfield begonnen. Eines der interessantesten Projekte entsteht in unmittelbarer Nachbarschaft, am Dalmannkai. Für Luxuswohnungen von Philippe Starck werben inmitten von Kränen Bauschilder mit den Buchstaben «yoo», die für ein Joint Venture des Kölner Immobilienunternehmens Vivacon mit dem französischen Stardesigner stehen. Dabei erstellt und verkauft Vivacon die Immobilien, und im Verkaufsbüro können Kaufinteressenten aus einer Palette von Einrichtungsgegenständen wählen, die der Meister entworfen oder ausgesucht hat. Als grobe Orientierung dienen vier vorgegebene Einrichtungslinien. Glaubt man den Broschüren, mit denen das Konzept vermarktet wird, ist der Wertzuwachs der Wohnungen vorprogrammiert.
Wendet man sich von Chipperfields Bürogebäude in die andere Richtung, so gelangt man zum «Cruise Center», das derzeit inmitten einer Mondlandschaft aus Grossparkplätzen und Abbruchbrachen liegt. Dass Kreuzfahrtschiffe wie die «Queen Mary II» auch zukünftig hier festmachen werden, ist eine strategisch geschickte Entscheidung. Einerseits garantieren die weissen Riesen jene maritime Atmosphäre, welche die «Hafen-City» nach dem Ende des Hafenbetriebs in diesem Bereich benötigt, andererseits hat das Überseequartier damit tatsächlich die Chance, die Landungsbrücken als historisches Tor zur Welt abzulösen. So war der Ende des vergangenen Jahres entschiedene Investoren- und Architekturwettbewerb für eben diesen Teil der «Hafen-City» wohl der wichtigste insgesamt.
Verkauft wird der westliche, Überseequartier genannte Teil des Magdeburger Hafens an ein Bieterkonsortium um die Bank ING. Rem Koolhaas hat die markantesten Bauten entworfen, das Kreuzfahrtterminal und ein «Der 6. Kontinent» tituliertes Volumen, das ein Grossaquarium und ein «Science Center» umfassen soll. Wie zwei gigantische Nussschalen, die eine schiffartig ruhend, die andere in die Höhe gerichtet, rahmen die beiden Solitäre eine dekonstruktiv-verzerrte Bebauungsstruktur, für welche NPS Tchoban Voss, BDP und Erick van Egeraat die Entwürfe geliefert haben. Von van Egeraat stammt auch der Entwurf von «De Waterkant», dem markanten Zweierensemble, das den elbseitigen Auftakt des Überseequartiers bildet. Natürlich handelt es sich zunächst um Vorstudien. Was an der «Hafen- City» indes überzeugt, ist der Versuch, einer Monofunktionalität der Stadt entgegenzuwirken. In Zivilisationen, die keine Schiffe besässen, versiegten die Träume, behauptete Michel Foucault. Darum muss sich Hamburg nicht sorgen. Es muss einzig die Träume lebendig halten.
Meisterwerke unter dem Messer
Zur Restaurierung und Rekonstruktion von Bauten Frank Lloyd Wrights in den USA
Nicht zuletzt dank seiner Vielseitigkeit war Frank Lloyd Wright der bedeutendste Architekt des 20. Jahrhunderts in den USA. Von seiner heutigen Wertschätzung zeugen derzeit Restaurierungsprojekte in Buffalo, Minneapolis und Mason City. Diese stellen aber auch widersprüchliche Beispiele für den Umgang mit Baudenkmälern der Moderne dar.
Die Berufskarriere von Frank Lloyd Wright begann 1887 und endete 1959. In dieser Zeitspanne konnte er mehr als 430 Bauten realisieren. Gewiss, es sind formale Reprisen darunter. Doch die unbändige Schaffenskraft und Vielseitigkeit des auch als Designer und Urbanist tätigen Architekten nötigt Respekt, ja Bewunderung ab. Bauten wie das Robie House (1910) in Chicago, das Haus Fallingwater (1937) in Mill Run oder das Guggenheim-Museum (1959) in New York zählen zu den grossen architektonischen Meisterwerken des 20. Jahrhunderts, und Wrights Atelier- und Wohnhaus im Villenvorort Oak Park bei Chicago fungiert nachgerade als Pilgerstätte. Leider ist aber auch der Verlust einiger aussergewöhnlicher Bauten zu beklagen; noch 1968 fiel das Imperial Hotel in Tokio, Wrights bedeutendster im Ausland realisierter Bau, dem Abriss zum Opfer. Doch vielerorts in den USA werden inzwischen Anstrengungen unternommen, gefährdete Bauten zu restaurieren und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das breite Interesse macht derlei Vorhaben auch ökonomisch interessant.
VERLUSTE UND NEUBAUTEN
Als Anfang Januar 2006 das Wilburt Wynant House in Gary, Indiana, niederbrannte, entschloss sich der Eigentümer unverzüglich, das Gebäude wiederaufzubauen. Dabei handelt es sich um eine Totalrekonstruktion, denn das 1916 errichtete Wohnhaus ist eines jener präfabrizierten, aus Holz bestehenden «American System- Built Houses», die der Architekt zwischen 1911 und 1917 für die Richards Company in Milwaukee entwarf. Ziel der Kooperation war es, vergleichsweise preisgünstige, aber räumlich dennoch variable Systembauten für die Mittelschicht anzubieten; viele der Häuser sind erst jüngst als Wright-Entwürfe wieder entdeckt worden.
Ganz anders in Buffalo: Für den dort ansässigen Seifenkonzern Larkin erhielt Frank Lloyd Wright im Jahr 1902 den Auftrag, ein Verwaltungsgebäude zu errichten. Der neue Sitz der Versandabteilung mit seinen offenen Bürozonen, die sich um einen von Pfeilern rhythmisierten Lichthof gruppierten, zählte zu den Inkunabeln der Architektur des 20. Jahrhunderts. Nach dem Konkurs der Firma wurde das Gebäude 1949 durch die Stadt zum Abriss freigegeben. Bis heute ist der Ort des Gebäudes nicht neu bebaut worden. - Besser erging es dem Haus, das der Verwaltungsleiter von Larkin, Darwin D. Martin, für sich im Villenviertel Parkside errichten liess - einem Quartier, dessen städtebauliches Layout auf einen Entwurf von Frederick Olmsted, dem Schöpfer des New Yorker Central Park, zurückgeht. Eigentlich handelt es sich bei der Residenz von Martin nicht um ein Einzelhaus, sondern um ein Konglomerat verschiedener Bauteile. 1903 entstand für Martins Schwester und Schwager das George-Barton-Haus im Nordosten des ausgedehnten Grundstücks, ein typisches Prairie- House in Kreuzform, mit dem Wright um 1900 ein der amerikanischen Landschaft angepasstes Wohnmodell erfunden hatte: Der Eingang liegt im Süden, das Speisezimmer im Westen, der Wohnbereich im Osten, die Küche im Norden, die Schlafzimmer im Geschoss darüber.
Das Haus für Martin selbst, das etwas später im Südwesten des Grundstücks errichtet wurde, folgt - um 90 Grad gedreht - dem gleichen Organisationsprinzip. Allerdings sind die Dimensionen deutlich grösser und die Haupträume von einer Reihe weiterer Zimmer umgeben. Nach Norden liess der Bauherr eine lange Pergola anfügen, die auf der Höhe des Barton House in einer Blumenhalle endete. Daneben plante Wright eine Garage mit Stall und ein Gewächshaus. Ein orthogonaler Raster liegt der Gesamtanlage, zu der auch der Gartenbereich zählt, zugrunde. Es handelte sich um das grösste Präriehaus-Projekt, das der Architekt je realisierte; vom Luxus der Ausstattung, die erst 1907 fertig gestellt war, zeugt nicht zuletzt die Vielzahl dekorativer Glasfenster. Nach einigen Jahren der Verwahrlosung erwarb 1955 ein neuer Eigentümer das Anwesen.
Zwölf Jahre später gelangte es in den Besitz der University of Buffalo, State University of New York. Allerdings waren schon 1960 die Pergola, die Garage und die Gewächshäuser abgerissen worden, um Platz zu schaffen für drei Apartmentbauten. 1992 gründete sich die Martin House Restoration Corporation mit dem Ziel, das Ensemble wieder in den Ursprungszustand zurückzubauen. Das Fundraising war erfolgreich, die benötigten 23 Millionen Dollar für die Restaurierung der bestehenden beiden Häuser, den Neubau der abgerissenen Bauteile sowie ein neues Visitors' Center (nach dem Entwurf des in Harvard lehrenden Toshiko Mori) liegen vor. Im Herbst 2004 konnten die Bauarbeiten im Gartenbereich mit der Niederlegung der Apartmentbauten beginnen. Inzwischen ist die Pergola weitgehend wiederhergestellt, die Fundamente für Garage und Gewächshäuser sind gegossen. Rechtzeitig zum Hundertjahrjubiläum des Darwin D. Martin House im kommenden Jahr soll das Ensemble in neuer Pracht glänzen. Unfreiwillig verräterisch spricht die Restoration Corporation vom «latest Wright», der jährlich 100 000 Besucher anziehe und 20 Millionen Dollar in die regionale Ökonomie fliessen lasse.
PROBLEMATISCHE REKONSTRUKTIONEN
Mag der frühere Ensemble-Charakter das Rekonstruktionsvorhaben auf dem Martin-Grundstück noch legitimieren, so fällt man mit der Realisierung von drei Entwürfen für Buffalo, die der Meister zu seinen Lebzeiten nicht ausführte, hinter die internationalen Standards im Umgang mit einem abgeschlossenen uvre zurück. Den Anfang machte 2004 das Blue-Sky-Mausoleum, eine aus einem aufragenden Block und zwölf sich abtreppenden Stufenpaaren bestehende Memorialarchitektur. Zwischen 1925 und 1928 zeichnete Frank Lloyd Wright das Mausoleum als Familiengrabstätte für die Martins; der jetzt nach diesen Plänen an der vorgesehenen Stelle auf dem parkartigen Forest Lawn Cemetery realisierte Bau in weissem Granit wird durch den Verkauf von 24 Gruften finanziert. Diese böten, so die Frank Lloyd Wright Foundation, «the only opportunities in the world where one can choose memorialization in a Frank Lloyd Wright structure». Als Souvenir für zu Hause erhalten die Käufer eine Stele aus Steuben-Kristall, deren oberer Abschluss Treppenanlage und Monument des Blue- Sky-Mausoleums nachbildet.
Nun hat sich ausserdem der ebenfalls in Buffalo ansässige Westside Rowing Club, der bedeutendste Ruderklub des Landes, entschlossen, den viel publizierten Entwurf für ein Rowing Boathouse aus dem Jahr 1905 zu bauen. Dem Projekt wurde unlängst seitens des Staates New York eine Million Dollar zugesprochen - wie auch der Errichtung der ebenfalls von Wright konzipierten Tydol Filling Station auf dem Gelände des Buffalo Transportation Museum. Wie das Darwin D. Martin House sollen auch Ruderklub und Tankstelle im nächsten Jahr fertig gestellt sein.
ERFOLGE IN MASON CITY
Wright reiste 1908 nach Mason City im ländlichen Iowa, das auf halber Strecke zwischen Minneapolis und Des Moines gelegen ist. J. E. E. Markley, Verwaltungsratsmitglied der lokalen City National Bank, hatte Kontakt mit ihm aufgenommen - seine Töchter besuchten die von Tanten des Architekten geführte Hillside Home School in Spring Green, Wisconsin, Wrights später mehrfach erweitertes Erstlingswerk von 1887. Die Bauarbeiten für das neue Bankgebäude und das anschliessende «Park Inn»-Hotel begannen 1909. Da Wright in jenem Jahr mit seiner neuen Lebensgefährtin Hals über Kopf nach Europa aufbrach, wo er seine erste umfassende Publikation für den Berliner Verlag Ernst Wasmuth vorbereitete, wurden die Gebäude unter der Leitung von William Drummond fertig gestellt, einem Mitarbeiter aus dem Oak Park Studio.
Der neue Stil war so erfolgreich, dass Drummond gleich den Auftrag für ein weiteres Gebäude erhielt und zwei weitere frühere Schüler von Wright, Walter Burley Griffin und Francis Barry Byrne, von einem Developer der Abwesenheit des Meisters wegen mit einer ganzen Siedlung von Häusern im Prairie-Style beauftragt wurden. Die in parkartigem Ambiente eines kleinen Flusstals realisierten Bauten sind eine touristische Attraktion in Mason City; in unmittelbarer Nachbarschaft befindet sich das vor einigen Jahren um einige hundert Meter versetzte und heute als Museum geführte Stockman House, das Wright 1908 für einen Nachbarn von Markley errichtet hatte. Grundlage dieses Präriehauses war der vielbeachtete, 1907 im «Ladies Home Journal» veröffentlichte Entwurf eines «Fireproof House of $ 5000» - hier allerdings nicht in Beton, sondern als typisch amerikanische Balloon- Frame-Konstruktion in Holz ausgeführt.
Während das Bankgebäude schon 1926 in ein Ladenlokal umgewandelt wurde, schloss das Hotel erst 1972 seine Pforten. Obwohl seit dieser Zeit unter Denkmalschutz stehend, verfiel das relativ gut erhaltene Gebäude, so dass es 1999 als eines der zehn gefährdetsten Baudenkmäler in Iowa eingestuft wurde. Doch inzwischen hat sich die Situation zum Positiven gewendet: Im Februar 2000 erwarb die Stadt das Haus, und im vergangenen Jahr begannen unter Leitung der gemeinnützigen Organisation «Wright on the Park» die Restaurierungsarbeiten. 2010 soll das Gebäude, dessen Ausstattungsdetails sich in Teilen erhalten haben, als Hotel mit 42 Zimmern wieder zum Leben erweckt werden - Restaurant und Souvenirshop im Erdgeschoss inklusive. Besondere Bedeutung besitzt das «Park Inn», weil es als symmetrischer Ziegelsteinbau mit expressiver Körpergliederung den Vorläufer zweier zerstörter Meisterwerke Wrights darstellt: der Midway Gardens in Chicago (1913) sowie des Imperial Hotel in Tokio (1914-1922). Die Wiederherstellung des Bankgebäudes ist ebenfalls geplant.
EIN SCHLÜSSELWERK IN MINNEAPOLIS
In den dreissiger Jahren wandte sich Frank Lloyd Wright vom Konzept der Prairie-Houses ab und entwickelte einen neuen Typ, der unter dem Namen «Usonian House» bekannt wurde. Typisch für diese Gebäude sind das reduzierte Raumprogramm und die freiere, fliessende Grundrissanordnung: Wohn- und Essbereich sowie Küche bilden ein Kontinuum. Das Malcolm Willey House in Minneapolis von 1933 ist nicht zuletzt deshalb ein wichtiges Werk, weil es den Übergang zum Usonian House markiert: Die Räume sind entlang einer Backsteinmauer aufgereiht und öffnen sich Richtung Süden mit Terrassen zum Garten. Der topographische Kontext des einstmals in idyllischer Lage am westlichen Steilufer des Mississippi in unmittelbarer Nachbarschaft zur Schwesterstadt St. Paul gelegenen Hauses wurde durch den in den sechziger Jahren angelegten Interstate Highway 94 empfindlich gestört. In den neunziger Jahren stand das Gebäude leer und verkam zusehends. Steve und Lynette Sikora, die neuen Eigentümer, begannen im Jahr 2002 als Privatleute eine vorbildliche, denkmalgerechte Sanierung, deren Fortschritte sie mit mehreren ausführlichen Reports pro Jahr im Internet dokumentieren. Neuerdings ist es nach Voranmeldung auch hier möglich, das inzwischen zu grossen Teilen wiederhergestellte Meisterwerk des Architekten zu besichtigen.
Der Umgang mit dem uvre des grossen Amerikaners zeigt paradigmatisch, dass sich für die Auseinandersetzung mit Meisterwerken der modernen Architektur dieselben Fragen stellen, wie sie im denkmalpflegerischen Diskurs schon seit Beginn des 20. Jahrhunderts diskutiert werden. Spuren späterer Nutzungen gelten als historische Zeugnisse; ob sie jedoch wirklich erhaltenswert sind, hängt vom Grad ihrer Aussagekraft ab. Belanglose Veränderungen in jedem Falle zu bewahren, wäre genauso dogmatisch wie der Rückbau auf einen vermeintlichen Originalzustand. Andererseits kann der Wunsch, eine bedeutende, aber verlorene räumliche Struktur physisch erlebbar werden zu lassen, in Einzelfällen durchaus legitim sein. Beispiele hierfür sind der Nachbau des Barcelona-Pavillons von Mies van der Rohe in Barcelona und der in Barcelona neu erstandene Pavillon de l'Esprit Nouveau, den Le Corbusier 1925 für die Exposition des Arts Décoratifs in Paris errichtet hatte. Wenn jedoch niemals realisierte Entwürfe postum gebaut werden, wie dies jetzt in Buffalo geschieht, ist die Grenze des Vertretbaren deutlich überschritten.
Besser wohnen - schöner leben
Jean Prouvé im Deutschen Architektur-Museum in Frankfurt
Der französische Konstrukteur, Designer und Architekt Jean Prouvé (1901-1984) stösst seit einiger Zeit auf verstärktes Interesse. In Frankfurt ist jetzt eine grossartige Retrospektive seines Werks zu sehen, die anschliessend im Vitra Design Museum in Weil am Rhein gezeigt wird.
Ihren Sieg im Wettbewerb für das Centre Pompidou in Paris hatten Renzo Piano und Richard Rogers 1971 massgeblich einem Mann zu verdanken: Jean Prouvé. Der 70-jährige Jurypräsident verhalf den beiden Architekten zum Durchbruch. In der Folge erlangten Piano und Rogers mehr Aufmerksamkeit, als sie ihrem Mentor je zuteil wurde: Obwohl Jean Prouvé (1901-1984) als der bedeutendste französische Konstrukteur des 20. Jahrhunderts gelten kann, war er zu Lebzeiten fast nur der Fachwelt ein Begriff. Er selbst verstand sich nicht als Architekt oder Ingenieur, sondern wählte «homme d'usine» als adäquate Berufsbezeichnung. Der gelernte Kunstschmied blieb hinsichtlich seines Verhältnisses zur Technik bei allen Neuerungen, die sich mit seinem Namen verbinden sollten, handwerklich geprägt. Als Mart Stam, Marcel Breuer oder Mies van der Rohe in den zwanziger Jahren mit ihren Freischwingern die physische Präsenz des Stuhls zu eliminieren suchten, realisierte Prouvé Mobiliar, welches die Prinzipien von Tragen und Last ebenso anschaulich werden liess wie den technischen Herstellungsprozess. Und während sich manche Ingenieure, beseelt vom Fortschrittsglauben, als Schöpfer utopischer Welten wähnten, befasste er sich mit Fassadenelementen, die einfach aussehen und doch verschiedene Funktionen vereinen.
Fassaden und Möbel
In den vergangenen Jahren ist ein wachsendes Interesse an Prouvé zu verzeichnen. Es hat seinen Niederschlag gefunden in Ausstellungen in Paris anlässlich des 90. (gestaltet von Renzo Piano) und des 100. Geburtstags sowie einer Reihe von Veröffentlichungen, lässt sich aber noch deutlicher belegen anhand der astronomischen Preise, welche Originalarbeiten des Konstrukteurs mittlerweile erzielen. Im Jahr 2000 hat die Firma Vitra die Exklusivrechte an den Entwürfen übernommen und seitdem einige Reeditionen von Möbeln herausgebracht: Stühle, Tische und eine Leuchte. Nun wurde vom Genfer Architekturhistoriker Bruno Reichlin und von seinem Team eine umfangreiche Prouvé-Ausstellung erarbeitet. Erste Station der Schau war die an der Koproduktion beteiligte Design Museum Factory der Keio University in Tokio; nun ist die Retrospektive im Deutschen Architektur-Museum in Frankfurt zu sehen, bevor sie im Herbst ins Vitra Design Museum in Weil am Rhein weiterwandert.
Prouvé, der Sohn eines Protagonisten der Ecole de Nancy, eröffnete 1924 seine Werkstatt und reüssierte zunächst mit Schmiedearbeiten im Stil des Art déco. Über Robert Mallet-Stevens gelangte er in Kontakt mit der Avantgarde des französischen Bauens. Die Maison du Peuple in Clichy (1935-39), entworfen von Marcel Lods und Eugène Beaudouin, gilt als eines der frühen Projekte, an denen er massgeblich beteiligt war: Dach, Wände und Raumaufteilung lassen sich je nach Nutzung verändern; das Gebäude kann als offener Marktplatz, aber auch als geschlossener Veranstaltungssaal dienen. Eine schuppenartige Struktur aus verschiebbaren und aufklappbaren Fenstern und Läden realisierte Prouvé 1953 für Lionel Mirabeaus Haus am Square Mozart in Paris. Er entwickelte die Fassaden für Oscar Niemeyers Sitz der Kommunistischen Partei Frankreichs (1970) und war am Bau der Freien Universität Berlin von Candilis, Josic und Woods (1973) beteiligt. Beratend wirkte er überdies mit an Le Corbusiers Unité d'Habitation in Marseille, wenn sich auch sein Part bei der Ausführung relativ bescheiden ausnahm.
Die Möbel, die seit 1929 entstanden, bestätigen den eigenständigen Rang des Entwerfers Prouvé. Auch in diesem Sektor interessierte ihn nicht so sehr das Ausloten neuer Formen mit Hilfe neuer Werkstoffe, wie es zum Beispiel das Schaffen der Eames charakterisierte, sondern die Suche nach einer Konstruktionsidee, die sich adäquat mit der Maschine herstellen liess. Prouvés Möbel sind Architekturen im Kleinen, bei denen der Fertigungsprozess stets erkennbar bleibt. Die Sprödheit und Rauheit, die manche Arbeiten prägt, setzt sich von einer geschmäcklerischen Verfeinerung ebenso ab wie von der hypertrophen Inszenierung des Technischen. Auch wenn die nach dem Zweiten Weltkrieg industriell etablierten «Ateliers Jean Prouvé» im lothringischen Maxéville der Logik der Maschine entsprachen, blieb Prouvé im Grunde seines Herzens ein Handwerker, der zur Poesie der Technik fand. Es ist aufschlussreich, dass er kein einziges Möbelstück mehr entwarf, nachdem die Kapitalgeber 1953 seine Firma übernommen hatten: Der «homme d'usine» war ohne die unmittelbare praktische Erprobung weder willens noch fähig, neue Entwürfe umzusetzen.
Umfassende Retrospektive
Die Frankfurter Ausstellung, die von einer exzellenten, von Bruno Reichlin und Catherine Dumont d'Ayot betreuten Publikation begleitet wird, gibt einen anschaulichen Überblick über das Lebenswerk des Franzosen; gewürdigt werden anhand zahlreicher Modelle, Zeichnungen, Fotos und Originalexponate sein Schaffen auf den Gebieten von Design und Architektur, aber auch seine Lehrtätigkeit am Pariser Conservatoire des arts et métiers. Ausgehend von seinem Denken in Systemen, in Verfahren, in Analogien, in Synergien und in Kräften, gliedern die Ausstellungsmacher Prouvés technischen Kosmos. Dabei dienen die unterschiedlichen Konstruktionstypen, die Prouvé zum Teil selbst in seinem «Alphabet der Systeme» vorgestellt hatte, als roter Faden der Schau. Bestes Beispiel für die Anwendung der asymmetrischen, auf einem Gelenk aufruhenden und sich in zwei Arme verzweigenden tragenden «Krücken» ist die 1957 vollendete Trinkhalle von Evian am Genfersee.
Zu den in der Schau präsentierten Originalen zählen diverse Fassadenelemente, die Prouvé als Sandwich-Blechpaneele konstruierte, daneben Teile präfabrizierter Häuser, mit denen er sich während des Zweiten Weltkriegs zu beschäftigen begonnen hatte. Sein eigenes Haus in Nancy (1954) stellt die Assemblage von Elementen dar, die zuvor in seiner Firma produziert worden waren. Eine grosse Zahl von Möbeln macht deutlich, wie nahe sich Architektur und Design im uvre des Konstrukteurs kamen. Prouvé experimentierte mit verschiedenen Materialien, doch die eigentliche Meisterschaft erzielte er mit abgekantetem, gefalztem und gestanztem Blech. Anders als manche seiner Berufskollegen widmete er sich besonders dem Thema Tisch - «Guéridon», «Granito» oder «Trapèze» zählen zu den Design-Ikonen des 20. Jahrhunderts: desgleichen das aus u-förmigen Metallstützen und Brettern bestehende Regalsystem der Maison de la Tunisie in Paris, an dem Charlotte Perriand und die junge Schweizer Designerin Martha Villiger ebenfalls ihren Anteil hatten. Wie sehr Prouvé die heutige Generation junger Designer inspirieren kann, vermögen nicht zuletzt das modulare Regalsystem der Bouroullec-Brüder und die Metalltische von Konstantin Grcic zu beweisen.
[ Bis 23. Juli im Deutschen Architektur-Museum Frankfurt; vom 23. September bis Ende März 2007 im Vitra Design Museum in Weil am Rhein. Begleitpublikation: Jean Prouvé. Die Poetik des technischen Objekts. Hrsg. Alexander von Vegesack. Vitra Design Museum, Weil am Rhein 2006. 392 S., Euro 79.90. ]
Kultureller Triangulationspunkt
Herzog & de Meuron planen das Auditorium du Jura
Ein von Herzog & de Meuron entworfenes Konzerthaus bei Courgenay könnte zu einem kulturellen Kristallisationspunkt im Jura werden. Das Gebäude soll für das «Festival du Jura» genutzt werden, ist aber auch eine Hommage an den verstorbenen Künstler Rémy Zaugg.
Kurz nach der Gründung des jüngsten Schweizer Kantons etablierte der Dirigent Georges Zaugg 1977 das «Festival du Jura». Nach anfänglichen finanziellen Schwierigkeiten hat sich das Festival der klassischen Musik konsolidiert und findet nun im Turnus von zwei Jahren statt. Dem Renommee, das sich die Veranstaltungen erworben haben, stehen allerdings die problematischen räumlichen Bedingungen entgegen, mit denen sich die Organisatoren seit Beginn konfrontiert sehen. Genutzt werden Säle und Kirchen in verschiedenen Orten, doch keiner der Räume gilt in akustischer Hinsicht als zufriedenstellend. Überdies fehlt es an der Infrastruktur, die ein Musikfestival heute benötigt - ob Künstlergarderoben, Lagerräume oder Gastronomie.
Hommage an Rémy Zaugg
Gemäss den Vorstellungen - oder Visionen - der Festivalmacher könnte sich diese Situation in naher Zukunft ändern. Seit geraumer Zeit verfolgt Georges Zaugg, bis heute der künstlerische Leiter des Festivals, die Idee eines eigenen Konzerthauses. Gemeinsam mit seinem Bruder, dem im vergangenen August verstorbenen Künstler Rémy Zaugg, begab er sich auf die Suche nach einem möglichen Standort. Fündig wurde man südöstlich von Courgenay, dem Geburtsort der beiden Brüder. Der avisierte Bauplatz liegt im Weideland oberhalb der Ortschaft. Nach Süden hin bilden die bewaldeten Jurahöhen, die steil zum Doubs abfallen, die landschaftliche Kulisse; nach Norden schweift der Blick über die nur leicht wellige Ebene bis hinein nach Frankreich.
Durch die Vermittlung von Rémy Zaugg wurden Herzog & de Meuron mit dem Entwurf des Auditorium du Jura betraut. Die Basler Architekten haben immer wieder mit Künstlern zusammengearbeitet, doch mit keinem gab es eine so intensive Kooperation wie mit Rémy Zaugg, dessen Vortrag «Le Musée des Beaux-Arts auquel je rêve» von 1986 zur wichtigsten Inspirationsquelle für die reduktionistische Museumsarchitektur der neunziger Jahre avancierte. Die gemeinschaftliche Tätigkeit von Architekten und Künstler begann 1989, zunächst mit einem Masterplan für die Universität Dijon. Danach war Zaugg an der urbanistischen Studie «Basel, eine Stadt im Werden» beteiligt und gestaltete die Herzog-&-de- Meuron-Ausstellung 1995 im Centre Pompidou. Für das Roche-Laborgebäude in Basel entwickelte er eine Wandgestaltung, ausserdem war er an dem Münchener Projekt der «Fünf Höfe» beteiligt und liess sich sein eigenes Atelier in Mülhausen von den Baslern errichten.
Die Frage nach der Phänomenologie der Wahrnehmung war es, die Herzog & de Meuron mit Rémy Zaugg verband, und so ist das neue Auditorium nicht zuletzt auch eine Hommage an den früh verstorbenen Künstlerfreund. Von Zaugg selbst stammt die Skizze eines virtuellen, die schweizerisch-französische Grenze übergreifenden Dreiecks von Kunstorten: Ronchamp mit der Kapelle von Le Corbusier, Ornans, der Geburtsort von Courbet, und schliesslich Courgenay mit dem zukünftigen Auditorium du Jura. Der Gedanke des Dreiecks prägt nun auch den Entwurf von Herzog & de Meuron: Von Wald hinterfangen, scheint die dreiseitige Pyramide des Auditoriums am Hang oberhalb von Courtemautruy zu schweben. Angesichts der Silhouette kann man an einen kulturellen Triangulationspunkt denken, aber entfernt mag der Solitär im Weideland auch an eine grosse Scheune erinnern.
Komplexe Schichtung
Tritt man näher an das Bauwerk heran, so zeigt sich, dass die Form längst nicht so einfach ist, wie sie sich aus der Ferne darstellt. Das Innere besteht aus drei Teilen: einem schüsselartig in den Erdboden eingetieften Bereich für Orchester und Zuschauerparkett, einer ringsum verglasten Erdgeschosszone und einer grandiosen, sich darüberwölbenden Kuppel. Jacques Herzog verweist im Gespräch auf die hybride Schichtung dreier Typologien, nämlich des antiken Theaters, einer entmaterialisierten Stahl-Glas-Struktur à la Mies van der Rohe und einer expressionistisch-barocken Kuppel, wie sie Hans Poelzig mit der Tropfsteinhöhle des Grossen Schauspielhauses realisierte.
Konnten Herzog & de Meuron bei der amphitheatralischen Anordnung des Sockelbereichs auf Erfahrungen zurückgreifen, die sie bei der Planung der Elbphilharmonie in Hamburg gewonnen haben, so stellt die wie die Hohlform eines Tannzapfens in die dreiseitige Pyramide eingeschriebene und sich aus den Flächen herauswölbende, mit Holz ausgekleidete Kuppel eine Neuerung dar. Der Akustik wegen ist die Kuppel aus ondulierend verschliffenen Sechsecken aufgebaut, die gegeneinander versetzt sind, sich zunächst erweitern, dann nach oben hin verjüngen. In den konvex geführten Bereichen sind ringsum in fünf Ebenen übereinander kleine Zuschauertribünen eingelassen, so dass neben den 350 Besuchern auf Orchesterniveau weitere 350 Personen an den Aufführungen teilnehmen können. Kuppel-Innenraum und Parkett sind mit Holz ausgekleidet, nach dem derzeitigen Entwurfsstand könnte das Äussere, das ja eigentlich nur Dach ist, mit Schindeln gedeckt werden. Die Ecken der Pyramide sind als Foyers und Ausstellungsräume für Arbeiten von Rémy Zaugg konzipiert.
In dem eben erst der Öffentlichkeit vorgestellten Projekt des Auditorium du Jura ist es Herzog & de Meuron gelungen, Einfachheit und Komplexität zu verschmelzen. Aufgrund der verglasten Erdgeschosszone fliesst die Landschaft durch das Volumen hindurch; von einem Freiluftauditorium abgesehen, wird auf weitere bauliche Massnahmen in der Umgebung verzichtet. Zusatzräume, beispielsweise für das Catering, sind im Sockel versteckt, und die Parkplätze werden als Rasenflächen belassen.
Wie die letzte Architekturbiennale in Venedig aufgezeigt hat, zählen Konzertsäle derzeit zu den stark favorisierten Bauaufgaben, wenn es um das Branding von Städten und Regionen geht, und die nachhaltige Begeisterung, welche die von Herzog & de Meuron entworfene Elbphilharmonie in Hamburg ausgelöst hat, ist der beste praktische Beweis dafür. Ohne Zweifel besitzt das Auditorium bei Courgenay als erster neu errichteter öffentlicher Kulturbau seit Gründung des Kantons das Potenzial, die Identität der Region zu stärken. Es wäre das Signal eines kulturellen Aufbruchs in einer nicht eben finanzkräftigen Region. Dass Festspielhäuser nicht permanent genutzt werden müssen, zeigen Beispiele wie Bayreuth oder Glyndebourne. Finden sich bald die erhofften Geldgeber, könnte das Gebäude vielleicht schon in drei Jahren über der Juralandschaft schweben.
Neue Kathedralen der Kunst
Eine Ausstellung über Museumsarchitektur in Düsseldorf
Seit Jahrzehnten zählen Museen zu den prestigeträchtigsten Bauaufgaben überhaupt. Im Zeitalter des City-Branding haben politische Entscheidungsträger das Potenzial spektakulärer Kulturbauten entdeckt, und Sponsorengelder lassen sich leichter eintreiben, wenn der Name eines Stararchitekten auf den Plänen steht. So entstehen denn, auch wenn die öffentlichen Ausgaben für Kultur nicht wachsen, weiterhin allerorten neue Ausstellungsbauten - vom Kunstmuseum bis zum Science-Center.
Fragwürdige Auswahl
Von diesem Phänomen zeugt die Ausstellung «Museen im 21. Jahrhundert», die einen Überblick über derzeitige Museumsprojekte in aller Welt geben soll und zunächst in der Kunstsammlung K20 in Düsseldorf zu sehen ist, bevor sie auf Welttournee geschickt wird. Konzipiert und organisiert wurde die Schau vom privat betriebenen Art Centre Basel von Suzanne und Thierry Greub, das vor sechs Jahren bereits die Wanderausstellung «Museen für ein neues Jahrtausend» lanciert hatte. Am Konzept einer Überblicksschau Kritik zu üben, ist vergleichsweise leicht, weil wohl jeder zu einer anderen Auswahl käme. Doch die in Düsseldorf gezeigte Zusammenstellung ist schlicht unbefriedigend. Gewiss, es gibt Trouvaillen wie das sensibel in die Landschaft eingefügte Stonehenge-Besucherzentrum der Australier Denton Corker Marshall oder das kurz vor der Eröffnung stehende Aomori-Kunstmuseum von Jun Aoki. Auch findet man massstabsetzende Projekte der jüngsten Zeit wie das Eyebeam Institute in New York von Diller & Scofidio, das Museum Varusschlacht in Kalkriese von Gigon & Guyer oder das neue Akropolis-Museum in Athen von Bernard Tschumi.
Aber wer einen Querschnitt durch die zeitgenössische Museumsarchitektur anbietet und kein einziges Gebäude von Herzog & de Meuron ausstellt, macht sich schlicht lächerlich. Auch Rem Koolhaas, Peter Eisenman und Sanaa fehlen, während mediokre Bauten wie die Pinakothek der Moderne in München von Stephan Braunfels oder belanglose Projekte wie die Corcoran Gallery of Art in Washington von Frank Gehry berücksichtigt wurden. Mag sein, dass Eitelkeiten von Architekten für die eine oder andere Lücke verantwortlich sind. Doch in diesem Falle wären die Veranstalter besser beraten gewesen, auf die Schau zu verzichten - oder sie anders zu konzipieren. Denn selbstverständlich sind in Düsseldorf nur Pläne, Fotos und Modelle zu sehen, die von den Architekten zur Verfügung gestellt wurden. Eine kritische Reflexion ist nicht einmal in Ansätzen erkennbar. Warum renommierte Museen - ausgewiesen im informativen Katalog sind elf Stationen - sich eine derart misslungene Schau ins Haus holen, bleibt unerklärlich. Outsourcing ist offenkundig ein Gebot der Stunde, doch sollten die öffentlichen Institutionen dabei die Qualität einfordern, die auch für Eigenproduktionen gilt.
In eigener Sache
Ergänzt wird die Düsseldorfer Ausstellung durch die Präsentation der Entwürfe für die Erweiterung des eigenen Hauses. Der vor zwanzig Jahren am Grabbeplatz in Düsseldorf nach den Plänen der Kopenhagener Architekten Dissing & Weitling realisierte Museumsbau der Kunstsammlung K20 soll in den kommenden Jahren durch das gleiche Team erweitert werden - um einen rückwärtigen Anbau, dessen Fassadenverkleidung aus schwarzem Bornholmer Granit die Ästhetik des bestehenden Gebäudes aufgreift.
[ Bis 25. Juni, anschliessend in Rom, Linz, Lyon, Rovereto, Berlin usw. Katalog: Museen im 21. Jahrhundert. Ideen, Projekte, Bauten. Hrsg. Suzanne und Thierry Greub. Prestel-Verlag, München 2006. 215 S., Fr. 85.50 (Euro 28.- in der Ausstellung). ]
Von der Theorie zur Architektur
Leon Battista Alberti - Ausstellung im Palazzo Strozzi in Florenz
Leon Battista Alberti (1404-1472) war Kurienbeamter und Literat, Wissenschafter, Forscher und Archi- tekt. Eine Ausstellung widmet sich nun seiner Beziehung zu Florenz.
Es war Leon Battista Alberti, der als Erster das Renaissance-Ideal des «uomo universale» verkörperte. 1404 als unehelicher Sohn eines wohlhabenden Florentiner Kaufmanns in Genua geboren, studierte er in Venedig, Padua und Bologna, lebte anschliessend in Florenz und trat 1432 in den Dienst der päpstlichen Kurie. Jahre in Rom wechselten mit Aufenthalten in anderen Städten Italiens - Florenz vor allem, aber auch Rimini und später Mantua. Nachdem Alberti 1435 einen Traktat über Malerei verfasst hatte, widmete er sich in Rom dem Antikenstudium und zählte wie auch Andrea Mantegna, Fra Angelico oder Filarete zum Humanistenzirkel um Papst Nikolaus V. In Florenz war er mit Brunelleschi befreundet.
Alberti als Forschungsgegenstand
Seit Mitte des Jahrhunderts begann Alberti mit architektonischen Entwürfen, die in Florenz, Rimini und Mantua realisiert wurden. Auch wenn er sich vielen anderen Bereichen der Kunst, Wissenschaft und Literatur widmete, so entfaltete er doch die grösste Wirkung mit seiner Abhandlung über die Baukunst, dem 1485 postum herausgegebenen Architekturtraktat «De re aedificatoria». Obwohl ein Standardwerk der Architekturtheorie, hat Albertis Schrift gegenüber späteren Texten vergleichsweise wenig Niederschlag gefunden - wohl nicht zuletzt deshalb, weil ihr keine Illustrationen beigegeben waren.
Die Forschung über Alberti hat sich im Vorfeld von dessen 600. Geburtstag intensiviert. Zwischen 2002 und 2004 wurden in Mantua, Genua, Arezzo und Florenz insgesamt sechs Fachtagungen abgehalten; ihnen folgten im vergangenen Jahr zwei Ausstellungen. Diejenige in den Kapitolinischen Museen in Rom widmete sich Alberti und der Antikenrezeption im Rom des Quattrocento, diejenige in der Biblioteca Laurenziana von Florenz dem Thema Literatur und Humanismus. Eine grosse Schau im Florentiner Palazzo Strozzi trägt nun den Titel «Leon Battista Alberti e le arti a Firenze». Mit ihr finden die Alberti-Feiern ihren Abschluss. Das Problem, mit dem die Alberti-Forschung zu kämpfen hat, wird auch zu einem Problem bei der publikumswirksamen Vermittlung: Trotz einem umfangreichen literarischen uvre ist die Quellenlage hinsichtlich seiner sonstigen Tätigkeiten eher dürftig. Zwar definierte Alberti die Architektur, die höchste aller menschlichen Betätigungen, als Verbindung von «ratio» und «ars», von «ragione» und «bellezza» und damit als die ideale Verbindung von Theorie und Praxis. Realisieren indes liess er seine Bauten von anderen, und über die Autorschaft am Palazzo Rucellai in Florenz sind wir nur durch Vasaris Künstlerviten unterrichtet; ausgeführt wurde der Bau von Bernardo Rosselino.
Die Ausstellungsmacher müssen sich zwangsläufig mit der Skizzierung eines kulturhistorischen Panoramas begnügen, in dem Alberti bald mehr, bald weniger deutlich Konturen gewinnt. Die Schau gliedert sich in sieben Teile. Der erste ist der Familiengeschichte gewidmet, der zweite thematisiert das Florentiner Konzil von 1439, bei dem Vertreter der West- und der Ostkirche zusammenkamen. Nicht das verfehlte Ziel einer Wiedervereinigung der christlichen Kirche macht die Konferenz aus heutiger Sicht interessant, sondern ein Nebenprodukt des Gipfeltreffens: die neue Wertschätzung von Zeugnissen der altgriechischen Klassik.
Das eigentliche Zentrum der Schau bildet der dritte, um die Rucellai und die Medici kreisende Teil. Neben Sigismondo Malatesta aus Rimini, der Alberti mit dem Umbau einer Kirchenruine zu einem Monument der Familiendynastie betraute, war es der reiche Kaufmann Giovanni Rucellai, welcher den Universalgelehrten gegen Mitte des 15. Jahrhunderts zum entwerfenden Architekten werden liess. Zunächst betraute er ihn mit dem Bau seines Palazzo, der mit der vorgeblendeten Pilastergliederung eine Revolution im Florentiner Palastbau darstellte: Tektonische Strenge und formale Eleganz vereinen sich in einem Bau, der gemäss Albertis Vorstellungen nicht nur als Monument von der Macht des Bauherrn zeugen, sondern sich in eine urbane Struktur einfügen soll. 1470 war laut Inschrift die zweite stadtbildprägende Intervention fertig gestellt: die Fassade von Santa Maria Novella.
Ohne den romanischen Inkrustationsstil von San Miniato al Monte ist Albertis Konzept ebenso wenig zu verstehen wie ohne Brunelleschis luzide Frührenaissance-Bauten mit ihren Kontrasten von weissen Flächen und grauen Gliederungselementen. Und doch gelang Alberti etwas, was ihn von seinem grossen Vorgänger unterscheidet: eine flächig-ornamentale Interpretation antikisierender Motive. Es ist kein Wunder, dass Alberti um 1900 erneut auf Interesse stiess, als man in Wien das Verhältnis von Tektonik und Dekoration der Fassaden diskutierte: Die wunderbaren Aquarelle, die Josef Frank von Santa Maria Novella und anderen Bauten Albertis für seine 1910 vorgelegte Dissertation anfertigte, sind nun erstmals in Italien zu sehen.
Kulturhistorisches Panorama
Auch das intimste Projekt Albertis, das Heilige Grab in der Rucellai-Kapelle von San Pancrazio, wurde von Josef Frank gezeichnet. Wie ein Modell wirkt das kleine Bauwerk, das mit der Hochzeit von Giovanni Rucellais Sohn Bernardo und Nannina, der Nichte von Cosimo de' Medici, in Verbindung gebracht wird (1466). Der Ehevertrag festigte die Verflechtung beider Familien, aber auch die Rolle Albertis. Lorenzo de' Medici sorgte nach dessen Tod 1472 dafür, dass der Architekturtraktat in Druck ging. Aufgrund neuerer Forschungen wird die Medici-Villa in Fiesole, bisher Michelozzo zugeschrieben, näher an Alberti herangerückt. Unbestritten ist, dass dieser mit seiner Konzeption einer Villa suburbana und der sie umgebenden Terrassengärten den Villenbau der Toskana stark beeinflusste. Das gilt besonders für die Villa von Poggio a Caiano, die Giuliano da Sangallo für Lorenzo il Magnifico plante.
Im vierten, der Stadt und dem Territorium gewidmeten Teil der Schau wird mit Hilfe von Projektionen unter anderem die Kuppel der Kirche Santissima Annunziata thematisiert, bei welcher Alberti auf die Konstruktion antiker Zentralbauten zurückgriff. Den Traktaten Albertis und ihrer unmittelbaren Wirkung sind die beiden folgenden Abteilungen gewidmet. Greifbar wird das unter anderem am Sujet der «Verleumdung des Apelles», eines von Lukian beschriebenen Gemäldes, das Alberti in seiner Schrift «De Pictura» den Künstlern zur Nachahmung empfahl. Botticellis «Allegoria della Calumnia» (um 1495) gilt als die bedeutendste Umsetzung des Themas. Das Wort «misura» ist einer der Kernbegriffe von Alberti, er steht für die Schönheit auf Basis harmonischer Proportionen und findet seinen Niederschlag in den zentralperspektivischen Darstellungen von Raumsituationen. - Den Abschluss der Ausstellung bildet die «Città ideale» aus Urbino, die wohl berühmteste Darstellung eines Stadtideals der italienischen Renaissance. Seitlich eines zentralen Rundbaus staffeln sich Palazzi entlang zweier Strassenfluchten in die Tiefe - die Interpretation des Bildinhalts ist umstritten. Gabriele Morolli sieht nach jüngsten Röntgenuntersuchungen seine These bestätigt, dass es sich um eine fiktive Darstellung der unter Papst Nikolaus V. postulierten Wiedererrichtung des antiken Rom handle. Gleichwohl ist es wagemutig, anhand der nunmehr entdeckten Vorzeichnungen eine - zumindest indirekte - Autorschaft Albertis zu reklamieren.
[ Bis zum 23. Juli im Palazzo Strozzi. Katalog: L'uomo del rinascimento. Leon Battista Alberti e le arti a Firenze tra ragione e bellezza. Hrsg. Cristina Acidini und Gabriele Morolli. Mandragora Maschietto Editore, Florenz 2006. 480 S., Euro 35.-. ]
Der Herzschlag von Doetinchem
Hohler Zahn oder Hähnchenschenkel? - Der „D-toren“ setzt sich aus schalenförmigen Elementen aus glasfaserverstärktem
Epoxidharz zusammen. Heute rot, dann wieder grün, blau oder gelb leuchtet er vor sich hin und setzt in der kleinen niederländischen Gemeinde Doetinchem ein auffälliges Zeichen.
Streugut sei die Kunst im öffentlichen Raum, so formulierte man es 1995 in Doetinchem. Doetinchem, das ist eine kleine Stadt in der niederländischen Provinz Gelderland. Nicht weit von der deutschen Grenze entfernt, die längst nur noch dadurch zu bemerken ist, dass nicht mehr gelbe Schilder den Ortsbeginn markieren, sondern blaue. Doetinchem: gut zehn Kilometer nördlich von Emmerich, gut zwanzig Kilometer nordwestlich von Bocholt, ein Ort, der für alle Reisenden einen Umweg bedeutet. Und der selbst kaum etwas zu bieten hat, was Besucher anziehen könnte.
Dass dies nicht mehr zutrifft, hat mit der Initiative von 1995 zu tun. Damals nahm sich die lokale Kommission für bildende Kunst der Kunst im öffentlichen Raum an und empfahl der Stadtregierung einen dringenden Kurswechsel: Anstatt irgendwelche Figuren in irgendwelchen Fußgängerzonen oder auf irgendwelchen Plätzen abzustellen, solle man die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel bündeln und ein prägnantes Konzept für Kunstinstallationen in der Stadt entwickeln. Das Konzept wurde gleich mitgeliefert und heißt „Torenplan“. Dieser „Turmplan“ fixiert fünf Standorte am Innenstadtring, der der einstigen Stadtbefestigung folgt; fünf Standorte, an denen zukünftig markante Kunstwerke errichtet werden, die nicht zuletzt der Imagebildung der Stadt dienen sollen. Dabei handelt es sich nicht um ein kurzfristiges Projekt, sondern um eine langfristige Strategie. Der Zeithorizont beträgt mehrere Jahrzehnte und tatsächlich wurde der erste der „Türme“ auch erst 2004 eingeweiht.
„D-toren“ heißt er, und das D steht nicht, wie man zunächst denken könnte, für Doetinchem, sondern einfach für den Buchstaben D, der auf A, B und C folgt. Auch wenn an vier der projektierten Positionen früher Stadttürme standen und das Projekt sich „torenplan“ nennt, wie ein Turm müssen die „toren“ nicht aussehen, aber sie sollen auffällig sein. Jedem der fünf „toren“ ist ein Motto zugewiesen - die vier Elemente, darüber hinaus die Zeit. Feuer, das war die Vorgabe für den D-toren, mit dessen Konzeption der Rotterdamer Künstler Q.S. Serafijn beauftragt wurde. Serafijn, 1960 im niederländischen Rosendaal geboren, entwickelte die Idee eines interaktiven Kunstwerks, das sich von der üblichen Kunst im öffentlichen Raum unterscheidet. Basierend auf der seit Beuys geläufigen Idee einer Sozialen Plastik besteht seine Idee darin, die Befindlichkeit der Bewohner von Doetinchem zu analysieren. Serafijn entwickelte einen Fragebogen mit 360 Fragen, der um die Empfindungen von Liebe, Glück, Angst und Hass kreist. Fünfzig Freiwillige erhalten alle zwei Tage per E-Mail jeweils vier Fragen, die sie ebenfalls per E-Mail beantworten; nach einem Durchlauf, der mithin ein halbes Jahr dauert, wechseln die Teilnehmer, die Sequenz beginnt aufs Neue.
Das von Serafijn erdachte Konzept ließe sich problemlos im virtuellen Raum abwickeln: Die Umfrageteilnehmer geben ihre Antworten passwortgesichert auf der website www.d-toren.nl ein, die interessierte Öffentlichkeit erfährt die Ergebnisse im frei zugänglichen Bereich. Um die physische Präsenz des Projekts im Stadtraum zu gewährleisten, zog der Künstler Lars Spuybroek vom Rotterdamer Architekturbüro Nox hinzu. Spuybroek entwarf eine bizarre, organisch geformte Plastik, die leuchtend jeweils am Abend über die mehrheitliche emotionale Dispositon der Teilnehmenden informiert. Rot steht für Liebe, Blau für Glück, Gelb für Angst, Grün für Hass.
Das knapp zwölf Meter hohe und gut sechs Meter breite Objekt steht im Nordwesten der Innenstadt, dort, wo die Gruutstraat auf die viel befahrene Tangente N 316 trifft. Drei röhrenartige Stelzen - eine davon spaltet sich in zwei - tragen einen amorphen, hinsichtlich seiner Form kaum plausibel zu beschreibenden Hohlkörper. In Zeiten der Vogelgrippe mag man an eine Mutation aus drei miteinander verschmolzenen Hähnchenschenkeln denken oder an einen Zahn mit Wurzeln. Die biologischen Assoziationen sind zumindest nicht völlig abwegig, denn Lars Spuybroek beruft sich als Vergleich auf den Animationsfilm eines pulsierenden Herzens. An Seilen abgehängt, wie es schon Gaudí praktiziert hatte, wurde eine Kugel partiell bandagiert und fixiert - und dann weiter aufgeblasen und somit deformiert. Resultat der digitalen Umsetzung waren Negativformen, die mit einer CNC-Fräse aus Polystyrolblöcken herausgeschnitten wurden. Die Kombination von Standard- und Nicht-Standard-Geometrien erlaubte es, die insgesamt benötigten 19 Teile des D-toren mit sieben Formen zu erstellen. Auf diese Modelle wurden von Hand ein Laminat aus Glasfaser (zur Stabilisierung) und Epoxidharz aufgetragen; dem Harz war zuvor ein Anteil von vier Prozent weißer Farbe beigegeben worden, um Körperhaftigkeit und Leuchtkraft zu unterstützen. Je nach den physikalisch wirksamen Kräften variiert dabei die Stärke der Wandung.
Stege erlaubten es, die einzelnen Elemente ohne weitere Verbindungen zu verkleben. In zwei Teilen vorgefertigt, wurde der D-toren schließlich Ende Juni 2004 vor Ort montiert. Tagsüber milchig-weiss, leuchtet er, erhellt von LEDs, seit dem Beginn des Kunstprojekts Anfang September 2004, in der jeweiligen Farbe des Tages. Ein Alien im städtischen Raum, der sich aber auch nachts von der Lichtorgie aus Scheinwerfern, Ampeln und Neonreklame abzuheben weiß. Folgt man der bisherigen Statistik, sieht es wie folgt aus: 5 Prozent Gelb, 15 Prozent Grün und jeweils 40 Prozent Blau und Rot. Könnte ein besseres Argument für den Umweg nach Doetinchem geben?
Präriehäuser in Marsch und Geest
Wright und die Niederlande - eine Ausstellung in Hilversum
Seit 1911 standen niederländische Architekten im Banne Frank Lloyd Wrights. Nirgendwo sonst hatte der amerikanische Baumeister einen so starken Einfluss wie zwischen Rhein und Nordsee. Eine Ausstellung in Hilversum dokumentiert die Rezeption in all ihren Facetten.
Ein grossformatiges Portfolio und eine handliche Publikation der Bauten von Frank Lloyd Wright, die der Berliner Verlag Ernst Wasmuth in den Jahren 1910 und 1911 herausbrachte, lösten in europäischen Architektenkreisen nachhaltige Begeisterung aus. Zwar hatte der Engländer Charles Robert Ashbee seinen amerikanischen Kollegen schon 1901 besucht, doch blieben Wrights Bauten diesseits des Atlantiks vorerst weitgehend unbekannt. Doch seit dem Erscheinen der Wasmuth-Publikation, zu der Ashbee ein Vorwort beigesteuert hatte, galten sie als Offenbarung: in Deutschland, wo sie Peter Behrens, Walter Gropius und Mies van der Rohe faszinierten, vor allem aber in den Niederlanden. Hendrik Petrus Berlage, der Wegbereiter der niederländischen Architektur des 20. Jahrhunderts, reiste damals in die Vereinigten Staaten; er versäumte Wright, der sich gerade in Berlin aufhielt, besuchte aber eine Reihe von seinen Bauten. Frucht seines Aufenthalts waren eine Reihe von Vorträgen und Veröffentlichungen, welche Frank Lloyd Wrights Bekanntheit in den Niederlanden weiter steigerten.
Publikationen und Adaptionen
Schnell wurden die Bauten des Amerikaners in den Niederlanden zitiert, kopiert und adaptiert. Die Breite und Vielfalt der Rezeption wurde nicht zuletzt dadurch begünstigt, dass das Land im Ersten Weltkrieg neutral blieb und das Bauwesen - anders als in den kriegführenden Ländern - eine regelrechte Blüte erlebte. Landhäuser in den Heide- und Dünengebieten entstanden nach dem Vorbild der Präriehäuser, die aufgrund der Verwendung von Backstein, der luxuriösen Innenausstattung und der Verzahnung von Architektur und Landschaft ein favorisiertes Vorbild darstellten. In Berkel-Enschot baute der Architekt F. A. Warners das Robie House nach, und zu den bekanntesten Adaptionen zählen zwei Villen des ebenfalls in die USA gereisten Robert van't Hoff in der Ortschaft Huis ter Heide: das Haus Verloop mit seinen typischen, breit gelagerten Dächern (1915) und die symmetrische, flachgedeckte Villa Nora (1916), die an das Thomas Gale House (1909) in Oak Park und das Bach House in Chicago (1915) erinnert.
«Dromen van Amerika - Nederlandse Architecten en Frank Lloyd Wright» heisst die reich bestückte Ausstellung, mit der im Museum Hilversum die Beziehungen zwischen dem Amerikaner und seinen niederländischen Bewunderern nachgezeichnet wird. Eine Chronologie von Leben und Werk Wrights an den Wänden bildet den Hintergrund, vor dem auf Podesten und in Tischvitrinen Dokumente der Rezeption ausgebreitet sind. Die Kenntnis des uvres wurde besonders durch Hendrik Theo Wijdeveld gefördert, der als Herausgeber der Zeitschrift «Wendingen» 1921 Kontakt mit Wright aufnahm. Das Novemberheft 1921 wurde diesem gewidmet, eine Doppelnummer im Jahr 1923 - und schliesslich die berühmte Sequenz von sieben aufeinander folgenden «Wendingen»-Heften im Jahr 1925. Es war wiederum Wijdeveld, der 1931 die erste europäische Ausstellung Wrights an das Stedelijk Museum Amsterdam vermittelte; für eine zweite Schau am gleichen Ort zeichnete 1952 J. J. Oud verantwortlich. Als einziger Entwurf Wrights, der in den Niederlanden umgesetzt wurde, gilt eine grüne Pressglasvase für die Königliche Glasmanufaktur Leerdam - in der Ausstellung sind auch zwei nicht realisierte Prototypen zu sehen.
Zur romantisch grundierten Rezeption des Wright der Präriehäuser trat schon in den ersten Jahren eine eher rationale Aneignung. So übernahm K. P. C. de Bazel die offene, von Pfeilern gegliederte Bürostruktur des auch von Berlage bewunderten Larkin Building für das Gebäude der Nederlandse Heidemaatschappij in Arnheim (1912). Rechtwinklige Volumina, vor- und zurückspringende Flächen sowie die Betonung horizontaler und vertikaler Elemente bestimmten die Entwürfe vieler Architekten in den zehner und zwanziger Jahren, vor allem jene der Stijl-Gruppe. In den Bauten von Jan Wils, etwa in dem Café De Dubbele Sleutel (1918/19) in Woerden, wird die Wright-Nachfolge besonders deutlich; purifizierter zeigen sich neoplastizistische Kompositionen wie die Villa Sevensteijn (1920) von Dudok und Wouda oder der nicht realisierte, an die Midway Gardens in Chicago angelehnte Entwurf für eine Schule in Scheveningen von Jan Duiker (1921-28).
Gescheiterte Visionen
Persönlich kamen Wijdeveld und Wright 1931 in Taliesin in Kontakt. Beide trugen sich mit der Idee einer künstlerischen Werkgemeinschaft, und Wijdeveld war als Direktor der Hillside Home School of Applied Arts and Industries vorgesehen. Doch die Idee einer Zusammenarbeit zerschlug sich; Wright gründet 1932 die Taliesin Fellowship, Wijdeveld plant, sein kulturelles Zentrum gemeinsam mit Mendelsohn und Ozenfant in Südfrankreich zu realisieren. Ein Waldbrand auf dem avisierten Terrain zwingt Wijdeveld zurück in die Niederlande, bevor das Projekt angelaufen ist; ein zweiter Versuch in Elckerlyc bei Hilversum scheitert wegen der deutschen Besatzung 1940. Ohne Erfolg bleibt 1950 auch der Versuch, Elckerlyc als Kooperation mit Taliesin durch Unesco-Mittel zu finanzieren.
Mit dem Siegeszug der internationalen Moderne nach dem Zweiten Weltkrieg liess die Orientierung an Frank Lloyd Wright auch in den Niederlanden nach. Eine gewisse Verbindung bestand hinsichtlich des Umgangs mit Innen- und Aussenräumen bei den Strukturalisten Hertzberger, Blom und van Eyck; und Hugh Maaskant realisierte in Mijdrecht eine Filiale der Firma Johnson Wax, deren berühmter Hauptsitz in Racine (Wisconsin) von Wright stammte. Die Ausstellung klingt aus mit einem Hinweis auf die «Superdutch»-Architektur von OMA, MVRDV oder UN-Studio: Die heutigen Architekten, so die These, bezögen sich hinsichtlich ihrer internationalen Wirkung und ihres Star-Status auf den Amerikaner, der schon mit dem durch King Vidor verfilmten Roman «The Fountainhead» zum Rollenmodell des modernen Architekten avanciert war.
Wright in Amsterdams Arkadien
Anschliessend an einen Besuch der Ausstellung empfiehlt sich eine Fahrradfahrt durch das inmitten von Heidelandschaften gelegene Hilversum. Mit weitläufigen Villengebieten wurde das einstige Dorf im 19. Jahrhundert zum Arkadien von Amsterdam. Von der Wright-Rezeption vor Ort zeugen Villen von Jan Wils (1929) am Simon-Stevin-Weg, aber auch die bemerkenswerte Emma- Apotheke (1921) von Rueters und Symons. Wie kein anderer Architekt aber hat Dudok das Stadtbild von Hilversum geprägt - vor allem mit dem Rathaus und zahlreichen Schulgebäuden. In vielen seiner Bauten ist der Einfluss Wrights offensichtlich, auch wenn Dudok diesen zeitlebens verneint hat.
[ Bis zum 4. Juni im Museum Hilversum. Begleitbroschüre Euro 7.50. ]
Die Architektur übt den Widerstand
Zum 70. Geburtstag von Aurelio Galfetti
Sie wurde zum Fanal der neuen Tessiner Architektur: die Villa Rotalinti, ein Sichtbetonhaus, das Aurelio Galfetti in den Jahren 1960/61 als junger Absolvent der ETH Zürich am Hang oberhalb von Bellinzona errichtete. Das orthogonale Volumen dieses Bauwerks, das durch Öffnungen und Durchbrüche sein Inneres offenbart und wie ausgehöhlt erscheint, war einerseits eine Auseinandersetzung mit den plastischen Entwurfsprinzipien Le Corbusiers, die dem angehenden Architekten durch seinen Zürcher Lehrer Paul Waltenspühl vermittelt worden waren. Andererseits ist es ein frühes Beispiel für eine Architektur des Widerstands im Tessin - also für den Versuch, den die Hänge überziehenden Luxusvillen und Pseudo-Rustici architektonische Qualität entgegenzusetzen. Kurz darauf begannen auch andere Architekten, das Bauen im südlichsten Kanton der Schweiz zu erneuern: die etwas älteren Kollegen Tita Carloni, Luigi Snozzi und Livio Vacchini, dann auch der jüngere Mario Botta. Gemeinsam mit Ivo Trümpy und Flora Ruchat realisierte Galfetti 1967-1970 das überzeugend in die Umgebung eingefügte Freibad in Bellinzona, dessen einzelne Teile von einer brückenartigen, das Tal des Ticino überspannenden Passerelle erschlossen werden.
An die Öffentlichkeit traten die aufbegehrenden Tessiner 1970 mit einem Gemeinschaftsentwurf für die ETH Lausanne. Die legendäre Tendenza-Ausstellung von 1975 in Zürich trug ungewollt dazu bei, den Eindruck zu verstärken, es habe sich eine Gruppe etabliert. Tatsächlich verfolgten die Architekten durchaus unterschiedliche Haltungen. Galfettis Inspirationsquelle ist die klassische Moderne - was sich auch in einem seiner jüngsten Projekte zeigt, der mit ihren mächtigen Stahlträgern an Mies van der Rohe erinnernden Aula Magna der neuen Universität Lugano. (Deren Masterplan entwickelte Galfetti 1998 gemeinsam mit Jachen Könz. Zugleich überzeugte er die Behörden, die einzelnen Bauprojekte jungen Tessiner Büros anzuvertrauen.) Zu Galfettis herausragenden Bauten der achtziger Jahre gehören drei Mehrfamilienhäuser sowie die Hauptpost in Bellinzona, doch das Projekt, das ihm die grösste Bekanntheit eintrug, ist der Umbau des dortigen Castelgrande. Zwischen 1981 und 1991 entstanden ein Erschliessungssystem sowie eine Reihe neu gestalteter Räume innerhalb der Festung. Dabei wahren Galfettis Betonstrukturen auf vorbildliche Weise die Balance zwischen Autonomie und Integration in den Bestand. Seit Beginn der neunziger Jahre hat sich der Architekt verstärkt mit raumplanerischen Projekten auseinander gesetzt; so ist er beispielsweise am Projekt der neuen Eisenbahn-Alpentransversale (Neat) beteiligt. An diesem Sonntag nun kann Aurelio Galfetti in Lugano seinen siebzigsten Geburtstag feiern.
Leuchttürme für Graubünden
Eine Architekturausstellung im Gelben Haus Flims
Mit Peter Zumthors Therme in Vals ist einer der kulturell, architektonisch und touristisch attraktivsten Orte in Graubünden entstanden. «Werdende Wahrzeichen» heisst jetzt eine Ausstellung im Gelben Haus Flims, die zwanzig aktuelle Bau- und Kunstprojekte im Kanton anhand von Modellen und Plänen präsentiert; Projekte, welche als Leuchttürme Ausstrahlungskraft auch über die Region hinaus besitzen könnten. Das zweifelsohne umstrittenste ist die Porta Alpina bei Sedrun, also die Idee, den 800 Meter tiefen Versorgungsschacht der Neat-Baustelle als Erschliessung eines spektakulären Tunnelbahnhofs für die Surselva nachzunutzen.
Zu Kontroversen haben auch einige der anderen Konzepte Anlass gegeben - so der grandiose Plan von Herzog & de Meuron, das Hotel Schatzalp oberhalb von Davos mit einem 105 Meter hohen Turmhaus zu erweitern. Oder die Vision der österreichischen Künstlerin Brigitte Kowanz, einen Hang am Ortseingang von Flims mit Leuchtdioden und Glasperlen als künstliches «Bergfeuer» zu gestalten; das Projekt, das nur einen minimalen Kostenaufwand bedeutet hätte, wurde gerade erst von der Gemeindeversammlung mehrheitlich abgelehnt. - Andere Vorhaben sind auf besserem Weg. Dazu zählen der Umbau des Zeughauses in Bergün zum Museum für die Albulabahn, aber auch das von Valerio Olgiati entworfene Nationalpark-Zentrum in Zernez, dessen Bau nach einiger Verzögerung im Frühjahr beginnen wird. Neben vorbildlichen Tourismusarchitekturen wie der Erweiterung des Hotels Tschuggen in Arosa durch Mario Botta oder dem Entwurf von Miller und Maranta für ein Bad in Samedan überzeugen in der Ausstellung besonders die Projekte, die sich eher unspektakulär in die bestehenden Strukturen einfügen. Dazu zählen das Konzept eines dezentralen, auf verschiedene Engadinerhäuser verteilten Hotels in Vnà, aber auch die Massnahmen des Vereins Kulturraum Viamala, die berühmte Schlucht für Fussgänger erlebbar zu machen.
[ Bis 23. April. Zur Ausstellung liegt ein Sonderheft der Zeitschrift Hochparterre vor, Fr. 10.-. ]