Artikel
Alles unter einem Dach
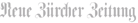
Bernard Tschumis Manufaktur für den Genfer Uhrenhersteller Vacheron Constantin
2. September 2005 - Hubertus Adam
Plan-les-Ouates, an der südwestlichen Peripherie von Genf gelegen, hat seinen ruralen Charakter längst abgelegt. Auf dem Gebiet der Gemeinde ist in den letzten Jahren ein ausgedehntes Gewerbegebiet entstanden, das von der Nähe zur Metropole ebenso profitiert wie von der - aufgrund der Pendlerströme wichtigen - Nähe zu Frankreich. Ausgezeichnet sind die Verkehrsverbindungen: Die Autobahn tangiert das Areal, und der Flughafen ist nur wenige Minuten entfernt. Gleichwohl, wer hier nicht arbeitete oder Geschäfte machen wollte, hatte bisher keinen Grund, das ästhetisch belanglose Gebiet aufzusuchen. Das ist anders geworden, seitdem mit dem Produktionsgebäude der Uhrenmanufaktur Vacheron Constantin ein vorbildlicher zeitgenössischer Industriebau entstanden ist.
Theorie und Praxis
Die Uhrenmanufaktur, die als älteste der Welt seit einem Vierteljahrtausend kontinuierlich produziert, feiert in diesem Jahr ihr Jubiläum: 1755 hatte Jean-Marc Vacheron seine eigene Werkstatt in Genf begründet; zu seinen Nachfahren gesellte sich später der erfolgreiche Verkäufer François Constantin. Inzwischen wie Cartier, IWC oder Jaeger-Le Coultre der internationalen Richemont- Gruppe zugehörig, stellt Vacheron Constantin jährlich rund 15 000 Uhren des Luxussegments im vier- bis sechsstelligen Frankenbereich her. Neben dem Stammsitz am innerstädtischen Quai de l'Ile, der fortan repräsentativen Zwecken vorbehalten bleibt und auch das firmeneigene Museum beherbergt, verteilten sich die verschiedenen Bereiche des Unternehmens bisher auf das Vallée de Joux im Jura sowie auf diverse Standorte in Genf. Mit dem Neubau in Plan-les-Ouates ergab sich nun die Möglichkeit, die verschiedenen Abteilungen zum Zwecke effizienterer Kommunikation zusammenzuführen. Administration, Marketing und Produktion sind erstmals in einem Gebäude versammelt, auch wenn die Fertigungswerkstätten im Jura erhalten bleiben.
Ausgehend von einem detaillierten Raumprogramm, veranstaltete Vacheron Constantin 2001 einen Wettbewerb für das neue Gebäude. In der zweiten Runde konnte sich Bernard Tschumi gegen die Konkurrenz von Gae Aulenti, Carlos Ferrater, Nicholas Grimshaw und John Pawson durchsetzen. 1944 in Lausanne geboren und an der ETH Zürich ausgebildet, zählt der in Paris und New York tätige Tschumi zu den wichtigsten zeitgenössischen Architekten. Und das in doppelter Hinsicht - als Entwerfer experimenteller Projekte, als deren bisher wichtigstes der Parc de la Villette in Paris (ab 1983) und das Medienzentrum «Le Fresnoy» im nordfranzösischen Tourcoing einzustufen (1997) sind, aber auch als einflussreicher Lehrer und Theoretiker. Bevor Tschumi infolge seines Siegs im Pariser La-Villette-Wettbewerb zur Praxis wechselte, sammelte er als Hochschullehrer Erfahrungen und veröffentlichte Publikationen wie «Manhattan Transcripts» (1981). Danach agierte Tschumi bis 2003 an der New Yorker Columbia University als Dekan der Graduate School of Planning and Preservation, eines der wichtigsten Zentren des internationalen Architekturdiskurses. Bedauerlicherweise war es dem international tätigen Architekten - abgesehen von der nur in Ansätzen realisierten Planung des Flon-Quartiers in Lausanne - bisher nicht vergönnt, in der Schweiz ein Werk zu realisieren, und die Hochschulen des Landes glauben es sich leisten zu können, eine Kapazität wie ihn beharrlich zu ignorieren.
Gewiss zählt der neue Sitz von Vacheron Constantin nicht zu den betont experimentellen Werken des Architekten. Hier handelt es sich aber auch nicht um ein zeitgenössisches Kulturzentrum oder einen postindustriellen Park wie in der Villette, sondern um eine Fabrikanlage, die aufgrund des hohen Grades an handwerklicher Fertigung als «Manufaktur» betitelt ist. Gemeinhin tut sich die im Luxussegment operierende Schweizer Uhrenindustrie schwer mit anspruchsvoller zeitgemässer Architektur. Während andere Branchen längst die Potenziale von Branding-Architektur erkannt haben, tickt der Uhrensektor anders: Solidität und Tradition bestimmen das Selbstverständnis. Dies macht es den Unternehmen schwer, zu einem der Gegenwart entsprechenden Ausdruck zu finden. Jean Nouvels Bauten für Cartier sind die löblichen Ausnahmen. Wer indes die schon bestehenden oder im Bau befindlichen Produktionsstätten in Plan-les-Ouates besucht, seien es die von Patek Philippe, Piaget oder Rolex, sieht sich mit Architektur konfrontiert, wie sie banaler nicht sein könnte.
Vorbildlicher Industriebau
Mit ihrem weithin sichtbaren Neubau ist der Marke mit dem Malteserkreuz-Logo nun ein Schritt nach vorn gelungen. Tschumi, der mit seiner Büropartnerin Véronique Descharrières zusammenarbeitete, entwarf ein elegantes, zeichenhaftes Gebäude, das seine Funktion auf perfekte Weise erfüllt. Als «eine zeitlose und dennoch zeitgenössische Form» bezeichnet er seinen Entwurf - und gibt damit die Antwort auf die Frage seiner Auftraggeber, wie sich Beständigkeit, Kontinuität und Innovation architektonisch umsetzen liessen. Eine Hülle aus Metall, so interpretiert man bei Vacheron Constantin den Neubau, stelle die Dynamik der Zeit dar, während das Tragwerk aus Beton die Beständigkeit verkörpere.
Der streng ostwestlich ausgerichtete Firmensitz besteht aus einem aufragenden Kopfbau, in dem Administration, Direktion und Marketingabteilung untergebracht sind, sowie dem sich westlich anschliessenden Flachbau für die Werkstätten. Beide Funktionsbereiche stehen aber nicht nebeneinander, sondern sind durch eine metallene Haut zu einem Volumen zusammengefasst. Eine Gitterstruktur aus rostfreiem Stahl bildet die Fassadenhaut oberhalb der verglasten Eingangsfront im Osten, zieht sich über das Dach des Verwaltungsbaus und krümmt sich in dessen Ostfassade, um anschliessend das Dach der Werkstätten zu bilden. In einem halbkreisförmigen Schwung wechselt das Band noch einmal seine Laufrichtung, um nach Fassade und Dach nun auch den Boden zu bilden: Der Baukörper schwebt hier über einem offenen Parkplatz. Dieser ist Teil eines rechtwinklig zum Fabrikgebäude geführten Landschaftsstreifens, dessen nördliche Rampe gärtnerisch gestaltet wurde, während die südliche als Zufahrt und Stellfläche dient.
Bringt der stählerne Überwurf, der die Assoziation eines Uhrarmbands erwecken mag, das über einer Grundfläche von 80 × 42 Metern errichtete Gebäude in Form, so sind die Richtung Norden und Süden orientierten Längsseiten vollständig verglast. Gebäude, die von bandartigen Strukturen umgeben werden und deren gläserne Fassaden wie Schnitte durch das Innere wirken, erfreuen sich in der jüngeren Zeit - ausgehend von niederländischen Vorbildern - grosser Beliebtheit; zu erinnern ist hier an das New Yorker Eyebeam-Projekt von Diller & Scofidio, vor allem aber an die Experimentelle Fabrik von Sauerbruch Hutton in Magdeburg, die in ihrer Kombination von Verwaltungstrakt und Halle eine deutliche Verwandtschaft zu Tschumis Genfer Projekt aufweist. Während das deutsch-englische Architektenteam indes auf eine grellbunte Farbigkeit setzt, zeigt sich Tschumi zurückhaltender und nutzt die Farben der Materialien. Zu dem Grau des Betons, dem Silber des Stahls und dem leichten Grün des Glases tritt im Inneren der Ton des Holzes, mit dem die Untersichten der silbrigen Bandstruktur verkleidet wurden. Trotz dem technoiden Charakter, der dem Gebäude zu eignen scheint, entsteht ein beinahe wohnlicher Eindruck. Die Verwaltungsgeschosse gruppieren sich um das quer gelagerte Atrium mit der vertikalen Erschliessung, die Arbeitsplätze im Werkstättentrakt um einen Patio in Längsrichtung des Baus, der auch das Parkdeck belichtet.
Theorie und Praxis
Die Uhrenmanufaktur, die als älteste der Welt seit einem Vierteljahrtausend kontinuierlich produziert, feiert in diesem Jahr ihr Jubiläum: 1755 hatte Jean-Marc Vacheron seine eigene Werkstatt in Genf begründet; zu seinen Nachfahren gesellte sich später der erfolgreiche Verkäufer François Constantin. Inzwischen wie Cartier, IWC oder Jaeger-Le Coultre der internationalen Richemont- Gruppe zugehörig, stellt Vacheron Constantin jährlich rund 15 000 Uhren des Luxussegments im vier- bis sechsstelligen Frankenbereich her. Neben dem Stammsitz am innerstädtischen Quai de l'Ile, der fortan repräsentativen Zwecken vorbehalten bleibt und auch das firmeneigene Museum beherbergt, verteilten sich die verschiedenen Bereiche des Unternehmens bisher auf das Vallée de Joux im Jura sowie auf diverse Standorte in Genf. Mit dem Neubau in Plan-les-Ouates ergab sich nun die Möglichkeit, die verschiedenen Abteilungen zum Zwecke effizienterer Kommunikation zusammenzuführen. Administration, Marketing und Produktion sind erstmals in einem Gebäude versammelt, auch wenn die Fertigungswerkstätten im Jura erhalten bleiben.
Ausgehend von einem detaillierten Raumprogramm, veranstaltete Vacheron Constantin 2001 einen Wettbewerb für das neue Gebäude. In der zweiten Runde konnte sich Bernard Tschumi gegen die Konkurrenz von Gae Aulenti, Carlos Ferrater, Nicholas Grimshaw und John Pawson durchsetzen. 1944 in Lausanne geboren und an der ETH Zürich ausgebildet, zählt der in Paris und New York tätige Tschumi zu den wichtigsten zeitgenössischen Architekten. Und das in doppelter Hinsicht - als Entwerfer experimenteller Projekte, als deren bisher wichtigstes der Parc de la Villette in Paris (ab 1983) und das Medienzentrum «Le Fresnoy» im nordfranzösischen Tourcoing einzustufen (1997) sind, aber auch als einflussreicher Lehrer und Theoretiker. Bevor Tschumi infolge seines Siegs im Pariser La-Villette-Wettbewerb zur Praxis wechselte, sammelte er als Hochschullehrer Erfahrungen und veröffentlichte Publikationen wie «Manhattan Transcripts» (1981). Danach agierte Tschumi bis 2003 an der New Yorker Columbia University als Dekan der Graduate School of Planning and Preservation, eines der wichtigsten Zentren des internationalen Architekturdiskurses. Bedauerlicherweise war es dem international tätigen Architekten - abgesehen von der nur in Ansätzen realisierten Planung des Flon-Quartiers in Lausanne - bisher nicht vergönnt, in der Schweiz ein Werk zu realisieren, und die Hochschulen des Landes glauben es sich leisten zu können, eine Kapazität wie ihn beharrlich zu ignorieren.
Gewiss zählt der neue Sitz von Vacheron Constantin nicht zu den betont experimentellen Werken des Architekten. Hier handelt es sich aber auch nicht um ein zeitgenössisches Kulturzentrum oder einen postindustriellen Park wie in der Villette, sondern um eine Fabrikanlage, die aufgrund des hohen Grades an handwerklicher Fertigung als «Manufaktur» betitelt ist. Gemeinhin tut sich die im Luxussegment operierende Schweizer Uhrenindustrie schwer mit anspruchsvoller zeitgemässer Architektur. Während andere Branchen längst die Potenziale von Branding-Architektur erkannt haben, tickt der Uhrensektor anders: Solidität und Tradition bestimmen das Selbstverständnis. Dies macht es den Unternehmen schwer, zu einem der Gegenwart entsprechenden Ausdruck zu finden. Jean Nouvels Bauten für Cartier sind die löblichen Ausnahmen. Wer indes die schon bestehenden oder im Bau befindlichen Produktionsstätten in Plan-les-Ouates besucht, seien es die von Patek Philippe, Piaget oder Rolex, sieht sich mit Architektur konfrontiert, wie sie banaler nicht sein könnte.
Vorbildlicher Industriebau
Mit ihrem weithin sichtbaren Neubau ist der Marke mit dem Malteserkreuz-Logo nun ein Schritt nach vorn gelungen. Tschumi, der mit seiner Büropartnerin Véronique Descharrières zusammenarbeitete, entwarf ein elegantes, zeichenhaftes Gebäude, das seine Funktion auf perfekte Weise erfüllt. Als «eine zeitlose und dennoch zeitgenössische Form» bezeichnet er seinen Entwurf - und gibt damit die Antwort auf die Frage seiner Auftraggeber, wie sich Beständigkeit, Kontinuität und Innovation architektonisch umsetzen liessen. Eine Hülle aus Metall, so interpretiert man bei Vacheron Constantin den Neubau, stelle die Dynamik der Zeit dar, während das Tragwerk aus Beton die Beständigkeit verkörpere.
Der streng ostwestlich ausgerichtete Firmensitz besteht aus einem aufragenden Kopfbau, in dem Administration, Direktion und Marketingabteilung untergebracht sind, sowie dem sich westlich anschliessenden Flachbau für die Werkstätten. Beide Funktionsbereiche stehen aber nicht nebeneinander, sondern sind durch eine metallene Haut zu einem Volumen zusammengefasst. Eine Gitterstruktur aus rostfreiem Stahl bildet die Fassadenhaut oberhalb der verglasten Eingangsfront im Osten, zieht sich über das Dach des Verwaltungsbaus und krümmt sich in dessen Ostfassade, um anschliessend das Dach der Werkstätten zu bilden. In einem halbkreisförmigen Schwung wechselt das Band noch einmal seine Laufrichtung, um nach Fassade und Dach nun auch den Boden zu bilden: Der Baukörper schwebt hier über einem offenen Parkplatz. Dieser ist Teil eines rechtwinklig zum Fabrikgebäude geführten Landschaftsstreifens, dessen nördliche Rampe gärtnerisch gestaltet wurde, während die südliche als Zufahrt und Stellfläche dient.
Bringt der stählerne Überwurf, der die Assoziation eines Uhrarmbands erwecken mag, das über einer Grundfläche von 80 × 42 Metern errichtete Gebäude in Form, so sind die Richtung Norden und Süden orientierten Längsseiten vollständig verglast. Gebäude, die von bandartigen Strukturen umgeben werden und deren gläserne Fassaden wie Schnitte durch das Innere wirken, erfreuen sich in der jüngeren Zeit - ausgehend von niederländischen Vorbildern - grosser Beliebtheit; zu erinnern ist hier an das New Yorker Eyebeam-Projekt von Diller & Scofidio, vor allem aber an die Experimentelle Fabrik von Sauerbruch Hutton in Magdeburg, die in ihrer Kombination von Verwaltungstrakt und Halle eine deutliche Verwandtschaft zu Tschumis Genfer Projekt aufweist. Während das deutsch-englische Architektenteam indes auf eine grellbunte Farbigkeit setzt, zeigt sich Tschumi zurückhaltender und nutzt die Farben der Materialien. Zu dem Grau des Betons, dem Silber des Stahls und dem leichten Grün des Glases tritt im Inneren der Ton des Holzes, mit dem die Untersichten der silbrigen Bandstruktur verkleidet wurden. Trotz dem technoiden Charakter, der dem Gebäude zu eignen scheint, entsteht ein beinahe wohnlicher Eindruck. Die Verwaltungsgeschosse gruppieren sich um das quer gelagerte Atrium mit der vertikalen Erschliessung, die Arbeitsplätze im Werkstättentrakt um einen Patio in Längsrichtung des Baus, der auch das Parkdeck belichtet.
Für den Beitrag verantwortlich: Neue Zürcher Zeitung
Ansprechpartner:in für diese Seite: nextroom






