Artikel
Wiege des Art nouveau
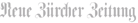
Ausstellungen zum Jugendstil in Brüssel
Mit einer umfangreichen Ausstellung widmen sich die Königlichen Museen in Brüssel dem belgischen Beitrag zur Stilreform im 19. und 20. Jahrhundert. Stadtrundgänge erlauben es darüber hinaus, das architektonische Erbe des Art nouveau zu entdecken.
17. Dezember 2005 - Hubertus Adam
Das 19. Jahrhundert war die Epoche der europäischen Nationalstaaten. Der katholische Süden der Niederlande, in der Vergangenheit wechselnd unter österreichischer, französischer und niederländischer Herrschaft, erklärte sich am 4. Oktober 1830 für unabhängig - der moderne Staat Belgien war geboren. Die 175. Wiederkehr dieses Datums feiert die Nation mit einer Reihe von Veranstaltungen, von denen die Ausstellung «Art Nouveau & Design 1830-1958» als die wichtigste gelten kann. Die umfangreiche Schau wird in den Musées Royaux d'Art et d'Histoire in Brüssel präsentiert. Ziel des Kuratorenteams ist es, anhand der angewandten Kunst den belgischen Weg in die Moderne nachzuzeichnen. Setzt die Schau mit der Staatsgründung 1830 ein, so bildet die Weltausstellung 1958 den Schlusspunkt. Einen Überblick über den gegenwärtigen Stand des Designs vermittelt die Schau «label.design. be», die im historischen Bergwerkskomplex Le Grand Hornu im Borinage zu sehen ist.
Nationalstil und Reformkultur
Die Brüsseler Ausstellungsmacher gliedern ihren Parcours in drei Abschnitte. Zunächst widmen sie sich den durch die Abkehr vom Klassizismus bestimmten Anfängen der Kunstgewerbebewegung. Prägend für Belgien war die Wiederentdeckung der spezifisch flämischen Wurzeln: Für Möbel und Architektur orientierte man sich an der Formensprache eines Hans Vredeman de Vries, und der Architekt Charle-Albert schuf mit seinem Wohnhaus «Het Vlaams Huis» in Watermaal-Bosvoorde 1869-87 ein Gesamtkunstwerk aus dem Geist der flämischen Renaissance. Daneben etablierte sich, zum Teil durch Auftraggeber aus dem Klerus forciert, eine romantisch- neogotische Strömung, die sich ebenfalls auf die nationale Bautraditionen bezog, daneben aber auch von englischen Reformern wie Augustus Welby Pugin und dem Protokonstruktivismus des französischen Theoretikers Viollet-le-Duc inspiriert wurde.
Ohne Zweifel war der Art nouveau der wichtigste Beitrag Belgiens zur Kultur der Moderne. In keiner anderen europäischen Metropole konnte sich das neue Stilempfinden so frühzeitig und so flächendeckend durchsetzen wie in Brüssel. Als Inkunabeln gelten Victor Hortas Maison Tassel und das eigene Wohnhaus des der historistischen Tradition entwachsenen Architekten Paul Hankar. Beide Gebäude entstanden 1893, nur wenige Schritte voneinander entfernt, im südlichen Stadtteil Ixelles, einem der Stadterweiterungsgebiete des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Die Dominanz des Art nouveau, dem allein in Brüssel gut 500 Bauwerke zuzurechnen sind, erklärt sich aufgrund der Prosperität, welche das Land bestimmte: Schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts war Belgien der nach Grossbritannien am stärksten industrialisierte europäische Staat; und riesige Bauprogramme transformierten in der zweiten Hälfte das Stadtbild der Hauptstadt.
Horta mit seinen von floralen Lineamenten bestimmten Bauten und Hankar, der eher zu einer an japonistischen Vorbildern orientierten geometrischen Auffassung neigte, waren die Brüsseler Protagonisten; in Liège agierte der vor allem im Bereich des Interior Design aktive Gustave Serrurier-Bovy, dem nicht zuletzt das Verdienst zukommt, den Schotten Charles Rennie Mackintosh 1895 erstmals zu einer Ausstellungsbeteiligung auf dem Kontinent eingeladen zu haben. Die Möbel von Serrurier-Bovy zählen zweifellos zu den Höhepunkten der Brüsseler Ausstellung - ebenso wie die bizarren Elfenbein-Bronze-Arbeiten von Philippe Wolfers. Diese entstanden in Zusammenhang mit dem Kongo-Pavillon auf der Internationalen Ausstellung im östlichen Brüsseler Vorort Tervuren 1897 und sollten den Elfenbeinimport aus Kongo fördern, welches bis 1908 gleichsam als «Privatkolonie» des belgischen Königs fungierte. Der Generalsekretär des Unabhängigen Kongostaats, Baron van Eetvelde, einer der frühen Auftraggeber Hortas, hatte mit der architektonischen Gestaltung des Tervuren-Pavillons Horta, Hankar, Georges Hobé und Henry van de Velde beauftragt.
Der Kunstgewerbler van de Velde, dem 1895 mit seinem Wohnhaus Bloemenwerf in Uccle der Schritt Richtung Architektur gelungen war, reüssierte vor allem in Deutschland und kehrte erst nach dem Ersten Weltkrieg in seine belgische Heimat zurück. Die Jahre von 1914 bis 1918 bedeuteten eine Epochenschwelle und machten den Art nouveau definitiv zu einem Stil der Vergangenheit. Van de Veldes Spätwerke, darunter die Universitätsbibliothek in Gent, zeigen eine an Berlage geschulte ruhigere Formauffassung und oszillieren zwischen Art déco und Moderne. Den Weg des belgischen Designs in der Zwischen- und Nachkriegszeit dokumentiert der letzte Teil der Brüsseler Schau. In Kojen finden sich unter anderem Interieurs der Gestalter Marcel-Louis Baugniet, Huib Hoste und Willy Van der Meeren. Mit dem Philips-Pavillon von Le Corbusier und dem Atomium wurden auf der Weltausstellung 1958 wegweisende Architekturen ihrer Zeit errichtet.
Rundgänge durch Brüssel
Die jetzige Ausstellung, die trotz hervorragenden Exponaten zu stark objektfixiert bleibt und übergeordnete Themen nur kursorisch behandelt, spart die Architektur weitgehend aus. Doch erhalten die Besucher einen Plan, der es ermöglicht, auf fünf Spaziergängen durch die Stadt insgesamt 150 Bauten des Art nouveau zu besuchen. Meist handelt es sich um Privathäuser, doch führen die Wege auch zu wohlerhaltenen Interieurs - etwa der Restaurants «Falstaff» oder «De Ultime Hallucinatie». Einige Gebäude sind ohnehin zugänglich, darunter Hortas Atelier- und Wohnhaus sowie die Maison Cauchie. Der Malerarchitekt Paul Cauchie errichtete sie 1905 für sich und versah sie mit einer Sgraffito-Fassade sowie mit Innenausstattungen, die deutlich von Mackintosh inspiriert sind. Durch einen historischen Zufall steht das eigentliche Hauptwerk des Wiener Sezessionsstils ebenfalls in unmittelbarer Nachbarschaft: Zwischen 1905 und 1911 realisierte Josef Hoffmann das Palais des Eisenbahnmagnaten Adolphe Stoclet an der Avenue de Tervuren. Das unermesslich luxuriös ausgestattete Gebäude mit den berühmten Mosaiken von Gustav Klimt und den Interieurs der Wiener Werkstätte ist seit je unzugänglich. Nach dem Tod der Tochter von Stoclet im Frühjahr steht es zum Verkauf - der Preis, so heisst es, soll bei einer Milliarde Euro liegen.
Am jetzigen Ausstellungsreigen beteiligen sich auch die rührigen Archives d'Architecture Moderne. «La Façade Art Nouveau» heisst die Schau in der zum Architekturmuseum umgewandelten Freimaurerloge an der Rue de l'Ermitage. Exzellentes Planmaterial und diverse Bauteile belegen die Kunstfertigkeit in den Bereichen Steinbildhauerei und Eisenguss, Keramik und Sgraffito, Bleiglasfenster und Tischlerarbeit. Nicht zuletzt aber werden die Verluste an wertvoller Bausubstanz bilanziert, von der Zerstörung von Hortas meisterhafter Maison du Peuple 1965 bis zum Abriss von Hankars Atelier des Malers Albert Ciamberlani im Jahr 1989.
[ Ausstellungen: bis 31. Dezember in den Musées Royaux d'Art et d'Histoire, bis 23. Dezember in den Archives d'Architecture Moderne. ]
[ Begleitpublikationen: Art nouveau & Design. Les arts décoratifs de 1830 à l'Expo 58. Hrsg. Claire Leblanc. Editions Racine, Bruxelles 2005. 200 S., Euro 29.95. - Eric Hennaut: La Façade Art Nouveau à Bruxelles. AAM Editions, Bruxelles 2005. 64 S., Euro 10.20. - La Maison Cauchie. Entre rêve et réalité. Edition Maison Cauchie, Bruxelles 2005. 96 S., Euro 20.-. ]
Nationalstil und Reformkultur
Die Brüsseler Ausstellungsmacher gliedern ihren Parcours in drei Abschnitte. Zunächst widmen sie sich den durch die Abkehr vom Klassizismus bestimmten Anfängen der Kunstgewerbebewegung. Prägend für Belgien war die Wiederentdeckung der spezifisch flämischen Wurzeln: Für Möbel und Architektur orientierte man sich an der Formensprache eines Hans Vredeman de Vries, und der Architekt Charle-Albert schuf mit seinem Wohnhaus «Het Vlaams Huis» in Watermaal-Bosvoorde 1869-87 ein Gesamtkunstwerk aus dem Geist der flämischen Renaissance. Daneben etablierte sich, zum Teil durch Auftraggeber aus dem Klerus forciert, eine romantisch- neogotische Strömung, die sich ebenfalls auf die nationale Bautraditionen bezog, daneben aber auch von englischen Reformern wie Augustus Welby Pugin und dem Protokonstruktivismus des französischen Theoretikers Viollet-le-Duc inspiriert wurde.
Ohne Zweifel war der Art nouveau der wichtigste Beitrag Belgiens zur Kultur der Moderne. In keiner anderen europäischen Metropole konnte sich das neue Stilempfinden so frühzeitig und so flächendeckend durchsetzen wie in Brüssel. Als Inkunabeln gelten Victor Hortas Maison Tassel und das eigene Wohnhaus des der historistischen Tradition entwachsenen Architekten Paul Hankar. Beide Gebäude entstanden 1893, nur wenige Schritte voneinander entfernt, im südlichen Stadtteil Ixelles, einem der Stadterweiterungsgebiete des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Die Dominanz des Art nouveau, dem allein in Brüssel gut 500 Bauwerke zuzurechnen sind, erklärt sich aufgrund der Prosperität, welche das Land bestimmte: Schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts war Belgien der nach Grossbritannien am stärksten industrialisierte europäische Staat; und riesige Bauprogramme transformierten in der zweiten Hälfte das Stadtbild der Hauptstadt.
Horta mit seinen von floralen Lineamenten bestimmten Bauten und Hankar, der eher zu einer an japonistischen Vorbildern orientierten geometrischen Auffassung neigte, waren die Brüsseler Protagonisten; in Liège agierte der vor allem im Bereich des Interior Design aktive Gustave Serrurier-Bovy, dem nicht zuletzt das Verdienst zukommt, den Schotten Charles Rennie Mackintosh 1895 erstmals zu einer Ausstellungsbeteiligung auf dem Kontinent eingeladen zu haben. Die Möbel von Serrurier-Bovy zählen zweifellos zu den Höhepunkten der Brüsseler Ausstellung - ebenso wie die bizarren Elfenbein-Bronze-Arbeiten von Philippe Wolfers. Diese entstanden in Zusammenhang mit dem Kongo-Pavillon auf der Internationalen Ausstellung im östlichen Brüsseler Vorort Tervuren 1897 und sollten den Elfenbeinimport aus Kongo fördern, welches bis 1908 gleichsam als «Privatkolonie» des belgischen Königs fungierte. Der Generalsekretär des Unabhängigen Kongostaats, Baron van Eetvelde, einer der frühen Auftraggeber Hortas, hatte mit der architektonischen Gestaltung des Tervuren-Pavillons Horta, Hankar, Georges Hobé und Henry van de Velde beauftragt.
Der Kunstgewerbler van de Velde, dem 1895 mit seinem Wohnhaus Bloemenwerf in Uccle der Schritt Richtung Architektur gelungen war, reüssierte vor allem in Deutschland und kehrte erst nach dem Ersten Weltkrieg in seine belgische Heimat zurück. Die Jahre von 1914 bis 1918 bedeuteten eine Epochenschwelle und machten den Art nouveau definitiv zu einem Stil der Vergangenheit. Van de Veldes Spätwerke, darunter die Universitätsbibliothek in Gent, zeigen eine an Berlage geschulte ruhigere Formauffassung und oszillieren zwischen Art déco und Moderne. Den Weg des belgischen Designs in der Zwischen- und Nachkriegszeit dokumentiert der letzte Teil der Brüsseler Schau. In Kojen finden sich unter anderem Interieurs der Gestalter Marcel-Louis Baugniet, Huib Hoste und Willy Van der Meeren. Mit dem Philips-Pavillon von Le Corbusier und dem Atomium wurden auf der Weltausstellung 1958 wegweisende Architekturen ihrer Zeit errichtet.
Rundgänge durch Brüssel
Die jetzige Ausstellung, die trotz hervorragenden Exponaten zu stark objektfixiert bleibt und übergeordnete Themen nur kursorisch behandelt, spart die Architektur weitgehend aus. Doch erhalten die Besucher einen Plan, der es ermöglicht, auf fünf Spaziergängen durch die Stadt insgesamt 150 Bauten des Art nouveau zu besuchen. Meist handelt es sich um Privathäuser, doch führen die Wege auch zu wohlerhaltenen Interieurs - etwa der Restaurants «Falstaff» oder «De Ultime Hallucinatie». Einige Gebäude sind ohnehin zugänglich, darunter Hortas Atelier- und Wohnhaus sowie die Maison Cauchie. Der Malerarchitekt Paul Cauchie errichtete sie 1905 für sich und versah sie mit einer Sgraffito-Fassade sowie mit Innenausstattungen, die deutlich von Mackintosh inspiriert sind. Durch einen historischen Zufall steht das eigentliche Hauptwerk des Wiener Sezessionsstils ebenfalls in unmittelbarer Nachbarschaft: Zwischen 1905 und 1911 realisierte Josef Hoffmann das Palais des Eisenbahnmagnaten Adolphe Stoclet an der Avenue de Tervuren. Das unermesslich luxuriös ausgestattete Gebäude mit den berühmten Mosaiken von Gustav Klimt und den Interieurs der Wiener Werkstätte ist seit je unzugänglich. Nach dem Tod der Tochter von Stoclet im Frühjahr steht es zum Verkauf - der Preis, so heisst es, soll bei einer Milliarde Euro liegen.
Am jetzigen Ausstellungsreigen beteiligen sich auch die rührigen Archives d'Architecture Moderne. «La Façade Art Nouveau» heisst die Schau in der zum Architekturmuseum umgewandelten Freimaurerloge an der Rue de l'Ermitage. Exzellentes Planmaterial und diverse Bauteile belegen die Kunstfertigkeit in den Bereichen Steinbildhauerei und Eisenguss, Keramik und Sgraffito, Bleiglasfenster und Tischlerarbeit. Nicht zuletzt aber werden die Verluste an wertvoller Bausubstanz bilanziert, von der Zerstörung von Hortas meisterhafter Maison du Peuple 1965 bis zum Abriss von Hankars Atelier des Malers Albert Ciamberlani im Jahr 1989.
[ Ausstellungen: bis 31. Dezember in den Musées Royaux d'Art et d'Histoire, bis 23. Dezember in den Archives d'Architecture Moderne. ]
[ Begleitpublikationen: Art nouveau & Design. Les arts décoratifs de 1830 à l'Expo 58. Hrsg. Claire Leblanc. Editions Racine, Bruxelles 2005. 200 S., Euro 29.95. - Eric Hennaut: La Façade Art Nouveau à Bruxelles. AAM Editions, Bruxelles 2005. 64 S., Euro 10.20. - La Maison Cauchie. Entre rêve et réalité. Edition Maison Cauchie, Bruxelles 2005. 96 S., Euro 20.-. ]
Für den Beitrag verantwortlich: Neue Zürcher Zeitung
Ansprechpartner:in für diese Seite: nextroom






