Artikel
Von der Theorie zur Architektur
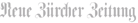
Leon Battista Alberti - Ausstellung im Palazzo Strozzi in Florenz
Leon Battista Alberti (1404-1472) war Kurienbeamter und Literat, Wissenschafter, Forscher und Archi- tekt. Eine Ausstellung widmet sich nun seiner Beziehung zu Florenz.
18. April 2006 - Hubertus Adam
Es war Leon Battista Alberti, der als Erster das Renaissance-Ideal des «uomo universale» verkörperte. 1404 als unehelicher Sohn eines wohlhabenden Florentiner Kaufmanns in Genua geboren, studierte er in Venedig, Padua und Bologna, lebte anschliessend in Florenz und trat 1432 in den Dienst der päpstlichen Kurie. Jahre in Rom wechselten mit Aufenthalten in anderen Städten Italiens - Florenz vor allem, aber auch Rimini und später Mantua. Nachdem Alberti 1435 einen Traktat über Malerei verfasst hatte, widmete er sich in Rom dem Antikenstudium und zählte wie auch Andrea Mantegna, Fra Angelico oder Filarete zum Humanistenzirkel um Papst Nikolaus V. In Florenz war er mit Brunelleschi befreundet.
Alberti als Forschungsgegenstand
Seit Mitte des Jahrhunderts begann Alberti mit architektonischen Entwürfen, die in Florenz, Rimini und Mantua realisiert wurden. Auch wenn er sich vielen anderen Bereichen der Kunst, Wissenschaft und Literatur widmete, so entfaltete er doch die grösste Wirkung mit seiner Abhandlung über die Baukunst, dem 1485 postum herausgegebenen Architekturtraktat «De re aedificatoria». Obwohl ein Standardwerk der Architekturtheorie, hat Albertis Schrift gegenüber späteren Texten vergleichsweise wenig Niederschlag gefunden - wohl nicht zuletzt deshalb, weil ihr keine Illustrationen beigegeben waren.
Die Forschung über Alberti hat sich im Vorfeld von dessen 600. Geburtstag intensiviert. Zwischen 2002 und 2004 wurden in Mantua, Genua, Arezzo und Florenz insgesamt sechs Fachtagungen abgehalten; ihnen folgten im vergangenen Jahr zwei Ausstellungen. Diejenige in den Kapitolinischen Museen in Rom widmete sich Alberti und der Antikenrezeption im Rom des Quattrocento, diejenige in der Biblioteca Laurenziana von Florenz dem Thema Literatur und Humanismus. Eine grosse Schau im Florentiner Palazzo Strozzi trägt nun den Titel «Leon Battista Alberti e le arti a Firenze». Mit ihr finden die Alberti-Feiern ihren Abschluss. Das Problem, mit dem die Alberti-Forschung zu kämpfen hat, wird auch zu einem Problem bei der publikumswirksamen Vermittlung: Trotz einem umfangreichen literarischen uvre ist die Quellenlage hinsichtlich seiner sonstigen Tätigkeiten eher dürftig. Zwar definierte Alberti die Architektur, die höchste aller menschlichen Betätigungen, als Verbindung von «ratio» und «ars», von «ragione» und «bellezza» und damit als die ideale Verbindung von Theorie und Praxis. Realisieren indes liess er seine Bauten von anderen, und über die Autorschaft am Palazzo Rucellai in Florenz sind wir nur durch Vasaris Künstlerviten unterrichtet; ausgeführt wurde der Bau von Bernardo Rosselino.
Die Ausstellungsmacher müssen sich zwangsläufig mit der Skizzierung eines kulturhistorischen Panoramas begnügen, in dem Alberti bald mehr, bald weniger deutlich Konturen gewinnt. Die Schau gliedert sich in sieben Teile. Der erste ist der Familiengeschichte gewidmet, der zweite thematisiert das Florentiner Konzil von 1439, bei dem Vertreter der West- und der Ostkirche zusammenkamen. Nicht das verfehlte Ziel einer Wiedervereinigung der christlichen Kirche macht die Konferenz aus heutiger Sicht interessant, sondern ein Nebenprodukt des Gipfeltreffens: die neue Wertschätzung von Zeugnissen der altgriechischen Klassik.
Das eigentliche Zentrum der Schau bildet der dritte, um die Rucellai und die Medici kreisende Teil. Neben Sigismondo Malatesta aus Rimini, der Alberti mit dem Umbau einer Kirchenruine zu einem Monument der Familiendynastie betraute, war es der reiche Kaufmann Giovanni Rucellai, welcher den Universalgelehrten gegen Mitte des 15. Jahrhunderts zum entwerfenden Architekten werden liess. Zunächst betraute er ihn mit dem Bau seines Palazzo, der mit der vorgeblendeten Pilastergliederung eine Revolution im Florentiner Palastbau darstellte: Tektonische Strenge und formale Eleganz vereinen sich in einem Bau, der gemäss Albertis Vorstellungen nicht nur als Monument von der Macht des Bauherrn zeugen, sondern sich in eine urbane Struktur einfügen soll. 1470 war laut Inschrift die zweite stadtbildprägende Intervention fertig gestellt: die Fassade von Santa Maria Novella.
Ohne den romanischen Inkrustationsstil von San Miniato al Monte ist Albertis Konzept ebenso wenig zu verstehen wie ohne Brunelleschis luzide Frührenaissance-Bauten mit ihren Kontrasten von weissen Flächen und grauen Gliederungselementen. Und doch gelang Alberti etwas, was ihn von seinem grossen Vorgänger unterscheidet: eine flächig-ornamentale Interpretation antikisierender Motive. Es ist kein Wunder, dass Alberti um 1900 erneut auf Interesse stiess, als man in Wien das Verhältnis von Tektonik und Dekoration der Fassaden diskutierte: Die wunderbaren Aquarelle, die Josef Frank von Santa Maria Novella und anderen Bauten Albertis für seine 1910 vorgelegte Dissertation anfertigte, sind nun erstmals in Italien zu sehen.
Kulturhistorisches Panorama
Auch das intimste Projekt Albertis, das Heilige Grab in der Rucellai-Kapelle von San Pancrazio, wurde von Josef Frank gezeichnet. Wie ein Modell wirkt das kleine Bauwerk, das mit der Hochzeit von Giovanni Rucellais Sohn Bernardo und Nannina, der Nichte von Cosimo de' Medici, in Verbindung gebracht wird (1466). Der Ehevertrag festigte die Verflechtung beider Familien, aber auch die Rolle Albertis. Lorenzo de' Medici sorgte nach dessen Tod 1472 dafür, dass der Architekturtraktat in Druck ging. Aufgrund neuerer Forschungen wird die Medici-Villa in Fiesole, bisher Michelozzo zugeschrieben, näher an Alberti herangerückt. Unbestritten ist, dass dieser mit seiner Konzeption einer Villa suburbana und der sie umgebenden Terrassengärten den Villenbau der Toskana stark beeinflusste. Das gilt besonders für die Villa von Poggio a Caiano, die Giuliano da Sangallo für Lorenzo il Magnifico plante.
Im vierten, der Stadt und dem Territorium gewidmeten Teil der Schau wird mit Hilfe von Projektionen unter anderem die Kuppel der Kirche Santissima Annunziata thematisiert, bei welcher Alberti auf die Konstruktion antiker Zentralbauten zurückgriff. Den Traktaten Albertis und ihrer unmittelbaren Wirkung sind die beiden folgenden Abteilungen gewidmet. Greifbar wird das unter anderem am Sujet der «Verleumdung des Apelles», eines von Lukian beschriebenen Gemäldes, das Alberti in seiner Schrift «De Pictura» den Künstlern zur Nachahmung empfahl. Botticellis «Allegoria della Calumnia» (um 1495) gilt als die bedeutendste Umsetzung des Themas. Das Wort «misura» ist einer der Kernbegriffe von Alberti, er steht für die Schönheit auf Basis harmonischer Proportionen und findet seinen Niederschlag in den zentralperspektivischen Darstellungen von Raumsituationen. - Den Abschluss der Ausstellung bildet die «Città ideale» aus Urbino, die wohl berühmteste Darstellung eines Stadtideals der italienischen Renaissance. Seitlich eines zentralen Rundbaus staffeln sich Palazzi entlang zweier Strassenfluchten in die Tiefe - die Interpretation des Bildinhalts ist umstritten. Gabriele Morolli sieht nach jüngsten Röntgenuntersuchungen seine These bestätigt, dass es sich um eine fiktive Darstellung der unter Papst Nikolaus V. postulierten Wiedererrichtung des antiken Rom handle. Gleichwohl ist es wagemutig, anhand der nunmehr entdeckten Vorzeichnungen eine - zumindest indirekte - Autorschaft Albertis zu reklamieren.
[ Bis zum 23. Juli im Palazzo Strozzi. Katalog: L'uomo del rinascimento. Leon Battista Alberti e le arti a Firenze tra ragione e bellezza. Hrsg. Cristina Acidini und Gabriele Morolli. Mandragora Maschietto Editore, Florenz 2006. 480 S., Euro 35.-. ]
Alberti als Forschungsgegenstand
Seit Mitte des Jahrhunderts begann Alberti mit architektonischen Entwürfen, die in Florenz, Rimini und Mantua realisiert wurden. Auch wenn er sich vielen anderen Bereichen der Kunst, Wissenschaft und Literatur widmete, so entfaltete er doch die grösste Wirkung mit seiner Abhandlung über die Baukunst, dem 1485 postum herausgegebenen Architekturtraktat «De re aedificatoria». Obwohl ein Standardwerk der Architekturtheorie, hat Albertis Schrift gegenüber späteren Texten vergleichsweise wenig Niederschlag gefunden - wohl nicht zuletzt deshalb, weil ihr keine Illustrationen beigegeben waren.
Die Forschung über Alberti hat sich im Vorfeld von dessen 600. Geburtstag intensiviert. Zwischen 2002 und 2004 wurden in Mantua, Genua, Arezzo und Florenz insgesamt sechs Fachtagungen abgehalten; ihnen folgten im vergangenen Jahr zwei Ausstellungen. Diejenige in den Kapitolinischen Museen in Rom widmete sich Alberti und der Antikenrezeption im Rom des Quattrocento, diejenige in der Biblioteca Laurenziana von Florenz dem Thema Literatur und Humanismus. Eine grosse Schau im Florentiner Palazzo Strozzi trägt nun den Titel «Leon Battista Alberti e le arti a Firenze». Mit ihr finden die Alberti-Feiern ihren Abschluss. Das Problem, mit dem die Alberti-Forschung zu kämpfen hat, wird auch zu einem Problem bei der publikumswirksamen Vermittlung: Trotz einem umfangreichen literarischen uvre ist die Quellenlage hinsichtlich seiner sonstigen Tätigkeiten eher dürftig. Zwar definierte Alberti die Architektur, die höchste aller menschlichen Betätigungen, als Verbindung von «ratio» und «ars», von «ragione» und «bellezza» und damit als die ideale Verbindung von Theorie und Praxis. Realisieren indes liess er seine Bauten von anderen, und über die Autorschaft am Palazzo Rucellai in Florenz sind wir nur durch Vasaris Künstlerviten unterrichtet; ausgeführt wurde der Bau von Bernardo Rosselino.
Die Ausstellungsmacher müssen sich zwangsläufig mit der Skizzierung eines kulturhistorischen Panoramas begnügen, in dem Alberti bald mehr, bald weniger deutlich Konturen gewinnt. Die Schau gliedert sich in sieben Teile. Der erste ist der Familiengeschichte gewidmet, der zweite thematisiert das Florentiner Konzil von 1439, bei dem Vertreter der West- und der Ostkirche zusammenkamen. Nicht das verfehlte Ziel einer Wiedervereinigung der christlichen Kirche macht die Konferenz aus heutiger Sicht interessant, sondern ein Nebenprodukt des Gipfeltreffens: die neue Wertschätzung von Zeugnissen der altgriechischen Klassik.
Das eigentliche Zentrum der Schau bildet der dritte, um die Rucellai und die Medici kreisende Teil. Neben Sigismondo Malatesta aus Rimini, der Alberti mit dem Umbau einer Kirchenruine zu einem Monument der Familiendynastie betraute, war es der reiche Kaufmann Giovanni Rucellai, welcher den Universalgelehrten gegen Mitte des 15. Jahrhunderts zum entwerfenden Architekten werden liess. Zunächst betraute er ihn mit dem Bau seines Palazzo, der mit der vorgeblendeten Pilastergliederung eine Revolution im Florentiner Palastbau darstellte: Tektonische Strenge und formale Eleganz vereinen sich in einem Bau, der gemäss Albertis Vorstellungen nicht nur als Monument von der Macht des Bauherrn zeugen, sondern sich in eine urbane Struktur einfügen soll. 1470 war laut Inschrift die zweite stadtbildprägende Intervention fertig gestellt: die Fassade von Santa Maria Novella.
Ohne den romanischen Inkrustationsstil von San Miniato al Monte ist Albertis Konzept ebenso wenig zu verstehen wie ohne Brunelleschis luzide Frührenaissance-Bauten mit ihren Kontrasten von weissen Flächen und grauen Gliederungselementen. Und doch gelang Alberti etwas, was ihn von seinem grossen Vorgänger unterscheidet: eine flächig-ornamentale Interpretation antikisierender Motive. Es ist kein Wunder, dass Alberti um 1900 erneut auf Interesse stiess, als man in Wien das Verhältnis von Tektonik und Dekoration der Fassaden diskutierte: Die wunderbaren Aquarelle, die Josef Frank von Santa Maria Novella und anderen Bauten Albertis für seine 1910 vorgelegte Dissertation anfertigte, sind nun erstmals in Italien zu sehen.
Kulturhistorisches Panorama
Auch das intimste Projekt Albertis, das Heilige Grab in der Rucellai-Kapelle von San Pancrazio, wurde von Josef Frank gezeichnet. Wie ein Modell wirkt das kleine Bauwerk, das mit der Hochzeit von Giovanni Rucellais Sohn Bernardo und Nannina, der Nichte von Cosimo de' Medici, in Verbindung gebracht wird (1466). Der Ehevertrag festigte die Verflechtung beider Familien, aber auch die Rolle Albertis. Lorenzo de' Medici sorgte nach dessen Tod 1472 dafür, dass der Architekturtraktat in Druck ging. Aufgrund neuerer Forschungen wird die Medici-Villa in Fiesole, bisher Michelozzo zugeschrieben, näher an Alberti herangerückt. Unbestritten ist, dass dieser mit seiner Konzeption einer Villa suburbana und der sie umgebenden Terrassengärten den Villenbau der Toskana stark beeinflusste. Das gilt besonders für die Villa von Poggio a Caiano, die Giuliano da Sangallo für Lorenzo il Magnifico plante.
Im vierten, der Stadt und dem Territorium gewidmeten Teil der Schau wird mit Hilfe von Projektionen unter anderem die Kuppel der Kirche Santissima Annunziata thematisiert, bei welcher Alberti auf die Konstruktion antiker Zentralbauten zurückgriff. Den Traktaten Albertis und ihrer unmittelbaren Wirkung sind die beiden folgenden Abteilungen gewidmet. Greifbar wird das unter anderem am Sujet der «Verleumdung des Apelles», eines von Lukian beschriebenen Gemäldes, das Alberti in seiner Schrift «De Pictura» den Künstlern zur Nachahmung empfahl. Botticellis «Allegoria della Calumnia» (um 1495) gilt als die bedeutendste Umsetzung des Themas. Das Wort «misura» ist einer der Kernbegriffe von Alberti, er steht für die Schönheit auf Basis harmonischer Proportionen und findet seinen Niederschlag in den zentralperspektivischen Darstellungen von Raumsituationen. - Den Abschluss der Ausstellung bildet die «Città ideale» aus Urbino, die wohl berühmteste Darstellung eines Stadtideals der italienischen Renaissance. Seitlich eines zentralen Rundbaus staffeln sich Palazzi entlang zweier Strassenfluchten in die Tiefe - die Interpretation des Bildinhalts ist umstritten. Gabriele Morolli sieht nach jüngsten Röntgenuntersuchungen seine These bestätigt, dass es sich um eine fiktive Darstellung der unter Papst Nikolaus V. postulierten Wiedererrichtung des antiken Rom handle. Gleichwohl ist es wagemutig, anhand der nunmehr entdeckten Vorzeichnungen eine - zumindest indirekte - Autorschaft Albertis zu reklamieren.
[ Bis zum 23. Juli im Palazzo Strozzi. Katalog: L'uomo del rinascimento. Leon Battista Alberti e le arti a Firenze tra ragione e bellezza. Hrsg. Cristina Acidini und Gabriele Morolli. Mandragora Maschietto Editore, Florenz 2006. 480 S., Euro 35.-. ]
Für den Beitrag verantwortlich: Neue Zürcher Zeitung
Ansprechpartner:in für diese Seite: nextroom






