Artikel
Zurück an die Schelde
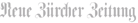
Vielfältige Ansätze zu einer Stadterneuerung in Antwerpen
Obwohl in Antwerpen Rechtsextremisten immer wieder für Schlagzeilen sorgen, ist die Stadt weiterhin weltoffen - auch auf dem Gebiet der Architektur. Davon zeugen die Pläne für die Bebauung der historischen Hafenareale - und der neue Justizpalast von Richard Rogers.
3. November 2006 - Hubertus Adam
Lange galt die Schelde als Lebensader Antwerpens. Dem Handel verdankte die 60 Kilometer vom Meer aus flussaufwärts gelegene Stadt ihren Wohlstand, und der Hafen ist nach Rotterdam der zweitgrösste Europas. Allerdings hat die Stadt den Bezug zum Wasser verloren, seit der Hafen sich flussabwärts in Richtung niederländische Grenze verlagert. Wie in den meisten Häfen der Welt wurden auch hier mit dem Siegeszug des Containerschiffs eine tiefgreifende Veränderung der Verladelogistik und eine Ausweisung neuer Hafenareale nötig - mit der Konsequenz, dass die stadtnahen historischen Quaianlagen nicht mehr benötigt werden.
Stadt am Strom
Während es Hamburg überaus erfolgreich gelungen ist, seinen Hafen als wichtigsten Identitätsfaktor zu positionieren, und auch Rotterdam mit der Bebauung auf Kop van Zuid am Südufer der Maas internationale Aufmerksamkeit erzielen konnte, erfolgt der Transformationsprozess am Ufer der Schelde eher zögerlich. Die meisten Besucher, die vom grandiosen Fin-de-Siècle-Kuppelbau der Centraal Station durch die Einkaufsstrasse Meir in die Altstadt mit ihrer Platzfolge aus Groenplaats, Koornmarkt und Grote Markt gehen, nehmen wohl den Fluss nicht einmal wahr. Ohnehin ist das jüngste Image Antwerpens das der Modemetropole. Vor 25 Jahren graduierten die legendären «Antwerp Six» - Walter van Beirendonck, Ann Demeulemeester, Marina Yee, Dirk van Saene, Dries van Noten und Dirk Bikkembergs - an der Modeabteilung der Kunstakademie und verhalfen der Stadt zu einem neuen Selbstverständnis: Die Ateliers der Modeschöpfer, die Ausstellungen des Modemuseums MoMu und Events wie der «Fashion Walk» ziehen ein junges, trendorientiertes Publikum in die Stadt der flämischen Renaissance.
«Stad aan de Stroom» heisst ein von Stadtverwaltung und Hafenbehörde gemeinsam erarbeitetes Leitbild für die Umnutzung der historischen Hafenareale. Waren die Schiffe zuvor direkt an den Scheldequais vor Anker gegangen, entstanden - nach der durch die französische Besatzung (ab 1792) angeordneten Schleifung der Befestigungsanlagen - von den Gezeiten unabhängige, durch Schleusen abgetrennte Hafenbecken unmittelbar nördlich des Zentrums. Westöstlich ausgerichtet sind Bonaparte- und Willemdok, nach Norden schliesst sich rechtwinklig dazu das Kattendijkdok mit seinem Gefieder aus Trockendocks an, von dem aus eine Reihe weiterer Becken zu erreichen ist. «Eilandje» heisst das Areal mit seinen insgesamt 172 Hektaren Fläche. Die Umnutzung begann Mitte der neunziger Jahre mit einer Studie des spanischen Architekten Mauel de Solà-Morales, die 1998 in einen Masterplan mündete. In einer ersten Phase konzentriert man sich auf die südliche Hälfte des Gebietes, die sich wiederum in drei unterschiedliche Teilbereiche gliedert. «Oude Dokken» ist der Bereich um Bonaparte- und Willemdok, der unmittelbar an das historische Zentrum angrenzt.
Die noch vorhandenen Lagerhäuser des 19. Jahrhunderts - zu den eindrucksvollsten zählt das Stapelhuis Sint-Felix aus dem Jahr 1863 - werden zu Lofts und Büros umgewandelt und durch Bebauungen ergänzt, welche die Blockstruktur ergänzen. Zum Wahrzeichen des Areals soll das auf der Halbinsel zwischen beiden Hafenbecken geplante Museum aan de Stroom (MAS) werden. In dem turmartigen Gebäude über quadratischem Grundriss finden die Sammlungen des Nationalen Schifffahrtsmuseums, des Volkskundemuseums und des Museums Vleeshuis ihr neues Domizil. «Stapelhuis» nennt das Architekturbüro Neutelings Riedijk sein im Jahr 2000 zur Ausführung bestimmtes Konzept für den Hanzesteden Plaats. Schichten, Stapeln und Verbinden sind zentrale Themen der Planer aus Rotterdam, und so besteht das markante Volumen aus übereinander placierten Boxen, die durch spiralförmig entlang der Aussenfassade sich in die Höhe schraubende Treppen erschlossen werden.
Das MAS besitzt künftig eine Reihe von Dépendancen. Dazu zählen ein Seezeichenpark im Stadtteil Linkeroever auf der anderen Seite der Schelde, der historische Hafen im Bonapartedok, vor allem aber das Red Star Line Memorial. Zwischen 1873 und 1935 brachten die Dampfer der Reederei Red Star Line drei Millionen Auswanderer in die USA und nach Kanada; Antwerpen avancierte neben Bremerhaven und Hamburg zum wichtigsten europäischen Auswandererhafen. Nicht zuletzt das zunehmende Interesse der Amerikaner an den Wurzeln in der Alten Welt hat die Emigrationsströme in den letzten Jahren zu einem wichtigen Forschungsgegenstand werden lassen. Davon zeugen das unlängst eröffnete Auswandererhaus in Bremerhaven - und demnächst auch die zu einem Museum umgewidmeten, eher unscheinbaren Ziegelhallen der Red Star Line in Antwerpen.
Das auf den Umgang mit historischen Bauten spezialisierte New Yorker Architekturbüro Beyer Blinder Belle, welches schon das Immigrationsmuseum auf Ellis Island konzipiert hat und auch für die Renovierung des Grand Central Terminal verantwortlich zeichnete, gewann im April 2006 den Wettbewerb für die Antwerpener Gedenkstätte. Die Lagerhäuser ringsum, welche inzwischen eine Reihe kultureller Institutionen beherbergen, prägen das Quartier Montevideo, das sich zwischen Schelde und Kattendijkdok erstreckt. Die Hangars am Scheldeufer mit einer Phalanx alter Kräne haben inzwischen neue Nutzungen gefunden, während die Realisierung von sechs das Westufer des Kattendijkdoks flankierenden Hochhäusern noch auf sich warten lässt. Weit vorangeschritten ist die Planung der beiden Bauten von Diener & Diener, es folgen die Turmpaare von David Chipperfield sowie von Gigon Guyer. Mit Blockrandbebauungen vorrangig dem Wohnen vorbehalten bleibt das Quartier Cadix auf der anderen Seite des Hafenbeckens.
Segel über der Stadt
Antwerpens Stadtentwicklung konzentriert sich neben dem Eilandje auf fünf weitere Gebiete, so die Umgebung der Centraal Station, wo Michael Graves schon 1997 am Koningin-Astrid-Plein ein Hotel realisierte, oder das aufgelassene Gleisareal im Nordwesten der Stadt («Spoor Noord»). Von besonderer Bedeutung ist der «Zuidrand», die südliche Stadtkante zwischen Scheldeufer, Innenstadt und Autobahn. Als markantes Bauwerk und städtebauliches Scharnier ist hier in der Achse der Amerikalei der im vergangenen Frühjahr eingeweihte Justizpalast entstanden, in dem die über verschiedene Standort verteilten Justizbehörden vereint wurden. 1998 hatte der inzwischen zum Spezialisten für Justizgebäude gewordene Richard Rogers den internationalen Wettbewerb für sich entscheiden können.
Die radial auf den Bolivarplaats zustrebenden Strassen haben mit Rogers' Bau ein Gegenüber, ja einen Point de vue gefunden. Dabei bleibt der Londoner Architekt seiner Skepsis gegenüber Pathosformeln treu, auch wenn er mit der Tradition des Repräsentativen spielt. Der Gerichtskomplex mit seinen sechs Trakten ist spiegelsymmetrisch angelegt und wird von einer zentralen Halle aus erschlossen, zu der auch eine Freitreppe hinaufführt. Doch die Treppe, gestützt von schwefelgelben Stahlträgern, besteht aus Holzplanken und führt in eine lichtdurchflutete Foyerhalle. Von hier aus erreicht man die 6 grossen und 26 kleinen Gerichtssäle, welche die oberste Ebene der jeweils drei Trakte zur Rechten und zur Linken einnehmen und die gesamte Justizverwaltung mit den drei Geschossen darunter gleichsam in den Sockel zwingen. Dachelemente aus hyperbolischen Paraboloiden überdecken die Säle. Sie bestehen aus einer Holzfachwerkkonstruktion und sind aussen mit Stahlblech überzogen. In die Höhe gezogen und auf der sonnenabgewandten Seite verglast, dienen sie zugleich der Belichtung. Die sich aufgipfelnde Dachlandschaft mag an Haifischflossen erinnern. Richard Rogers war indes laut eigenem Bekunden von den Segelschiffen auf den Seestücken des niederländischen Barock inspiriert. So kann man auch den neuen Gerichtshof als eine Hommage an die neu zu entdeckende maritime Tradition der Scheldestadt verstehen.
Stadt am Strom
Während es Hamburg überaus erfolgreich gelungen ist, seinen Hafen als wichtigsten Identitätsfaktor zu positionieren, und auch Rotterdam mit der Bebauung auf Kop van Zuid am Südufer der Maas internationale Aufmerksamkeit erzielen konnte, erfolgt der Transformationsprozess am Ufer der Schelde eher zögerlich. Die meisten Besucher, die vom grandiosen Fin-de-Siècle-Kuppelbau der Centraal Station durch die Einkaufsstrasse Meir in die Altstadt mit ihrer Platzfolge aus Groenplaats, Koornmarkt und Grote Markt gehen, nehmen wohl den Fluss nicht einmal wahr. Ohnehin ist das jüngste Image Antwerpens das der Modemetropole. Vor 25 Jahren graduierten die legendären «Antwerp Six» - Walter van Beirendonck, Ann Demeulemeester, Marina Yee, Dirk van Saene, Dries van Noten und Dirk Bikkembergs - an der Modeabteilung der Kunstakademie und verhalfen der Stadt zu einem neuen Selbstverständnis: Die Ateliers der Modeschöpfer, die Ausstellungen des Modemuseums MoMu und Events wie der «Fashion Walk» ziehen ein junges, trendorientiertes Publikum in die Stadt der flämischen Renaissance.
«Stad aan de Stroom» heisst ein von Stadtverwaltung und Hafenbehörde gemeinsam erarbeitetes Leitbild für die Umnutzung der historischen Hafenareale. Waren die Schiffe zuvor direkt an den Scheldequais vor Anker gegangen, entstanden - nach der durch die französische Besatzung (ab 1792) angeordneten Schleifung der Befestigungsanlagen - von den Gezeiten unabhängige, durch Schleusen abgetrennte Hafenbecken unmittelbar nördlich des Zentrums. Westöstlich ausgerichtet sind Bonaparte- und Willemdok, nach Norden schliesst sich rechtwinklig dazu das Kattendijkdok mit seinem Gefieder aus Trockendocks an, von dem aus eine Reihe weiterer Becken zu erreichen ist. «Eilandje» heisst das Areal mit seinen insgesamt 172 Hektaren Fläche. Die Umnutzung begann Mitte der neunziger Jahre mit einer Studie des spanischen Architekten Mauel de Solà-Morales, die 1998 in einen Masterplan mündete. In einer ersten Phase konzentriert man sich auf die südliche Hälfte des Gebietes, die sich wiederum in drei unterschiedliche Teilbereiche gliedert. «Oude Dokken» ist der Bereich um Bonaparte- und Willemdok, der unmittelbar an das historische Zentrum angrenzt.
Die noch vorhandenen Lagerhäuser des 19. Jahrhunderts - zu den eindrucksvollsten zählt das Stapelhuis Sint-Felix aus dem Jahr 1863 - werden zu Lofts und Büros umgewandelt und durch Bebauungen ergänzt, welche die Blockstruktur ergänzen. Zum Wahrzeichen des Areals soll das auf der Halbinsel zwischen beiden Hafenbecken geplante Museum aan de Stroom (MAS) werden. In dem turmartigen Gebäude über quadratischem Grundriss finden die Sammlungen des Nationalen Schifffahrtsmuseums, des Volkskundemuseums und des Museums Vleeshuis ihr neues Domizil. «Stapelhuis» nennt das Architekturbüro Neutelings Riedijk sein im Jahr 2000 zur Ausführung bestimmtes Konzept für den Hanzesteden Plaats. Schichten, Stapeln und Verbinden sind zentrale Themen der Planer aus Rotterdam, und so besteht das markante Volumen aus übereinander placierten Boxen, die durch spiralförmig entlang der Aussenfassade sich in die Höhe schraubende Treppen erschlossen werden.
Das MAS besitzt künftig eine Reihe von Dépendancen. Dazu zählen ein Seezeichenpark im Stadtteil Linkeroever auf der anderen Seite der Schelde, der historische Hafen im Bonapartedok, vor allem aber das Red Star Line Memorial. Zwischen 1873 und 1935 brachten die Dampfer der Reederei Red Star Line drei Millionen Auswanderer in die USA und nach Kanada; Antwerpen avancierte neben Bremerhaven und Hamburg zum wichtigsten europäischen Auswandererhafen. Nicht zuletzt das zunehmende Interesse der Amerikaner an den Wurzeln in der Alten Welt hat die Emigrationsströme in den letzten Jahren zu einem wichtigen Forschungsgegenstand werden lassen. Davon zeugen das unlängst eröffnete Auswandererhaus in Bremerhaven - und demnächst auch die zu einem Museum umgewidmeten, eher unscheinbaren Ziegelhallen der Red Star Line in Antwerpen.
Das auf den Umgang mit historischen Bauten spezialisierte New Yorker Architekturbüro Beyer Blinder Belle, welches schon das Immigrationsmuseum auf Ellis Island konzipiert hat und auch für die Renovierung des Grand Central Terminal verantwortlich zeichnete, gewann im April 2006 den Wettbewerb für die Antwerpener Gedenkstätte. Die Lagerhäuser ringsum, welche inzwischen eine Reihe kultureller Institutionen beherbergen, prägen das Quartier Montevideo, das sich zwischen Schelde und Kattendijkdok erstreckt. Die Hangars am Scheldeufer mit einer Phalanx alter Kräne haben inzwischen neue Nutzungen gefunden, während die Realisierung von sechs das Westufer des Kattendijkdoks flankierenden Hochhäusern noch auf sich warten lässt. Weit vorangeschritten ist die Planung der beiden Bauten von Diener & Diener, es folgen die Turmpaare von David Chipperfield sowie von Gigon Guyer. Mit Blockrandbebauungen vorrangig dem Wohnen vorbehalten bleibt das Quartier Cadix auf der anderen Seite des Hafenbeckens.
Segel über der Stadt
Antwerpens Stadtentwicklung konzentriert sich neben dem Eilandje auf fünf weitere Gebiete, so die Umgebung der Centraal Station, wo Michael Graves schon 1997 am Koningin-Astrid-Plein ein Hotel realisierte, oder das aufgelassene Gleisareal im Nordwesten der Stadt («Spoor Noord»). Von besonderer Bedeutung ist der «Zuidrand», die südliche Stadtkante zwischen Scheldeufer, Innenstadt und Autobahn. Als markantes Bauwerk und städtebauliches Scharnier ist hier in der Achse der Amerikalei der im vergangenen Frühjahr eingeweihte Justizpalast entstanden, in dem die über verschiedene Standort verteilten Justizbehörden vereint wurden. 1998 hatte der inzwischen zum Spezialisten für Justizgebäude gewordene Richard Rogers den internationalen Wettbewerb für sich entscheiden können.
Die radial auf den Bolivarplaats zustrebenden Strassen haben mit Rogers' Bau ein Gegenüber, ja einen Point de vue gefunden. Dabei bleibt der Londoner Architekt seiner Skepsis gegenüber Pathosformeln treu, auch wenn er mit der Tradition des Repräsentativen spielt. Der Gerichtskomplex mit seinen sechs Trakten ist spiegelsymmetrisch angelegt und wird von einer zentralen Halle aus erschlossen, zu der auch eine Freitreppe hinaufführt. Doch die Treppe, gestützt von schwefelgelben Stahlträgern, besteht aus Holzplanken und führt in eine lichtdurchflutete Foyerhalle. Von hier aus erreicht man die 6 grossen und 26 kleinen Gerichtssäle, welche die oberste Ebene der jeweils drei Trakte zur Rechten und zur Linken einnehmen und die gesamte Justizverwaltung mit den drei Geschossen darunter gleichsam in den Sockel zwingen. Dachelemente aus hyperbolischen Paraboloiden überdecken die Säle. Sie bestehen aus einer Holzfachwerkkonstruktion und sind aussen mit Stahlblech überzogen. In die Höhe gezogen und auf der sonnenabgewandten Seite verglast, dienen sie zugleich der Belichtung. Die sich aufgipfelnde Dachlandschaft mag an Haifischflossen erinnern. Richard Rogers war indes laut eigenem Bekunden von den Segelschiffen auf den Seestücken des niederländischen Barock inspiriert. So kann man auch den neuen Gerichtshof als eine Hommage an die neu zu entdeckende maritime Tradition der Scheldestadt verstehen.
Für den Beitrag verantwortlich: Neue Zürcher Zeitung
Ansprechpartner:in für diese Seite: nextroom






