Artikel
Von der Katastrophe zur neuen Identität
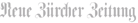
Das neu erstandene Roombeek-Quartier in Enschede
Das Areal einer ehemaligen Textilfabrik in Enschede wurde vom Amsterdamer Architekturbüro SeARCH in einen «Cultuurcluster» verwandelt. Dieser fungiert als Kristallisationspunkt für den nach dem Explosionsunglück des Jahres 2000 neu erstandenen Stadtteil Roombeek.
27. Mai 2008 - Hubertus Adam
Mehrfach ereilte das Unglück Enschede. Im Jahre 1862 zerstörte ein Grossbrand das historische Zentrum der niederländischen Stadt, die damals für ihre blühende Textilindustrie bekannt war. Im Zweiten Weltkrieg bombardierten alliierte Flieger irrtümlich die an der Grenze zu Deutschland gelegene Stadt; und die jüngste Katastrophe ereignete sich am 13. Mai 2000: Die Explosion der Feuerwerkfabrik S. E. Fireworks forderte 23 Tote und gegen 1000 Verletzte. Gut 600 Wohnungen wurden zerstört, und ein ganzes Stadtquartier lag in Trümmern.
Wer nun in diesen Tagen die mehr als 150 000 Einwohner zählende Stadt besucht, liest überall den Slogan «Enschede lebt auf». Kurz nach der verheerenden Zerstörung hatte die Stadt in der Region Twente mit dem Wiederaufbau begonnen. Das Entwicklungsgebiet im Stadtteil Roombeek, der sich nördlich des Hauptbahnhofs und damit auf der von der Innenstadt abgewandten Seite befindet, umfasst eine Fläche von 65 Hektaren, von der zwei Drittel von der Explosion betroffen waren.
Postindustrieller Strukturwandel
Bei der Bebauung des Roombeek-Quartiers ging es allerdings nicht allein darum, die Folgen der Katastrophe zu beseitigen, sondern zugleich um die Schaffung eines neuen Images für die Stadt. Mit der Unabhängigkeit der früheren Kolonien, von woher man die Rohstoffe bezogen hatte, war die Textilindustrie in die Krise geraten; das Sterben der Fabriken beschleunigte sich in den sechziger Jahren, weil einheimische Produkte auf dem Weltmarkt nicht mehr konkurrenzfähig waren. Die ambitionierte Gestaltung des neuen Viertels ist mithin auch Indikator für den Willen, das Bild einer grauen, vom postindustriellen Transformationsprozess gebeutelten und überdies weit von der prosperierenden «Randstad» zwischen Amsterdam und Rotterdam entfernt gelegenen Stadt hinter sich zu lassen.
Für Roombeek entwarf Pi de Bruijn vom Amsterdamer Büro de Architecten Cie. einen Masterplan, der auf Heterogenität und eine Differenzierung des Angebots setzt. Insgesamt 1350 Wohnungen sind neu entstanden oder im Entstehen begriffen, ein Drittel davon als Mietwohnungen. Daneben weist das neue Quartier all das auf, was man sich für eine funktionierende Stadterweiterung wünscht: kulturelle Angebote, Geschäfte und soziale Einrichtungen. Als ein Wahrzeichen von Roombeek fungiert der «Zorgcluster» der Amsterdamer Architekten Claus en Kaan, ein mit umlaufenden Balkonen versehenes und entfernt an Gestaltungsprinzipien von Erich Mendelsohn erinnerndes Hochhaus, das im Erdgeschoss Arztpraxen und Gesundheitseinrichtungen, in den Ebenen darüber Wohnungen für geistig Behinderte birgt.
Ausgangspunkt für die Stadterweiterung aber ist das Rijksmuseum Twenthe, dessen erstaunliche Kunstsammlungen vor allem der Textilfabrikantenfamilie van Heek zu verdanken sind. 1930 wurde der mehrfach erweiterte Ursprungsbau eröffnet; die letzte Ergänzung realisierte Ben van Berkel gemeinsam mit dem Landschaftsarchitekten Lodewijk Balion zwischen 1994 und 1996. Die als Fussgängerpromenade Richtung Nordwesten verlaufende Museumslaan, an der prominente Architekten wie Benthem Crouwel, Erick van Egeraat und Bolles + Wilson luxuriöse Villen errichtet haben, verbindet das Rijksmuseum Twenthe mit dem Rozendaal-Komplex, der als «Cultuurcluster» den eigentlichen Angelpunkt des neuen Quartiers darstellt.
Die Mitte des 19. Jahrhunderts gegründete Textilfabrik I. I. Rozendaal bezog 1907 ihren neuen Produktionsstandort im Stadtviertel Roombeek. 1995 schloss sie als eine der letzten ihrer Art in Enschede die Pforten; von der Explosionskatastrophe wurden die Baulichkeiten vergleichsweise wenig betroffen. Der Wiederaufbau des Quartiers eröffnete allerdings die Möglichkeit, die ausgedehnten Hallen umzunutzen. Twentse Welle heisst das Museum, das seit der Eröffnung Ende April die neue Attraktion von Enschede darstellt. Dabei handelt es sich um den Zusammenschluss dreier bisher über die Stadt verstreuter Institutionen: des Naturkundemuseums, des auf die Textilgeschichte konzentrierten Museums Jannink und des Van-Deinse-Instituts mit seinen heimatkundlichen Sammlungen.
Twentse Welle
Bjarne Mastenbroek, Leiter des in Amsterdam ansässigen Büros SeARCH und einer der wichtigsten Vertreter der jüngeren niederländischen Architektengeneration, hat die Hallen auf der Ostseite des Areals in ihrem ursprünglichen Erscheinungsbild erhalten, während die keilartige Formation der Gebäude im Westen bis auf die äussere Umfassungsmauer abgerissen wurde. An ihrer Stelle sind eine Reihe neuer, skulptural geprägter Bauten entstanden, darunter einige expressive Apartmenthäuser und ein bandförmiges, mit Backstein verkleidetes Gebilde mit Ateliers, in dessen Erdgeschoss sich die Sonderausstellungsräume der Twentse Welle befinden.
Die vertikale Dominante des Gesamtkomplexes bildet ein mit Metallnetzen umhüllter Turm für die Verwaltung, der zugleich den Haupteingang des Museums markiert. Die Besucher gelangen zunächst in ein mit sichelförmigen Elementen überdachtes Foyer und von dort unterirdisch in die grosse Halle des Museums. Das für die Ausstellungsgestaltung verantwortliche Amsterdamer Team Opera hat über die gesamte Länge von mehr als 110 Metern eine 6 Meter hohe gläserne Regalvitrine installiert, in der die Sammlungen gleichsam wie in einem Schaudepot ausgestellt sind.
Von der urzeitlichen Tierwelt spannt sich der Bogen über die Wohnkultur des Mittelalters und die Industriegeschichte der Region bis hin zur Gegenwart. Auf Screens können Informationen zu den Exponaten abgerufen werden, installative Objektarrangements in der zentralen Achse führen in die einzelnen Themenbereiche ein. Regionalgeschichtliche Sammlungen in einer neuen, frischen Form zu präsentieren, das ist hier durchaus gelungen. Über einen signalroten Stahlsteg, der die Halle quert, und über eine Brücke gelangt man zurück ins Foyer und zum Ausgang; in einem benachbarten, ebenfalls von SeARCH umgebauten Altbau hat die lokale Kulturinstitution Concordia unter dem Titel «21 Rozendaal» neue Flächen für die Präsentation zeitgenössischer Kunst bezogen.
Eine kleine Broschüre des Architekturzentrums Twente lädt zu einer gut vier Kilometer langen Tour zu allen wichtigen Bauten in Roombeek ein. Doch auch eine Reihe älterer Bauten in Enschede lohnen den Besuch. Dazu zählt vor allem der Campus der TU am nordwestlichen Stadtrand, der zu Beginn der sechziger Jahre als Manifestation eines strukturalistischen Bauens realisiert wurde. Und in der Innenstadt befindet sich die unlängst restaurierte Synagoge, ein Meisterwerk des Architekten K. P. C. de Bazel aus dem Jahr 1928.
[ Ausstellungen: «De Kracht van de Quilt» in den Sonderausstellungsräumen der Twentse Welle dauert bis 1. September; «Pjotr Müller» in 21 Rozendaal bis 29. Juni. Der Führer zur Architektur in Roombeek steht als Download im Internet bereit: http://www.architectuurcentrumtwente.nl/publicaties/index. ]
Wer nun in diesen Tagen die mehr als 150 000 Einwohner zählende Stadt besucht, liest überall den Slogan «Enschede lebt auf». Kurz nach der verheerenden Zerstörung hatte die Stadt in der Region Twente mit dem Wiederaufbau begonnen. Das Entwicklungsgebiet im Stadtteil Roombeek, der sich nördlich des Hauptbahnhofs und damit auf der von der Innenstadt abgewandten Seite befindet, umfasst eine Fläche von 65 Hektaren, von der zwei Drittel von der Explosion betroffen waren.
Postindustrieller Strukturwandel
Bei der Bebauung des Roombeek-Quartiers ging es allerdings nicht allein darum, die Folgen der Katastrophe zu beseitigen, sondern zugleich um die Schaffung eines neuen Images für die Stadt. Mit der Unabhängigkeit der früheren Kolonien, von woher man die Rohstoffe bezogen hatte, war die Textilindustrie in die Krise geraten; das Sterben der Fabriken beschleunigte sich in den sechziger Jahren, weil einheimische Produkte auf dem Weltmarkt nicht mehr konkurrenzfähig waren. Die ambitionierte Gestaltung des neuen Viertels ist mithin auch Indikator für den Willen, das Bild einer grauen, vom postindustriellen Transformationsprozess gebeutelten und überdies weit von der prosperierenden «Randstad» zwischen Amsterdam und Rotterdam entfernt gelegenen Stadt hinter sich zu lassen.
Für Roombeek entwarf Pi de Bruijn vom Amsterdamer Büro de Architecten Cie. einen Masterplan, der auf Heterogenität und eine Differenzierung des Angebots setzt. Insgesamt 1350 Wohnungen sind neu entstanden oder im Entstehen begriffen, ein Drittel davon als Mietwohnungen. Daneben weist das neue Quartier all das auf, was man sich für eine funktionierende Stadterweiterung wünscht: kulturelle Angebote, Geschäfte und soziale Einrichtungen. Als ein Wahrzeichen von Roombeek fungiert der «Zorgcluster» der Amsterdamer Architekten Claus en Kaan, ein mit umlaufenden Balkonen versehenes und entfernt an Gestaltungsprinzipien von Erich Mendelsohn erinnerndes Hochhaus, das im Erdgeschoss Arztpraxen und Gesundheitseinrichtungen, in den Ebenen darüber Wohnungen für geistig Behinderte birgt.
Ausgangspunkt für die Stadterweiterung aber ist das Rijksmuseum Twenthe, dessen erstaunliche Kunstsammlungen vor allem der Textilfabrikantenfamilie van Heek zu verdanken sind. 1930 wurde der mehrfach erweiterte Ursprungsbau eröffnet; die letzte Ergänzung realisierte Ben van Berkel gemeinsam mit dem Landschaftsarchitekten Lodewijk Balion zwischen 1994 und 1996. Die als Fussgängerpromenade Richtung Nordwesten verlaufende Museumslaan, an der prominente Architekten wie Benthem Crouwel, Erick van Egeraat und Bolles + Wilson luxuriöse Villen errichtet haben, verbindet das Rijksmuseum Twenthe mit dem Rozendaal-Komplex, der als «Cultuurcluster» den eigentlichen Angelpunkt des neuen Quartiers darstellt.
Die Mitte des 19. Jahrhunderts gegründete Textilfabrik I. I. Rozendaal bezog 1907 ihren neuen Produktionsstandort im Stadtviertel Roombeek. 1995 schloss sie als eine der letzten ihrer Art in Enschede die Pforten; von der Explosionskatastrophe wurden die Baulichkeiten vergleichsweise wenig betroffen. Der Wiederaufbau des Quartiers eröffnete allerdings die Möglichkeit, die ausgedehnten Hallen umzunutzen. Twentse Welle heisst das Museum, das seit der Eröffnung Ende April die neue Attraktion von Enschede darstellt. Dabei handelt es sich um den Zusammenschluss dreier bisher über die Stadt verstreuter Institutionen: des Naturkundemuseums, des auf die Textilgeschichte konzentrierten Museums Jannink und des Van-Deinse-Instituts mit seinen heimatkundlichen Sammlungen.
Twentse Welle
Bjarne Mastenbroek, Leiter des in Amsterdam ansässigen Büros SeARCH und einer der wichtigsten Vertreter der jüngeren niederländischen Architektengeneration, hat die Hallen auf der Ostseite des Areals in ihrem ursprünglichen Erscheinungsbild erhalten, während die keilartige Formation der Gebäude im Westen bis auf die äussere Umfassungsmauer abgerissen wurde. An ihrer Stelle sind eine Reihe neuer, skulptural geprägter Bauten entstanden, darunter einige expressive Apartmenthäuser und ein bandförmiges, mit Backstein verkleidetes Gebilde mit Ateliers, in dessen Erdgeschoss sich die Sonderausstellungsräume der Twentse Welle befinden.
Die vertikale Dominante des Gesamtkomplexes bildet ein mit Metallnetzen umhüllter Turm für die Verwaltung, der zugleich den Haupteingang des Museums markiert. Die Besucher gelangen zunächst in ein mit sichelförmigen Elementen überdachtes Foyer und von dort unterirdisch in die grosse Halle des Museums. Das für die Ausstellungsgestaltung verantwortliche Amsterdamer Team Opera hat über die gesamte Länge von mehr als 110 Metern eine 6 Meter hohe gläserne Regalvitrine installiert, in der die Sammlungen gleichsam wie in einem Schaudepot ausgestellt sind.
Von der urzeitlichen Tierwelt spannt sich der Bogen über die Wohnkultur des Mittelalters und die Industriegeschichte der Region bis hin zur Gegenwart. Auf Screens können Informationen zu den Exponaten abgerufen werden, installative Objektarrangements in der zentralen Achse führen in die einzelnen Themenbereiche ein. Regionalgeschichtliche Sammlungen in einer neuen, frischen Form zu präsentieren, das ist hier durchaus gelungen. Über einen signalroten Stahlsteg, der die Halle quert, und über eine Brücke gelangt man zurück ins Foyer und zum Ausgang; in einem benachbarten, ebenfalls von SeARCH umgebauten Altbau hat die lokale Kulturinstitution Concordia unter dem Titel «21 Rozendaal» neue Flächen für die Präsentation zeitgenössischer Kunst bezogen.
Eine kleine Broschüre des Architekturzentrums Twente lädt zu einer gut vier Kilometer langen Tour zu allen wichtigen Bauten in Roombeek ein. Doch auch eine Reihe älterer Bauten in Enschede lohnen den Besuch. Dazu zählt vor allem der Campus der TU am nordwestlichen Stadtrand, der zu Beginn der sechziger Jahre als Manifestation eines strukturalistischen Bauens realisiert wurde. Und in der Innenstadt befindet sich die unlängst restaurierte Synagoge, ein Meisterwerk des Architekten K. P. C. de Bazel aus dem Jahr 1928.
[ Ausstellungen: «De Kracht van de Quilt» in den Sonderausstellungsräumen der Twentse Welle dauert bis 1. September; «Pjotr Müller» in 21 Rozendaal bis 29. Juni. Der Führer zur Architektur in Roombeek steht als Download im Internet bereit: http://www.architectuurcentrumtwente.nl/publicaties/index. ]
Für den Beitrag verantwortlich: Neue Zürcher Zeitung
Ansprechpartner:in für diese Seite: nextroom






