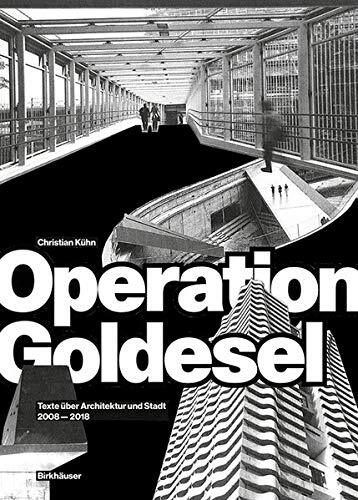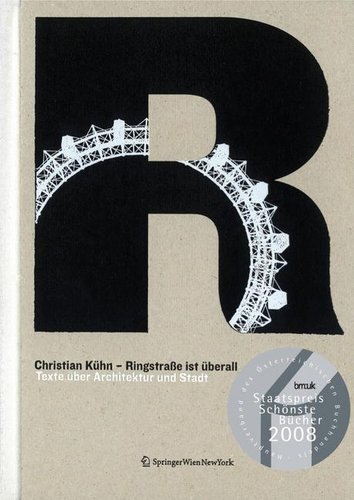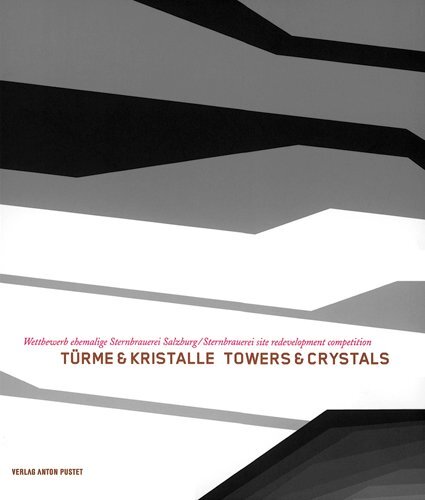Das Dach des neuen Wiener Naschmarkts schaut aus wie von der KI geplant
Der Wiener Naschmarkt hat ein neues Entree erhalten, das gleichzeitig öffentliches Wohnzimmer, Aussichtsplattform und Durchhaus sein will. Architektonisch ist es kein Meisterwerk. Als Zentrum einer neuen Esskultur könnte es den Naschmarkt aber beleben.
Sie galt als das Lieblingsprojekt der nach der Wien-Wahl 2020 vom Umwelt- ins Planungsressort gewechselten Stadträtin Ulli Sima: eine Markthalle in Verlängerung des Naschmarkts. Als Vorbild sollte der Londoner Borough Market dienen, ein passagenartig mit Glasdächern überdeckter Markt, der Platz 15 im Tripadvisor-Ranking der größten Sehenswürdigkeiten der Stadt einnimmt und zugleich ein kulinarisches wie soziales Zentrum für die Londoner ist.
Zum Verhängnis wurde dem Projekt, dass Ulli Sima bereits im Oktober 2020 mit Visualisierungen an die Öffentlichkeit trat, die den Eindruck einer fortgeschrittenen Planung erweckten. Das erregte den Unmut der Anrainer, die sich nicht einbezogen fühlten, während ein technischer Blick auf die Visualisierungen zum Vorschein brachte, dass es sich um völlig unausgegorene Ideen handelte. Was folgte, war eine Fülle von Studien, Bürgerbeteiligungen und kooperativen Verfahren, deren Ergebnisse in einen offenen Architekturwettbewerb eingespeist wurden, der unter dem Titel „Zwischen den Wienzeilen“ 2023 stattfand.
Repräsentatives Entree
Das lang gestreckte, dem eingewölbten Wienfluss folgende Planungsgebiet umfasst drei Teilbereiche: erstens einen Parkplatz, der – beginnend auf der Höhe des Cafés Rüdigerhof – in einen grünen Park, den „Naschpark“, umgestaltet werden sollte, zweitens das asphaltierte Areal, auf dem samstags der Flohmarkt stattfindet und das unter der Woche als Begegnungszone zwischen parkenden Autos und „kreativen Nutzungen“ fungieren soll, und drittens der Bereich gegenüber der von Otto Wagner geplanten U-Bahn-Station Kettenbrückengasse, eine asphaltierte Fläche, heute genutzt als Bauernmarkt mit offenen Ständen, der erhalten bleiben und zugleich den Hintergrund für ein neues, repräsentatives Entree für den Naschmarkt bilden sollte.
Wie das gelingen könnte, erschloss sich aus der Ausschreibung des Wettbewerbs nur, wenn man tatsächlich „zwischen den Zeilen“ las. Die Markthallen-Idee war dort nämlich nicht komplett verschwunden, sondern tauchte unter einer neuen Formulierung wieder auf, als „bauliche Interventionen für den Verkauf regionaler Produkte mit maximal 1000 m² Nutzfläche“. Diese Interventionen sollten „das Entree in den Naschmarkt dem historischen Umfeld entsprechend neu formen“, wobei der Bauernmarkt verschoben, aber in seiner Nutzfläche nicht geschmälert werden durfte. Das historische Umfeld umfasst unter anderem die Wienzeilenhäuser von Otto Wagner, zwei Meilensteine der modernen Architektur.
Sieger des Wettbewerbs unter dem Vorsitz von Albert Wimmer, der sich wegen einer zusätzlichen Überarbeitungsphase über fast ein Jahr erstreckte, waren das Büro Mostlikely und DnD Landschaftsplanung. Der neue „Naschpark“ wurde bereits im September eröffnet und ist für die Anrainer eine enorme Bereicherung. Auch wenn aufgrund der Lage über der Wienfluss-Einwölbung nur wenige große Bäume gepflanzt werden konnten, gelingt DnD mit kleineren Formaten eine abwechslungsreiche Zonierung des Grünraums, die auch allgemein geschätzt wird. Auf die neue Markthalle, die nicht mehr so heißen darf und unter dem Namen „Marktraum“ gebranded wird, trifft das nicht zu. Schon nach der Veröffentlichung der Wettbewerbsergebnisse dominierten die kritischen Stimmen: Die Halle sei zu groß und sie sitze wie ein Pfropfen genau an der Stelle, an der es eigentlich den meisten Durchfluss geben sollte. Beide Kritikpunkte haben sich zumindest teilweise bestätigt. Tatsächlich nimmt der Neubau eher Maß an den gemauerten größeren Nachbarn wie dem Marktamt oder der Stadtbahnstation und nicht an den bestehenden Marktgebäuden, die sich ursprünglich nicht als Gebäude verstanden, sondern als ungedämmte Verschläge mit charakteristischen, leicht gekurvten Dächern.
Leicht chaotisches Konglomerat
Dieser Maßstabssprung ist insofern nicht störend, als der Marktraum als leichte Stahlkonstruktion mit klarem Raster konzipiert ist. Die Wände nach außen sind größtenteils verglast und lassen sich wegschieben oder -falten. Das leicht chaotische Konglomerat aus historischen Marktständen und den beweglichen Ständen des Bauernmarkts wird so um ein flexibel bespielbares Gerüst ergänzt. Im Inneren gibt es hier neben den zwölf Handelsbetrieben nur einen dezent gestalteten Gastrobetrieb und im Zentrum, leicht aus der Achse versetzt, eine „lange Tafel“ mit abgerundeten Ecken, die zum konsumfreien Verweilen einladen soll. Dass die Mehrheit der dort Sitzenden trotzdem konsumieren, nämlich ihre gerade erworbenen Viktualien, ist ein nicht aufzulösendes Paradoxon. Schwerer wiegt der Vorwurf, dass der Neubau den Durchstrom von Personen, aber auch von frischer Luft durch das Wiental beeinträchtigen würde. Zumindest, was die Personen betrifft, ist untertags durch schnell öffnende Schiebetüren für Durchfluss gesorgt. Nach Betriebsschluss wird die Halle allerdings gesperrt, und das ist für die Verkaufsstände um 18 Uhr, für den Gastrobetrieb um 18.30 Uhr. Ab 19 Uhr ist durch die Halle kein Durchkommen mehr, und die Passanten müssen außen um den Neubau herumgehen. Der Komfort, alle Marktstände klimatisiert in einem Hallenraum unterzubringen, wird damit teuer bezahlt.
Es wäre auch anders gegangen
Dass es auch anders gegangen wäre, zeigen die Projekte, die im Wettbewerb den zweiten und den dritten Rang erreicht haben. Das zweitgereihte Projekt von VlayStreeruwitz arbeitet im Bereich des Bauernmarkts generell mit leichten Flugdächern als Grundelement. Das drittgereihte von Patrick Pregesbauer entwickelt die Typologie der historischen Marktstände weiter und markiert mit einer leicht abgewandelten Dachform den Auftakt des Markts. In diesem Projekt hätte es genug Innenräume für soziale und kulturelle Nutzung gegeben, ohne den Zustrom baulich zu versperren.
Bleibt die Frage der begrünten, begehbaren Dachterrasse. Man hat von hier einen schönen Blick auf die Dächer der Marktstände, die wie große, kieloben treibende Boote aussehen. Gestalterisch folgt die Terrasse einer Ästhetik der abgerundeten Ecken, die Mostlikely schon bei früheren Projekten wie dem Restaurant am Cobenzl oder der Freiraumgestaltung Pier 22 auf der Donauinsel benutzt haben. Die Ergebnisse sehen aus, als hätte eine KI auf die Stichworte „Dachterrasse“, „grüne Architektur“ und „alle Ecken abrunden“ reagiert. Zumindest gibt es eine nach Westen orientierte lange Bank, auf der man in den Sonnenuntergang blicken kann. Und sich vielleicht daran erinnert, dass diese Stadt vor 20 Jahren noch geplant hat, öffentliche Räume, etwa am Gürtel, mit Künstlern wie Vito Acconci zu gestalten.