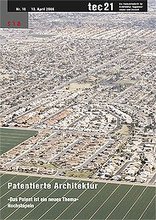Zeitschrift
tec21 2006|16
Patentierte Architektur

«Das Patent ist ein neues Thema»
Der Architekt Hans Zwimpfer hat erstmals in der Schweiz ein Patent für ein Architekturkonzept angemeldet. Bisher wurde dieses Vorgehen nur für Elementhäuser angewendet, deren Konstruktionweise geschützt werden sollte. Wie kam es dazu? Ist das freie Entwerfen in Gefahr? Was bedeutet das für den Architekturwettbewerb? Auslöser für das Gespräch – aber nicht Thema – war auch, dass Hans Zwimpfer einem Architekturbüro vorwirft, in einem Wohnbauwettbewerb sein geschütztes Konzept kopiert zu haben.
13. April 2006 - Ivo Bösch
Klaus Fischli: Mit dem Urheberrecht beschäftigen wir uns schon lange. Doch das Patent ist für uns in der Wettbewerbskommision SIA 142 ein neues Thema. Es erstaunte uns, dass ein Architekturkonzept geschützt werden kann. Mir ist noch nicht klar, was den Patentschutz so attraktiv macht.
Andreas J. Maier: Das Urheberrecht besitzt jeder, sobald er eine Idee in eine Form gebracht hat. Man erhält es also automatisch. Wenn jemand mein Urheberrecht verletzt, so muss ich beweisen, dass ich der Urheber bin. Wenn ich aber ein Design oder ein Patent angemeldet habe, dann erhalte ich von Amtes wegen eine Verbriefung, dass ich als Erster eine Idee hatte. Der Vorteil und die Grundidee des Schutzrechtes liegen in dieser Beweisumkehrung. Wenn nun etwas geschaffen wird, das meinem Patent entspricht, so wird mein Patent verletzt. Ob die betreffende Person das gewusst hat, spielt keine Rolle mehr. Seine Ansprüche muss der Patentinhaber trotzdem noch geltend machen.
Bruno Trinkler: Als ein Vertreter der Wettbewerbskommission muss ich doch Bedenken anmelden. Müssen wir als Preisrichter bei den vielen Projekten, die wir jeweils zu beurteilen haben, in Zukunft erkennen, ob ein Projekt patentrechtlich geschützt ist? Ich hatte schon Schwierigkeiten, mich in die Patentschrift von ‹Pile up› einzulesen.
Andreas J. Maier: Eine Patentanmeldung ist tatsächlich etwas komplizierter, weil man sie ausformulieren muss. Es genügt nicht – wie bei einer Designanmeldung –, eine Ansicht zu zeigen. Als Hans Zwimpfer mich anfragte, habe ich zuerst in der Patentliteratur nachgeschlagen, was es schon gibt, und danach das architektonische Konzept in Worte gefasst. Mit der Einreichung des Patentes beginnt ein langes Prozedere. Das heisst, das Europäische Patentamt prüft es zuerst auf Neuheit. Ist die Idee nicht schon bekannt? Weiter muss eine erfinderische Tätigkeit gegeben sein – da stellt man sich die Frage, ob die Erfindung nicht heute im Markt selbstverständlich ist. Als Drittes wird geprüft, ob das System wirtschaftlich anwendbar ist. Diese drei Punkte sind fürs Patent entscheidend.
Jürg Gasche: Mich interessiert der berufliche Hintergrund des Prüfers beim Europäischen Patentamt, denn zum Beispiel für mich als Architekturlaie wäre vieles neu am ‹Pile up›.
Andreas J. Maier: Ein Fachmann ist dabei. Wenn es um Architektur geht, wird ein Architekt dabei sein. Bei uns hat der Rechercheur in der Patentliteratur zwei amerikanische Patentschriften gefunden und sie mit unserem Antrag verglichen und festgestellt, dass unsere Idee dem Stand der Technik entspricht, dass sie neu und erfinderisch ist. Aufgrund dieser Prüfung erteilte das Europäische Patentamt die Schutzschrift. Eine objektiv unabhängige Behörde hat demnach beurteilt, dass das nun unsere Erfindung ist.
Hans Zwimpfer: Interessant ist vielleicht, zu sehen, warum ich überhaupt das ‹Pile up› geschützt habe. Vor vier Jahren wollte ich ein kritisches Buch schreiben über den Städtebau, weil ich seit 50 Jahren unzufrieden bin mit der Zersiedlung in Mitteleuropa, mit diesem ‹Urban Sprawl›, der von Amerika zurück nach Europa gelangt. Doch es gibt schon viele Bücher – Avenir Suisse und das ETH-Studio Basel haben schon grosse Bücher herausgegeben, in denen sie die ganze Schweiz neu planen. Schliesslich habe ich mich entschieden, zuunterst anzufangen, beim Wohnen. Dem ‹Hüsli-Bauen› wollte ich eine neue Form des Wohnens entgegenstellen. Und wer hat mich nun auf diesen quasi merkantilen Weg gebracht? Als ich im März vor zwei Jahren meinen beiden Verwaltungsräten Peter Rechsteiner, 1992–1997 Leiter der Rechtsabteilung beim SIA, und dem SIA-Präsidenten Daniel Kündig mein neues Konzept vorstellte, haben sie mir geraten, es gleich patentieren zu lassen. Falls ich mit ihm auf den Markt käme, sagten sie, würde die Idee sofort kopiert.
Klaus Fischli: Für die auch stapelbaren Wohntypen von Le Corbusier lässt sich wahrscheinlich kein Patent finden. Er besass demnach ‹nur› das Urheberrecht. Seine Ideen wären heute sowieso nicht mehr patentierbar, weil sie allgemein bekannt sind. Damit ist eine Bedingung für ein Patent nicht mehr erfüllt. Ich denke, wir sind uns einig, dass es nicht ums Kopieren geht, sondern es gehört zu unserer Arbeitsmethode, dass wir uns Anregungen aus Beispielen holen.
Tina Puffert: Die einzelnen Merkmale von ‹Pile up› sind sicherlich schon mal gebaut worden, nicht aber die Kombination dieser Elemente. Die Maisonette-Wohnung von Le Corbusier ist eine tolle Idee, aber in einer Zeit, in der immer mehr alte Leute eine Wohnung suchen, ist eine Wohnung auf zwei Geschossen unpraktisch. Der hohe Raum ist beim ‹Pile up› aus einer andern Motivation entstanden. Es zeigt unsere heutige Haltung zum zeitgenössischen Wohnen – eine Möglichkeit mindestens. Es gibt bestimmt noch viele andere Möglichkeiten, wie man schön wohnen kann. Das ‹Pile up› ist ein System, in dem die räumliche Idee wiederholt und an jedes neue Grundstück individuell angepasst wird. Innerhalb jedes Projektes haben wir eine extreme soziologische Gleichstellung: Die Wohnungen sind alle gleich konzipiert, es gibt keine Dachgärten, keine Gärten im Erdgeschoss. Es ist eine Systematik, die durchgezogen wird.
Andreas J. Maier: Und ganz konkret gesprochen: Ob das Patentierte neu ist oder nicht, liegt jenseits unserer Beurteilung. Das hat der Prüfer vom Europäischen Patentamt schon beschlossen…
Bruno Trinkler: Ich habe einen grossen Respekt vor der geleisteten Arbeit. Die immense Erfahrung des Büros Zwimpfer erkennt man im Projekt. Ein Unbehagen bleibt mir aber. Versetzen Sie sich mal in jemanden, der noch nicht diese Erfahrung aufweisen kann. Ich bin der Meinung, dass auch jüngere Leute ihre Versuche machen sollten auf diesen Gebieten. Wenn sie aber durch solche doch sehr offen gefassten Patentschriften behindert werden – das Patent von Hans Zwimpfer könnte nur das erste von vielen sein –, so blockiert man doch ein Feld von Entwicklungen.
Klaus Fischli: Wenn ich das ‹Pile up› richtig verstanden habe, geht es vor allem um das räumliche Konzept, das patentiert ist, also um diese Stapelung der Wohneinheiten nach einem bestimmten System.
Hans Zwimpfer: Gestapelte Wohnungen heisst für mich gestapelte Einfamilienhäuser. Das Wesentliche ist, dass jede Wohnung grosszügig ist, also nicht nur das oberste Geschoss eines Wohnhauses. Wichtig war mir, dass es auf verschiedenste Gebäudeformen anwendbar ist. Man kann es in allen städtebaulichen Bauformen realisieren.
Andreas J. Maier: Die Grundidee des ‹Pile up› liegt in der inneren flexiblen Struktur. In der Patentschrift steht dazu, dass die Wohneinheiten individuell anpassbare Wohnflächen besitzen. Sie müssen gestapelt sein. Entscheidend für das Patent ist, dass jede Wohnung aus einem eingeschossigen Wohnungsteil und einem zweigeschossigen Wohnungsteil mit einem zweigeschossigen Aussenraum besteht. Die Fläche des eingeschossigen Wohnungsteils muss dabei mindestens so gross sein wie die des zweigeschossigen. In allen Wohnungen muss jeweils der zweigeschossige Wohnungsteil dieselbe Grundfläche aufweisen, und die eingeschossigen Wohnungsteile müssen übereinander liegen.
Bruno Trinkler: Die Themen der Zersiedelung und des Wohnungsbaus bewegen uns als Architekten schon seit Jahren und haben uns immer wieder zu Versuchen veranlasst – in Wettbewerben oder im ‹normalen› Wohnungsbau. Wir operieren häufig mit zweigeschossigen Räumen in Wohnungen – hie und da auch mit einem zweigeschossigen Aussenraum. Und besteht nicht jedes Mehrfamilienhaus aus gestapelten Wohnungen? Muss ich nun jedes Mal, wenn ich eine solche Wohnung entwerfe, Hans Zwimpfer fragen, ob er diesen Typ schon geschützt hat, und wenn nicht, könnte ich ihn anmelden?
Andreas J. Maier: Es geht nicht nur um ein Stapeln der Wohnungen. Die Bilder in der Patentschrift beschreiben, wie das System der Stapelung konkret funktioniert. Allgemein bin ich der Meinung, dass der «Versicherungsaspekt» nur eine Ebene des Patentes ist, die andere Ebene ist die strategische. Da ist für die Architekten ein Feld, das noch nicht erkannt wurde. Andere Industrien setzen das Schutzrecht schon lange gegen Konkurrenz ein. Dabei geht es um die gegenseitige Aufschaukelung der Innovation. Die Umgehung eines Patentes schafft wieder Kreativität. Im Maschinenbau beispielsweise werden Patente als strategische Mittel eingesetzt. Ich denke, wir werden – weil Amerika Vorreiter ist – in Europa auch in der Architektur häufiger mit Schutzrechten, sprich mit Design und Patent, konfrontiert sein. Und grundsätzlich müsste ein Architekt tatsächlich bei einem neu entworfenen Haus sich überlegen, ob er ein Patent verletzt. Jeder Ingenieur muss sich diese Frage stellen, jeder, der technisch tätig ist.
Hans Zwimpfer: Hier habe ich ein Buch von Le Corbusier. Bevor ich die Idee patentieren liess, habe ich darin nachgesehen. Ich habe in der klassischen Moderne gesucht, bei den Holländern, bei den Engländern. Mir ist bis jetzt kein Vorgängerbeispiel bekannt. Zusammen mit Timothy Nissen habe ich schon in seinen Büchern gesucht. Und kürzlich sagte Kurt Aellen zu mir, Le Corbusier sei beim Pavillon de l’Esprit Nouveau, der nur als Musterhaus gebaut wurde, stehen geblieben, und ich hätte ihn nun weiterentwickelt. Mein Traum ist übrigens, die Immeuble-Villa mal noch zu bauen, weil ich es als eine Schande betrachte, dass das Gebäude nie gebaut wurde. Ich will mich als älterer Architekt nicht blamieren. Deshalb habe ich die ganze Literatur durchsucht und viele Leute gefragt, ob sie so was wie das ‹Pile up› nicht schon gesehen haben. Ich glaube aber auch, dass jede Idee ihre Vorläufer hat.
Jürg Gasche: Hans Zwimpfer hat gesagt, dass ihn die Zersiedelung unseres Territoriums stört. Ich frage mich – vielleicht auf einer philosophischen Ebene –, ob mit dem Trend zur Patentierung nicht auch eine Zersiedelung der geistigen Landschaft entsteht. Andreas J. Maier sieht das optimistisch und glaubt an zusätzliche Kreativität. Unsere Panzersperren oder die Stadtmauern mussten auch irgendwann geschleift werden. Ich befürchte eine Behinderung von Entwicklungen. Segeln die Architekten in Zukunft nicht in einem Gebiet voller Riffe, die nur auf den Patentämtern kartografiert sind?
Tina Puffert: Dass das Patent für uns alle in der Architektur ein neues Thema ist, bezweifelt niemand. Die Motivation, so etwas zu tun, ist, eine solche Systematik überhaupt mal zu formulieren. Mit diesem systematischen Ansatz arbeiten Architekten selbst im Wohnungsbau relativ selten.
Bruno Trinkler: Da muss ich widersprechen. Dass im Wohnungsbau nicht systematisch gearbeitet wird, stelle ich klar in Abrede – wenn wir denn von Architektur reden und nicht von irgendwelchen «Bauereien». Für die engagierte Architekturgilde mindestens reklamiere ich, dass sie systematisch arbeitet.
Tina Puffert: Ich will keinem Architekten vorwerfen, dass er nicht systematisch arbeitet. Mir geht es darum, dass für einzelne Probleme im Wohnungsbau ein System erarbeitet werden kann – also für etwas, das wiederholt und an mehreren Orten angewendet werden kann. Etwas so weit zu formulieren, dass man es patentieren lassen kann, dazu gehört eine andere Systematik und ein gewisser Ehrgeiz. Architekten könnten sich doch motiviert fühlen, wiederkehrende Problemlösungen oder bestimmte Arbeitsschritte, die sie immer wieder tun, patentieren zu lassen. Nur weil es in der Architektur noch nicht üblich ist, heisst nicht, dass es nicht eine Chance für den Markt wäre. Den Architekten geht es im Moment nicht besonders gut. Vielleicht ist die Patentierung eine Chance, anders wirtschaftlich zu denken. Man könnte sich angestachelt fühlen, Lösungen für grundsätzliche Probleme zu finden und nicht jedes Mal individuell für ein Grundstück zu entwerfen. ‹Pile up› ist nicht nur ein Projekt, ‹Pile up› sind im Moment fünf Projekte. In zwei Fällen sind wir inzwischen auch sehr erfolgreich im Verkauf.
Jürg Gasche: Das heisst, es kann durchaus attraktiv sein, ein Konzept patentieren zu lassen, wenn man die entsprechenden Vermarktungsmöglichkeiten besitzt. Für ein junges Büros, das keinen Zugang zu solchen Kanälen hat und sich vor allem in Wettbewerben profilieren möchte, ist es möglicherweise viel weniger attraktiv.
Tina Puffert: Das stimmt sicherlich, und das ist vielleicht auch ein kritischer Punkt. Aber in Deutschland zum Beispiel funktioniert das Wettbewerbssystem schon lange nicht mehr. In Baden-Württemberg soll es so viele Architekturbüros geben wie in ganz Frankreich. Das sind zu viele, als dass die Einzelnen eine Überlebenschance hätten. Als Alternative könnten doch junge Büros ein Idee entwickeln, die sie patentieren lassen und verkaufen. Von der einen Million Franken, die wir in das ganze Konzept gesteckt haben, waren etwa drei Viertel für Marketing und Marktforschung. Ich glaube nicht, dass ein kleines Büros sich die eigentliche Patentierung nicht auch leisten kann. Ein junges Büro kann realistischerweise eher auf einer Patentierung aufbauen als auf der Hoffnung, einen Architekturwettbewerb zu gewinnen.
Hans Zwimpfer: Ein Patent entwickeln ist ein Aufwand. Wir haben sogar ein Modell im Massstab 1:1 für 350000Franken gebaut. Wir liessen zusätzlich technische Studien durchführen, sind die Probleme mit den Sanitär-, Heizungs- und Elektroinstallationen angegangen und haben die statischen und die bauphysikalischen Probleme gelöst. Wenn jemand bei uns eine Lizenz holt, dann kann er von diesem Know-how profitieren. Im Moment haben wir Kontakt mit Tobias Nissen, einem jungen Schweizer Architekten, der die Wohntypologie auf die schwedischen Verhältnisse anpassen möchte. Wir helfen ihm dabei und schulen ihn. In einem solchen Fall ist es doch fair, dass ich unsere Vorleistungen nicht gratis zur Verfügung stelle. Die Lizenzgebühr ist minimal: ein halbes Prozent der Anlagekosten. Ich will also nichts blockieren – im Gegenteil, ich möchte, dass auch junge Architekten meine Typologie weiterentwickeln.
Tina Puffert: Ergänzend kann ich dem hinzufügen, dass in Schweden das Bauen von Totalunternehmern beherrscht wird. Ein junges Büro hat dort keine Möglichkeiten, Fuss zu fassen. In der Zusammenarbeit mit uns kann das Büro von Tobias Nissen mit einem anerkannten Namen auftreten. Er hat die Möglichkeit, darauf hinzuweisen, dass die Wohntypologie schon an fünf Orten angewendet wird. Das ist für das Büro eine attraktive Chance. Es hat denn auch inzwischen unsere Idee weiterentwickelt und ist extrem motiviert, ein passendes Grundstück zu finden.
Bruno Trinkler: Ich habe Verständnis dafür, dass man bei so viel Aufwand seine Arbeit irgendwie schützen will. Wir kämpfen als Architekten immer wieder auf verschiedenster Ebene um den Schutz unserer Arbeit. Aber die Kehrseite der Medaille existiert auch: Ein Büro ohne einen solchen wirtschaftlichen Hintergrund kann eine Idee, die es entwickelt hat, kaum zu einem Patent bringen, eben weil ein tauglicher Patentschutz nur dann möglich ist, wenn man all die Abklärungen vornehmen kann, die Hans Zwimpfer erwähnt hat.
Hans Zwimpfer: Für die reine Patentierung reichen ein paar tausend Franken. Höher sind die Entwicklungskosten im eigenen Büro. Wir mussten ja eine Technologie entwickeln. Ein junges Büro kann, gleich wie wir es getan haben, schrittweise vorgehen. Für eine gute Idee kann zuerst mal die Marke eingetragen werden. In einem zweiten Schritt haben wir das Design angemeldet, und erst in der dritten Stufe stand das Patent.
Andreas J. Maier: Das Unbehagen, das Bruno Trinkler für die allgemeine berufliche Praxis hat, ist durch das Patent bezweckt. Das kommt daher, weil es für ihn neu ist. Wenn man aber weiss, wie man sich in dieser Problematik bewegen muss, ist man entsprechend vorsichtig und kann sich dementsprechend auch strategisch verhalten. In andern Branchen wird längst damit gearbeitet, Siemens beispielsweise meldet aus strategischen Gründen monatlich sehr viele Patente an. Das muss natürlich in der Architektur nicht sein. Aber nehmen wir den Fall des jungen Architekten: Er könnte für
verhältnismässig wenig Geld eine Lizenz von Hans Zwimpfer erwerben, wird dann vom Know-how profitieren und kann das System weiterentwickeln. Das ist die Idee des Patentrechtes, dass durch Konkurrenz und durch Hindernisse Innovation entsteht.
Bruno Trinkler: Auch die Diskussion um Patente in der Gentechnologie führt zum Beispiel immer wieder zu kritischen Fragen. Ich weiss nicht, ob sich der Umgang mit Erfindungen in der Maschinenindustrie so einfach auf architektonische und städtebauliche Fragen übertragen lässt. Wir bauen unsere Häuser letztlich immer im öffentlichen Raum, damit ist die Architektur geprägt von einem allgemeinen Interesse. In diesem Zusammenhang möchte ich auf das Hennebique-System hinweisen, das aus betonierten Hauptträgern, Sekundärträgern und einzelnen Stützen besteht. Der französische Ingenieur liess das System 1892 patentieren. Er konnte das Patent einige Jahre halten, bis es ihm aberkannt wurde, weil es etwas ganz Normales und Allgemeines war. Unser Ingenieur an der Fachhochschule kennt es inzwischen nicht mal mehr. Deshalb habe ich das Gefühl, dass sich das Patentproblem in der Architektur vielleicht von selbst lösen wird.
Klaus Fischli: Aber wie gehen wir damit um? Was bedeuten diese neuen Situationen für uns in den Wettbewerben?
Bruno Trinkler: Ich habe tatsächlich Bedenken für die Wettbewerbe. Wie weit muss eine Jury erkennen, wann Patentverstösse vorliegen? Wenn man nach einer Jurierung feststellt, dass ein erster Preis schon patentiert ist, dann gefährdet man das Verfahren. Sie wissen auch,
dass wir immer wieder überzeugen müssen, dass überhaupt Wettbewerbe durchgeführt werden. Eine Gemeinde, bei der in einem Wettbewerb ein Patentproblem auftaucht, wird kaum mehr einen Wettbewerb durchführen.
Andres J. Maier: Es gibt eine einfache Lösung: In der Ausschreibung muss nur der Paragraf stehen, dass die Teilnehmenden die Rechte berücksichtigen müssen. Und die Vorprüfung könnte vorher in Erfahrung bringen, was auf dem jeweiligen Gebiet schon existiert. Die Architekten sind im Übrigen nicht die Einzigen, die Wettbewerbe durchführen. Das Thema gilt für alle Submissionen.
Tina Puffert: Wenn heute anerkannt werden würde, dass der Patentschutz ein wichtiges Thema ist, dann könnte der SIA Hilfe bieten. Wenn es eine Datrenbank gäbe, auf die der SIA hinweist, wäre es für ein Vorprüfungsbüro einfach, sich zu informieren. So viele Patente wird es im Konzeptbereich sowieso nicht geben – im Architekturwettbewerb geht es häufig um Städtebau und Konzept. Es ist nicht so abwegig, dass eine Jury mindestens darauf hingewiesen wird, ob eventuell ein Patent verletzt wird. Man kann übrigens sehr schnell erkennen, ob ein Patent verletzt ist.
Hans Zwimpfer: Es werden wahrscheinlich nur zwei bis drei so umfassende Patente wie das ‹Pile up› pro Jahr angemeldet. Wir werden zunehmend so auf dem Markt auftreten, dass jeder das ‹Pile up› erkennt. Eine Jury wird sich die Finger nicht verbrennen wollen.
Bruno Trinkler: Aber eine Jury weiss dann immer noch nicht, ob der Projektverfasser eines Wettbewerbsbeitrags eine Lizenz besitzt. Ist er ein ‹Kopist›, oder hat er einen Vertrag mit Hans Zwimpfer? Das kann auch die Vorprüfung nicht entscheiden. Solange ein solches Projekt nicht gewinnt, besteht auch kein Problem. Doch wenn ein solche Projekt zur Ausführung empfohlen ist, dann haben wir ein Wettbewerbsdebakel mehr.
Klaus Fischli: Im Programm müsste stehen – wie es Andreas J. Maier vorgeschlagen hat –, dass der Verfasser mit der Eingabe bestätigt, dass er keine Rechte Dritter verletzt. Er dürfte die Programmbestimmungen nur anerkennen, falls er eine Lizenz erworben hat.
Hans Zwimpfer: Für uns macht es keinen Sinn, mit ‹Pile up› an einem Wettbewerb mitzumachen. Falls der Auslober ein ‹Pile up› bauen will, kommt er direkt zu uns.
Klaus Fischli: Eine Nebenfrage: Was geschieht, falls in einem Wettbewerb das Urheberrecht abgetreten werden muss?
Andreas J. Maier: Ein Büro mit einem Patent müsste sich tatsächlich zuerst überlegen, ob es mitmachen will. Das Patent geht zwar vor, doch kann man das Problem einfach lösen mit einer Gratislizenz. Das entspricht dem Abtreten des Urheberrechts.
Bruno Trinkler: Wann wird es interessant, einen Schutz aufzubauen? Sie haben das ‹Pile up› noch nicht rechtlich verteidigen müssen. Irgendwann wird dieser Fall auftreten, falls die Zahl der Patente in der Architektur wirklich zunimmt.
Andreas J. Maier: Erst wenn wir einen Prozess anstrengen, würde sich zeigen, ob unsere Ansprüche berechtigt sind. Aber ein Streitfall ist selten von Vorteil, denn am Ende ist vielleicht das Patent zerstört, alle haben Geld verloren und niemand konnte profitieren. Für kleinere Einheiten würde ich nie einen Patentstreit eingehen. Novartis hat die Krebsmaus verteidigt, aber das ist eine andere Liga. Und im Übrigen gilt, dass man mit einem Patent einen Vorsprung von drei Jahren hat, bis man eingeholt ist.
[ Gesprächsaufzeichnung: Ivo Bösch ]
Zusatz:
Stapelware – ein Kommentar
(bö) Zuerst reibt man sich die Augen. Ein Patent auf Architektur kann es doch nicht geben. Wir Architektinnen und Architekten, die im Studium lernen müssen, uns andere Projekte als Referenzen zu suchen, und die gelernt haben, dass nichts neu ist in der Architektur, müssen unsere Entwürfe in Zukunft auf mögliche Patentverletzungen prüfen? Ist nicht auch das patentierte System von Hans Zwimpfer von Le Corbusiers Pavillon de l’Esprit Nouveau abgeleitet? Etwas pointiert könnte man behaupten, Zwimpfer habe einfach nur den Maisonette-Typ aufgegeben, also eine Treppe weggelassen. Nein, entgegnen uns die Erfinder des Konzeptes, sie hätten es weiterentwickelt und auf heutige Bedürfnisse angepasst. Und sie sagen selbst, dass alle Elemente schon mal gebaut wurden, aber noch nie so kombiniert. Das kann man kaum glauben. Ein zweigeschossiger Innen- und Aussenraum in einer eingeschossigen Wohnung, alles relativ einfach gestapelt, das soll es noch nie gegeben haben? Das spielt keine Rolle, sagt uns der Patentspezialist, denn eine unabhängige Behörde ist zum Schluss gekommen, dass
das «Pile up» eine Erfindung ist. Und wenn Erfindungen gleichzeitig entstehen, gewinnt die im Patentamt zuerst angemeldete.
Das Projekt ist zweifellos gut und zeugt von grosser Erfahrung auf dem Wohnungsmarkt. Das «Pile up» wurde von Anfang an als Marke propagiert, und die Wohnungen werden im Moment noch einzeln verkauft. Das Patent wird also – ob beabsichtigt oder nicht – als ein Marketinginstrument genutzt. Und als solches ist es bis jetzt äusserst erfolgreich. Von Hans Zwimpfer und seinem Team können wir lernen, wie eine Architekturidee vermarktet wird. Auch wenn vielleicht nicht alle eine Million Franken in eine Idee stecken wollen und können, so zeigt doch das «System Zwimpfer», wie unabhängige Architekten in den Immobilienmarkt vorstossen können. Im Kampf gegen die «Verhäuslichung» der Schweiz leistet das «Pile up» vielleicht wirklich einen kleinen Beitrag. Tina Puffert, die Geschäftsführerin der Firma, die das Patent vermarktet, versichert uns, dass an den zwei Immobilienmessen, an denen das System vorgestellt wurde, die Leute inzwischen nicht nur die grossen Makler kannten, sondern auch schon die Bilder der gestapelten Wohnungen. Nicht das Architekturkonzept, sondern das Marketingkonzept von Hans Zwimpfer sollten mehr gute Büros kopieren. Geschützt sind die Marke, das Design und das Konzept, nicht aber die Marktstrategie.
Andreas J. Maier: Das Urheberrecht besitzt jeder, sobald er eine Idee in eine Form gebracht hat. Man erhält es also automatisch. Wenn jemand mein Urheberrecht verletzt, so muss ich beweisen, dass ich der Urheber bin. Wenn ich aber ein Design oder ein Patent angemeldet habe, dann erhalte ich von Amtes wegen eine Verbriefung, dass ich als Erster eine Idee hatte. Der Vorteil und die Grundidee des Schutzrechtes liegen in dieser Beweisumkehrung. Wenn nun etwas geschaffen wird, das meinem Patent entspricht, so wird mein Patent verletzt. Ob die betreffende Person das gewusst hat, spielt keine Rolle mehr. Seine Ansprüche muss der Patentinhaber trotzdem noch geltend machen.
Bruno Trinkler: Als ein Vertreter der Wettbewerbskommission muss ich doch Bedenken anmelden. Müssen wir als Preisrichter bei den vielen Projekten, die wir jeweils zu beurteilen haben, in Zukunft erkennen, ob ein Projekt patentrechtlich geschützt ist? Ich hatte schon Schwierigkeiten, mich in die Patentschrift von ‹Pile up› einzulesen.
Andreas J. Maier: Eine Patentanmeldung ist tatsächlich etwas komplizierter, weil man sie ausformulieren muss. Es genügt nicht – wie bei einer Designanmeldung –, eine Ansicht zu zeigen. Als Hans Zwimpfer mich anfragte, habe ich zuerst in der Patentliteratur nachgeschlagen, was es schon gibt, und danach das architektonische Konzept in Worte gefasst. Mit der Einreichung des Patentes beginnt ein langes Prozedere. Das heisst, das Europäische Patentamt prüft es zuerst auf Neuheit. Ist die Idee nicht schon bekannt? Weiter muss eine erfinderische Tätigkeit gegeben sein – da stellt man sich die Frage, ob die Erfindung nicht heute im Markt selbstverständlich ist. Als Drittes wird geprüft, ob das System wirtschaftlich anwendbar ist. Diese drei Punkte sind fürs Patent entscheidend.
Jürg Gasche: Mich interessiert der berufliche Hintergrund des Prüfers beim Europäischen Patentamt, denn zum Beispiel für mich als Architekturlaie wäre vieles neu am ‹Pile up›.
Andreas J. Maier: Ein Fachmann ist dabei. Wenn es um Architektur geht, wird ein Architekt dabei sein. Bei uns hat der Rechercheur in der Patentliteratur zwei amerikanische Patentschriften gefunden und sie mit unserem Antrag verglichen und festgestellt, dass unsere Idee dem Stand der Technik entspricht, dass sie neu und erfinderisch ist. Aufgrund dieser Prüfung erteilte das Europäische Patentamt die Schutzschrift. Eine objektiv unabhängige Behörde hat demnach beurteilt, dass das nun unsere Erfindung ist.
Hans Zwimpfer: Interessant ist vielleicht, zu sehen, warum ich überhaupt das ‹Pile up› geschützt habe. Vor vier Jahren wollte ich ein kritisches Buch schreiben über den Städtebau, weil ich seit 50 Jahren unzufrieden bin mit der Zersiedlung in Mitteleuropa, mit diesem ‹Urban Sprawl›, der von Amerika zurück nach Europa gelangt. Doch es gibt schon viele Bücher – Avenir Suisse und das ETH-Studio Basel haben schon grosse Bücher herausgegeben, in denen sie die ganze Schweiz neu planen. Schliesslich habe ich mich entschieden, zuunterst anzufangen, beim Wohnen. Dem ‹Hüsli-Bauen› wollte ich eine neue Form des Wohnens entgegenstellen. Und wer hat mich nun auf diesen quasi merkantilen Weg gebracht? Als ich im März vor zwei Jahren meinen beiden Verwaltungsräten Peter Rechsteiner, 1992–1997 Leiter der Rechtsabteilung beim SIA, und dem SIA-Präsidenten Daniel Kündig mein neues Konzept vorstellte, haben sie mir geraten, es gleich patentieren zu lassen. Falls ich mit ihm auf den Markt käme, sagten sie, würde die Idee sofort kopiert.
Klaus Fischli: Für die auch stapelbaren Wohntypen von Le Corbusier lässt sich wahrscheinlich kein Patent finden. Er besass demnach ‹nur› das Urheberrecht. Seine Ideen wären heute sowieso nicht mehr patentierbar, weil sie allgemein bekannt sind. Damit ist eine Bedingung für ein Patent nicht mehr erfüllt. Ich denke, wir sind uns einig, dass es nicht ums Kopieren geht, sondern es gehört zu unserer Arbeitsmethode, dass wir uns Anregungen aus Beispielen holen.
Tina Puffert: Die einzelnen Merkmale von ‹Pile up› sind sicherlich schon mal gebaut worden, nicht aber die Kombination dieser Elemente. Die Maisonette-Wohnung von Le Corbusier ist eine tolle Idee, aber in einer Zeit, in der immer mehr alte Leute eine Wohnung suchen, ist eine Wohnung auf zwei Geschossen unpraktisch. Der hohe Raum ist beim ‹Pile up› aus einer andern Motivation entstanden. Es zeigt unsere heutige Haltung zum zeitgenössischen Wohnen – eine Möglichkeit mindestens. Es gibt bestimmt noch viele andere Möglichkeiten, wie man schön wohnen kann. Das ‹Pile up› ist ein System, in dem die räumliche Idee wiederholt und an jedes neue Grundstück individuell angepasst wird. Innerhalb jedes Projektes haben wir eine extreme soziologische Gleichstellung: Die Wohnungen sind alle gleich konzipiert, es gibt keine Dachgärten, keine Gärten im Erdgeschoss. Es ist eine Systematik, die durchgezogen wird.
Andreas J. Maier: Und ganz konkret gesprochen: Ob das Patentierte neu ist oder nicht, liegt jenseits unserer Beurteilung. Das hat der Prüfer vom Europäischen Patentamt schon beschlossen…
Bruno Trinkler: Ich habe einen grossen Respekt vor der geleisteten Arbeit. Die immense Erfahrung des Büros Zwimpfer erkennt man im Projekt. Ein Unbehagen bleibt mir aber. Versetzen Sie sich mal in jemanden, der noch nicht diese Erfahrung aufweisen kann. Ich bin der Meinung, dass auch jüngere Leute ihre Versuche machen sollten auf diesen Gebieten. Wenn sie aber durch solche doch sehr offen gefassten Patentschriften behindert werden – das Patent von Hans Zwimpfer könnte nur das erste von vielen sein –, so blockiert man doch ein Feld von Entwicklungen.
Klaus Fischli: Wenn ich das ‹Pile up› richtig verstanden habe, geht es vor allem um das räumliche Konzept, das patentiert ist, also um diese Stapelung der Wohneinheiten nach einem bestimmten System.
Hans Zwimpfer: Gestapelte Wohnungen heisst für mich gestapelte Einfamilienhäuser. Das Wesentliche ist, dass jede Wohnung grosszügig ist, also nicht nur das oberste Geschoss eines Wohnhauses. Wichtig war mir, dass es auf verschiedenste Gebäudeformen anwendbar ist. Man kann es in allen städtebaulichen Bauformen realisieren.
Andreas J. Maier: Die Grundidee des ‹Pile up› liegt in der inneren flexiblen Struktur. In der Patentschrift steht dazu, dass die Wohneinheiten individuell anpassbare Wohnflächen besitzen. Sie müssen gestapelt sein. Entscheidend für das Patent ist, dass jede Wohnung aus einem eingeschossigen Wohnungsteil und einem zweigeschossigen Wohnungsteil mit einem zweigeschossigen Aussenraum besteht. Die Fläche des eingeschossigen Wohnungsteils muss dabei mindestens so gross sein wie die des zweigeschossigen. In allen Wohnungen muss jeweils der zweigeschossige Wohnungsteil dieselbe Grundfläche aufweisen, und die eingeschossigen Wohnungsteile müssen übereinander liegen.
Bruno Trinkler: Die Themen der Zersiedelung und des Wohnungsbaus bewegen uns als Architekten schon seit Jahren und haben uns immer wieder zu Versuchen veranlasst – in Wettbewerben oder im ‹normalen› Wohnungsbau. Wir operieren häufig mit zweigeschossigen Räumen in Wohnungen – hie und da auch mit einem zweigeschossigen Aussenraum. Und besteht nicht jedes Mehrfamilienhaus aus gestapelten Wohnungen? Muss ich nun jedes Mal, wenn ich eine solche Wohnung entwerfe, Hans Zwimpfer fragen, ob er diesen Typ schon geschützt hat, und wenn nicht, könnte ich ihn anmelden?
Andreas J. Maier: Es geht nicht nur um ein Stapeln der Wohnungen. Die Bilder in der Patentschrift beschreiben, wie das System der Stapelung konkret funktioniert. Allgemein bin ich der Meinung, dass der «Versicherungsaspekt» nur eine Ebene des Patentes ist, die andere Ebene ist die strategische. Da ist für die Architekten ein Feld, das noch nicht erkannt wurde. Andere Industrien setzen das Schutzrecht schon lange gegen Konkurrenz ein. Dabei geht es um die gegenseitige Aufschaukelung der Innovation. Die Umgehung eines Patentes schafft wieder Kreativität. Im Maschinenbau beispielsweise werden Patente als strategische Mittel eingesetzt. Ich denke, wir werden – weil Amerika Vorreiter ist – in Europa auch in der Architektur häufiger mit Schutzrechten, sprich mit Design und Patent, konfrontiert sein. Und grundsätzlich müsste ein Architekt tatsächlich bei einem neu entworfenen Haus sich überlegen, ob er ein Patent verletzt. Jeder Ingenieur muss sich diese Frage stellen, jeder, der technisch tätig ist.
Hans Zwimpfer: Hier habe ich ein Buch von Le Corbusier. Bevor ich die Idee patentieren liess, habe ich darin nachgesehen. Ich habe in der klassischen Moderne gesucht, bei den Holländern, bei den Engländern. Mir ist bis jetzt kein Vorgängerbeispiel bekannt. Zusammen mit Timothy Nissen habe ich schon in seinen Büchern gesucht. Und kürzlich sagte Kurt Aellen zu mir, Le Corbusier sei beim Pavillon de l’Esprit Nouveau, der nur als Musterhaus gebaut wurde, stehen geblieben, und ich hätte ihn nun weiterentwickelt. Mein Traum ist übrigens, die Immeuble-Villa mal noch zu bauen, weil ich es als eine Schande betrachte, dass das Gebäude nie gebaut wurde. Ich will mich als älterer Architekt nicht blamieren. Deshalb habe ich die ganze Literatur durchsucht und viele Leute gefragt, ob sie so was wie das ‹Pile up› nicht schon gesehen haben. Ich glaube aber auch, dass jede Idee ihre Vorläufer hat.
Jürg Gasche: Hans Zwimpfer hat gesagt, dass ihn die Zersiedelung unseres Territoriums stört. Ich frage mich – vielleicht auf einer philosophischen Ebene –, ob mit dem Trend zur Patentierung nicht auch eine Zersiedelung der geistigen Landschaft entsteht. Andreas J. Maier sieht das optimistisch und glaubt an zusätzliche Kreativität. Unsere Panzersperren oder die Stadtmauern mussten auch irgendwann geschleift werden. Ich befürchte eine Behinderung von Entwicklungen. Segeln die Architekten in Zukunft nicht in einem Gebiet voller Riffe, die nur auf den Patentämtern kartografiert sind?
Tina Puffert: Dass das Patent für uns alle in der Architektur ein neues Thema ist, bezweifelt niemand. Die Motivation, so etwas zu tun, ist, eine solche Systematik überhaupt mal zu formulieren. Mit diesem systematischen Ansatz arbeiten Architekten selbst im Wohnungsbau relativ selten.
Bruno Trinkler: Da muss ich widersprechen. Dass im Wohnungsbau nicht systematisch gearbeitet wird, stelle ich klar in Abrede – wenn wir denn von Architektur reden und nicht von irgendwelchen «Bauereien». Für die engagierte Architekturgilde mindestens reklamiere ich, dass sie systematisch arbeitet.
Tina Puffert: Ich will keinem Architekten vorwerfen, dass er nicht systematisch arbeitet. Mir geht es darum, dass für einzelne Probleme im Wohnungsbau ein System erarbeitet werden kann – also für etwas, das wiederholt und an mehreren Orten angewendet werden kann. Etwas so weit zu formulieren, dass man es patentieren lassen kann, dazu gehört eine andere Systematik und ein gewisser Ehrgeiz. Architekten könnten sich doch motiviert fühlen, wiederkehrende Problemlösungen oder bestimmte Arbeitsschritte, die sie immer wieder tun, patentieren zu lassen. Nur weil es in der Architektur noch nicht üblich ist, heisst nicht, dass es nicht eine Chance für den Markt wäre. Den Architekten geht es im Moment nicht besonders gut. Vielleicht ist die Patentierung eine Chance, anders wirtschaftlich zu denken. Man könnte sich angestachelt fühlen, Lösungen für grundsätzliche Probleme zu finden und nicht jedes Mal individuell für ein Grundstück zu entwerfen. ‹Pile up› ist nicht nur ein Projekt, ‹Pile up› sind im Moment fünf Projekte. In zwei Fällen sind wir inzwischen auch sehr erfolgreich im Verkauf.
Jürg Gasche: Das heisst, es kann durchaus attraktiv sein, ein Konzept patentieren zu lassen, wenn man die entsprechenden Vermarktungsmöglichkeiten besitzt. Für ein junges Büros, das keinen Zugang zu solchen Kanälen hat und sich vor allem in Wettbewerben profilieren möchte, ist es möglicherweise viel weniger attraktiv.
Tina Puffert: Das stimmt sicherlich, und das ist vielleicht auch ein kritischer Punkt. Aber in Deutschland zum Beispiel funktioniert das Wettbewerbssystem schon lange nicht mehr. In Baden-Württemberg soll es so viele Architekturbüros geben wie in ganz Frankreich. Das sind zu viele, als dass die Einzelnen eine Überlebenschance hätten. Als Alternative könnten doch junge Büros ein Idee entwickeln, die sie patentieren lassen und verkaufen. Von der einen Million Franken, die wir in das ganze Konzept gesteckt haben, waren etwa drei Viertel für Marketing und Marktforschung. Ich glaube nicht, dass ein kleines Büros sich die eigentliche Patentierung nicht auch leisten kann. Ein junges Büro kann realistischerweise eher auf einer Patentierung aufbauen als auf der Hoffnung, einen Architekturwettbewerb zu gewinnen.
Hans Zwimpfer: Ein Patent entwickeln ist ein Aufwand. Wir haben sogar ein Modell im Massstab 1:1 für 350000Franken gebaut. Wir liessen zusätzlich technische Studien durchführen, sind die Probleme mit den Sanitär-, Heizungs- und Elektroinstallationen angegangen und haben die statischen und die bauphysikalischen Probleme gelöst. Wenn jemand bei uns eine Lizenz holt, dann kann er von diesem Know-how profitieren. Im Moment haben wir Kontakt mit Tobias Nissen, einem jungen Schweizer Architekten, der die Wohntypologie auf die schwedischen Verhältnisse anpassen möchte. Wir helfen ihm dabei und schulen ihn. In einem solchen Fall ist es doch fair, dass ich unsere Vorleistungen nicht gratis zur Verfügung stelle. Die Lizenzgebühr ist minimal: ein halbes Prozent der Anlagekosten. Ich will also nichts blockieren – im Gegenteil, ich möchte, dass auch junge Architekten meine Typologie weiterentwickeln.
Tina Puffert: Ergänzend kann ich dem hinzufügen, dass in Schweden das Bauen von Totalunternehmern beherrscht wird. Ein junges Büro hat dort keine Möglichkeiten, Fuss zu fassen. In der Zusammenarbeit mit uns kann das Büro von Tobias Nissen mit einem anerkannten Namen auftreten. Er hat die Möglichkeit, darauf hinzuweisen, dass die Wohntypologie schon an fünf Orten angewendet wird. Das ist für das Büro eine attraktive Chance. Es hat denn auch inzwischen unsere Idee weiterentwickelt und ist extrem motiviert, ein passendes Grundstück zu finden.
Bruno Trinkler: Ich habe Verständnis dafür, dass man bei so viel Aufwand seine Arbeit irgendwie schützen will. Wir kämpfen als Architekten immer wieder auf verschiedenster Ebene um den Schutz unserer Arbeit. Aber die Kehrseite der Medaille existiert auch: Ein Büro ohne einen solchen wirtschaftlichen Hintergrund kann eine Idee, die es entwickelt hat, kaum zu einem Patent bringen, eben weil ein tauglicher Patentschutz nur dann möglich ist, wenn man all die Abklärungen vornehmen kann, die Hans Zwimpfer erwähnt hat.
Hans Zwimpfer: Für die reine Patentierung reichen ein paar tausend Franken. Höher sind die Entwicklungskosten im eigenen Büro. Wir mussten ja eine Technologie entwickeln. Ein junges Büro kann, gleich wie wir es getan haben, schrittweise vorgehen. Für eine gute Idee kann zuerst mal die Marke eingetragen werden. In einem zweiten Schritt haben wir das Design angemeldet, und erst in der dritten Stufe stand das Patent.
Andreas J. Maier: Das Unbehagen, das Bruno Trinkler für die allgemeine berufliche Praxis hat, ist durch das Patent bezweckt. Das kommt daher, weil es für ihn neu ist. Wenn man aber weiss, wie man sich in dieser Problematik bewegen muss, ist man entsprechend vorsichtig und kann sich dementsprechend auch strategisch verhalten. In andern Branchen wird längst damit gearbeitet, Siemens beispielsweise meldet aus strategischen Gründen monatlich sehr viele Patente an. Das muss natürlich in der Architektur nicht sein. Aber nehmen wir den Fall des jungen Architekten: Er könnte für
verhältnismässig wenig Geld eine Lizenz von Hans Zwimpfer erwerben, wird dann vom Know-how profitieren und kann das System weiterentwickeln. Das ist die Idee des Patentrechtes, dass durch Konkurrenz und durch Hindernisse Innovation entsteht.
Bruno Trinkler: Auch die Diskussion um Patente in der Gentechnologie führt zum Beispiel immer wieder zu kritischen Fragen. Ich weiss nicht, ob sich der Umgang mit Erfindungen in der Maschinenindustrie so einfach auf architektonische und städtebauliche Fragen übertragen lässt. Wir bauen unsere Häuser letztlich immer im öffentlichen Raum, damit ist die Architektur geprägt von einem allgemeinen Interesse. In diesem Zusammenhang möchte ich auf das Hennebique-System hinweisen, das aus betonierten Hauptträgern, Sekundärträgern und einzelnen Stützen besteht. Der französische Ingenieur liess das System 1892 patentieren. Er konnte das Patent einige Jahre halten, bis es ihm aberkannt wurde, weil es etwas ganz Normales und Allgemeines war. Unser Ingenieur an der Fachhochschule kennt es inzwischen nicht mal mehr. Deshalb habe ich das Gefühl, dass sich das Patentproblem in der Architektur vielleicht von selbst lösen wird.
Klaus Fischli: Aber wie gehen wir damit um? Was bedeuten diese neuen Situationen für uns in den Wettbewerben?
Bruno Trinkler: Ich habe tatsächlich Bedenken für die Wettbewerbe. Wie weit muss eine Jury erkennen, wann Patentverstösse vorliegen? Wenn man nach einer Jurierung feststellt, dass ein erster Preis schon patentiert ist, dann gefährdet man das Verfahren. Sie wissen auch,
dass wir immer wieder überzeugen müssen, dass überhaupt Wettbewerbe durchgeführt werden. Eine Gemeinde, bei der in einem Wettbewerb ein Patentproblem auftaucht, wird kaum mehr einen Wettbewerb durchführen.
Andres J. Maier: Es gibt eine einfache Lösung: In der Ausschreibung muss nur der Paragraf stehen, dass die Teilnehmenden die Rechte berücksichtigen müssen. Und die Vorprüfung könnte vorher in Erfahrung bringen, was auf dem jeweiligen Gebiet schon existiert. Die Architekten sind im Übrigen nicht die Einzigen, die Wettbewerbe durchführen. Das Thema gilt für alle Submissionen.
Tina Puffert: Wenn heute anerkannt werden würde, dass der Patentschutz ein wichtiges Thema ist, dann könnte der SIA Hilfe bieten. Wenn es eine Datrenbank gäbe, auf die der SIA hinweist, wäre es für ein Vorprüfungsbüro einfach, sich zu informieren. So viele Patente wird es im Konzeptbereich sowieso nicht geben – im Architekturwettbewerb geht es häufig um Städtebau und Konzept. Es ist nicht so abwegig, dass eine Jury mindestens darauf hingewiesen wird, ob eventuell ein Patent verletzt wird. Man kann übrigens sehr schnell erkennen, ob ein Patent verletzt ist.
Hans Zwimpfer: Es werden wahrscheinlich nur zwei bis drei so umfassende Patente wie das ‹Pile up› pro Jahr angemeldet. Wir werden zunehmend so auf dem Markt auftreten, dass jeder das ‹Pile up› erkennt. Eine Jury wird sich die Finger nicht verbrennen wollen.
Bruno Trinkler: Aber eine Jury weiss dann immer noch nicht, ob der Projektverfasser eines Wettbewerbsbeitrags eine Lizenz besitzt. Ist er ein ‹Kopist›, oder hat er einen Vertrag mit Hans Zwimpfer? Das kann auch die Vorprüfung nicht entscheiden. Solange ein solches Projekt nicht gewinnt, besteht auch kein Problem. Doch wenn ein solche Projekt zur Ausführung empfohlen ist, dann haben wir ein Wettbewerbsdebakel mehr.
Klaus Fischli: Im Programm müsste stehen – wie es Andreas J. Maier vorgeschlagen hat –, dass der Verfasser mit der Eingabe bestätigt, dass er keine Rechte Dritter verletzt. Er dürfte die Programmbestimmungen nur anerkennen, falls er eine Lizenz erworben hat.
Hans Zwimpfer: Für uns macht es keinen Sinn, mit ‹Pile up› an einem Wettbewerb mitzumachen. Falls der Auslober ein ‹Pile up› bauen will, kommt er direkt zu uns.
Klaus Fischli: Eine Nebenfrage: Was geschieht, falls in einem Wettbewerb das Urheberrecht abgetreten werden muss?
Andreas J. Maier: Ein Büro mit einem Patent müsste sich tatsächlich zuerst überlegen, ob es mitmachen will. Das Patent geht zwar vor, doch kann man das Problem einfach lösen mit einer Gratislizenz. Das entspricht dem Abtreten des Urheberrechts.
Bruno Trinkler: Wann wird es interessant, einen Schutz aufzubauen? Sie haben das ‹Pile up› noch nicht rechtlich verteidigen müssen. Irgendwann wird dieser Fall auftreten, falls die Zahl der Patente in der Architektur wirklich zunimmt.
Andreas J. Maier: Erst wenn wir einen Prozess anstrengen, würde sich zeigen, ob unsere Ansprüche berechtigt sind. Aber ein Streitfall ist selten von Vorteil, denn am Ende ist vielleicht das Patent zerstört, alle haben Geld verloren und niemand konnte profitieren. Für kleinere Einheiten würde ich nie einen Patentstreit eingehen. Novartis hat die Krebsmaus verteidigt, aber das ist eine andere Liga. Und im Übrigen gilt, dass man mit einem Patent einen Vorsprung von drei Jahren hat, bis man eingeholt ist.
[ Gesprächsaufzeichnung: Ivo Bösch ]
Zusatz:
Stapelware – ein Kommentar
(bö) Zuerst reibt man sich die Augen. Ein Patent auf Architektur kann es doch nicht geben. Wir Architektinnen und Architekten, die im Studium lernen müssen, uns andere Projekte als Referenzen zu suchen, und die gelernt haben, dass nichts neu ist in der Architektur, müssen unsere Entwürfe in Zukunft auf mögliche Patentverletzungen prüfen? Ist nicht auch das patentierte System von Hans Zwimpfer von Le Corbusiers Pavillon de l’Esprit Nouveau abgeleitet? Etwas pointiert könnte man behaupten, Zwimpfer habe einfach nur den Maisonette-Typ aufgegeben, also eine Treppe weggelassen. Nein, entgegnen uns die Erfinder des Konzeptes, sie hätten es weiterentwickelt und auf heutige Bedürfnisse angepasst. Und sie sagen selbst, dass alle Elemente schon mal gebaut wurden, aber noch nie so kombiniert. Das kann man kaum glauben. Ein zweigeschossiger Innen- und Aussenraum in einer eingeschossigen Wohnung, alles relativ einfach gestapelt, das soll es noch nie gegeben haben? Das spielt keine Rolle, sagt uns der Patentspezialist, denn eine unabhängige Behörde ist zum Schluss gekommen, dass
das «Pile up» eine Erfindung ist. Und wenn Erfindungen gleichzeitig entstehen, gewinnt die im Patentamt zuerst angemeldete.
Das Projekt ist zweifellos gut und zeugt von grosser Erfahrung auf dem Wohnungsmarkt. Das «Pile up» wurde von Anfang an als Marke propagiert, und die Wohnungen werden im Moment noch einzeln verkauft. Das Patent wird also – ob beabsichtigt oder nicht – als ein Marketinginstrument genutzt. Und als solches ist es bis jetzt äusserst erfolgreich. Von Hans Zwimpfer und seinem Team können wir lernen, wie eine Architekturidee vermarktet wird. Auch wenn vielleicht nicht alle eine Million Franken in eine Idee stecken wollen und können, so zeigt doch das «System Zwimpfer», wie unabhängige Architekten in den Immobilienmarkt vorstossen können. Im Kampf gegen die «Verhäuslichung» der Schweiz leistet das «Pile up» vielleicht wirklich einen kleinen Beitrag. Tina Puffert, die Geschäftsführerin der Firma, die das Patent vermarktet, versichert uns, dass an den zwei Immobilienmessen, an denen das System vorgestellt wurde, die Leute inzwischen nicht nur die grossen Makler kannten, sondern auch schon die Bilder der gestapelten Wohnungen. Nicht das Architekturkonzept, sondern das Marketingkonzept von Hans Zwimpfer sollten mehr gute Büros kopieren. Geschützt sind die Marke, das Design und das Konzept, nicht aber die Marktstrategie.
Für den Beitrag verantwortlich: TEC21
Ansprechpartner:in für diese Seite: Judit Solt