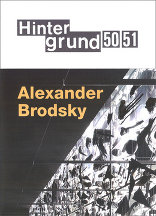Zeitschrift
Hintergrund 50/51
Alexander Brodsky

Ein Interview mit Alexander Brodsky
16. September 2011 - Elena Gonzalez, Alexei Muratov
Project Russia: Dein Vater, der bekannte Künstler und Illustrator Sawwa Brodsky, kam zur Kunst durch Architektur. Du bewegst dich anscheinend in die andere Richtung: von Radierungen und Kunstinstallationen zum „realen“ Entwerfen. Heißt das jetzt, dass es die Architektur ist, die dich als Ausdrucksform am meisten anspricht?
Alexander Brodsky: Schwer zu sagen … Mein Vater fing als Künstler an. Er ging in Leningrad auf die Kunstschule und hatte vor, bildende Kunst zu praktizieren. An einem bestimmten Punkt allerdings hat er sich entschieden, an der Hochschule für Architektur zu studieren. Er ist zwanzig Jahre bei der Architektur geblieben und hat eine große Zahl an Gebäuden entworfen, gab die Grafik aber nie auf. Und am Ende war es die Grafik, die zu seinem Hauptberuf wurde. Ich ging auch an die Kunstschule und dachte daran, Maler zu werden. Dann aber, unter dem Einfluss der Erzählungen meines Vaters, wie toll das MArchI (Moskauer Architekturinstitut) ist, ging ich da hin. Das bedeutete überhaupt nicht, dass ich Architekt werden wollte – ich fand es einfach sehr lustig dort. Ich hatte jede Menge Freunde, eine Band namens „Luchshie gody“ („Die besten Jahre“) usw. Ich wurde von einigen brillanten Lehrern unterrichtet – Turkus, Barschtsch, Barchin. Aber jung und dumm, wie ich war, wusste ich sie nicht gebührend zu schätzen. Mir kam vor, unsere Hauptbeschäftigung war es, fröhliche Bilder für Komsomol-Tagungen und Neujahrsfeiern zu malen. Dann begannen Ilja Utkin und ich im Grenzbereich zwischen Kunst und Architektur zu arbeiten.
Az W: In den 1990er Jahren warst du mehrere Jahre lang in den USA, die erste Einladung kam 1990 vom New Yorker Galeristen Ronald Feldman. Wie erinnerst du dich an diese Zeit, den Wechsel zwischen Westen und Osten? Und was hast du für dich mitgenommen, als du nach Russland zurückgekehrt bist und schließlich Architekt wurdest?
AB: Zum ersten Mal kamen wir 1989 zu Besuch in die USA, Ilja Utkin und ich, und zeigten eine Ausstellung bei Ronald Feldman und in anderen Galerien. New York ist eine tolle Stadt für Besuche – schön und interessant. Mehrere Jahre lang reisten wir hin und her. 1996 ging ich mit meiner Familie für ein paar Monate nach New York, um eine Ausstellung aufzubauen. Und dann blieben wir fast vier Jahre. Es war sehr interessant und eine sehr harte Überlebenserfahrung. Ich machte die verschiedensten Dinge – Skulpturen, Installationen, Grafiken … Während dieser Jahre kamen viele neue Freunde hinzu, und darum habe ich immer noch eine starke Verbindung zu New York.
PR: Und wurdest schließlich Architekt …
AB: Schrittweise. Es dauerte mehr als zwanzig Jahre, ehe ich anfing, auf die Frage nach meinem Beruf „Architekt“ zu antworten. Viele Jahre lang war ich fast sicher, dass ich nie anfangen würde, wirklich zu bauen – dass das nicht mein Beruf ist, sondern einer für andere Leute, die auf irgendeine besondere Art dazu passen. Ehrlich gesagt glaube ich das auch heute noch. Es ist wie Auto fahren. Mein ganzes Leben lang war ich mir sicher, dass ich nie Auto fahren würde können; mir schien, dass es besondere Leute gibt, die das können, und dass ich keiner von ihnen bin. Dann stellte sich heraus, dass es keine große Sache ist. Und das erstaunt mich bis zum heutigen Tag. Ich fahre jetzt schon lange Zeit und wundere mich immer noch: Ich steige ins Auto, drehe den Zündschlüssel, der Wagen setzt sich in Bewegung, und plötzlich fahre ich … Mit der Architektur ist es dasselbe. Wir bauen jetzt seit sechs Jahren, und ich kann mich immer noch nicht an den Gedanken gewöhnen, dass ich tatsächlich Architekt bin. Ich staune.
PR: Architektonische Praxis tendiert immer dazu, räumlich zu expandieren – vom Kleinen zum Großen. Und nicht bloß von Plänen auf Papier zur Realisierung eines Entwurfs in Stein und Mörtel, sondern auch von kleinen Gebäuden zu zunehmend großen. Ist dir dieses Bedürfnis, etwas Großes zu schaffen, vertraut, oder bist du mit der Arbeit für private Auftraggeber völlig zufrieden?
AB: Im Moment bin ich mit dem zufrieden, was ich mache. Ich meine nicht, mit den Ergebnissen – die sind immer problematisch –, sondern mit dem Prozess an sich. Die Tatsache, dass ernsthafte Leute an mich herantreten, die wollen, dass ich ein Haus für sie entwerfe, ist mir wichtiger als die physischen Dimensionen dieses Hauses. Mir macht es viel Freude, an kleinen Details herumzutüfteln, obwohl die sich mitunter als ermüdend erweisen. Womöglich ist das ein Grund, weshalb Architekten gelegentlich riesige Gebäude entwerfen sollten – um den Augen eine Pause vom Kleinzeug zu gönnen.
PR: Du widmest dich jedem Detail?
AB: Ich versuche es jedenfalls. Im Augenblick erlaubt der Umfang unserer Aufträge es mir, mir über jede Sockelleiste Gedanken zu machen und bei jedem kleinen Detail das Sagen zu haben. Aber es wird immer schwieriger.
Az W: Wie entscheidest du, welche Materialien bei deinen Projekten verwendet werden? Du scheinst ja Grundbaustoffe wie Holz oder Ziegel zu bevorzugen. Interessierst du dich überhaupt für neue Materialien?
AB: Stimmt, ich mag lieber Baustoffe wie Holz, Ziegel oder Beton – Materialien, die mit der Zeit schöner werden. Normalerweise muss ich gar keine Materialauswahl treffen – die Entscheidung fällt mit den ersten Skizzen. Glas und Metall gefallen mir auch, und ich werde, glaube ich, in Zukunft einige neue Materialien verwenden.
PR: Könnte man sagen, dass deine gebauten Projekte die vollkommene Widerspiegelung deines kreativen Willens sind?
AB: Größtenteils ja. Schließlich kommen die meisten meiner Auftraggeber aus einem bestimmten Grund zu mir. Sie wissen mehr oder weniger, was sie wollen. Es gibt also nie die Notwendigkeit für gravierende Kompromisse.
PR: Sehen sie dich als Architekten oder als Künstler?
AB: Meine ersten beiden Auftraggeber – Marat Guelman und Sascha Eschkow – kannten mich nur als Künstler. Sie wussten allerdings, dass ich einen Abschluss in Architektur habe, und beschlossen, es zu riskieren. Der allererste war Guelman, der mich mit dem Entwurf der Innenausstattung seiner eigenen Wohnung beauftragte. Zuvor war ich einer der Künstler gewesen, die in seiner Galerie ausstellten. Fast zur gleichen Zeit bot Eschkow mir die Chance, ein Sommerrestaurant am Ufer des Kljasminskoe Reservoirs zu entwerfen (siehe Seite 33, 95° Restaurant). Diese Aufträge waren der Start zu meiner Laufbahn als Architekt. Halb Moskau hat schon die Wohnung von Guelman besichtigt. Auch das Restaurant wurde ein beliebtes Lokal; es war das erste in einer ganzen Reihe von Gebäuden, die wir in Pirogowo bauten. Interessanterweise gab es eine Verbindung zwischen den beiden Aufträgen. Eschkow lernte mich kennen, als er ein Kunstobjekt aus meiner Ausstellung in der Guelman- Galerie kaufte. Dann folgte eine Kettenreaktion: Die Entwürfe wurden veröffentlicht, ich bekam neue Projektvorschläge, und allmählich bildete sich ein Kundenkreis.
PR: Folgst du bei der Arbeit an einem Auftrag einer bestimmten Methode? Womit fängst du an: mit einem Bild, der Nutzung, baulichen Überlegungen, dem Kontext?
AB: Meine Methode ist mehr intuitiv als irgendwas sonst. Ich habe keine Grundsätze – zumindest was Stil betrifft. Ich vermute, Architekten sollten ein Art Leitprinzip haben, aber für mich hab ich ich so etwas nie formuliert, erklärt oder zu Papier gebracht. Und ich habe nie mit jemandem über meine Prinzipien gesprochen. Obwohl es Momente gab, in denen ich versuchte, im Kopf ein paar Worte zum Thema auf die Reihe zu bringen.
Az W: Es ist offensichtlich, dass das Zeichnen mit der Hand für dich eine Schlüsselrolle spielt. Aber ist der nächste Schritt in der Übersetzung von der Skizze zum Bau das Arbeitsmodell, um Raumkonzepte weiterentwickeln und testen zu können?
AB: Naürlich fange ich immer mit Zeichnungen an, aber in manchen Projektstadien werden Modelle sehr wichtig. Mein allererstes Gebäude, das 95° Restaurant (siehe Seite 33), entstand ohne alle technischen Zeichnungen, nur anhand eines Modells. Aber leider haben wir in vielen Fällen nicht die Zeit, Modelle zu bauen.
PR: Wie sehr liegen Architektur- und Kunstkritiker richtig, wenn sie über deine Schöpfungen schreiben? Wie glücklich bist du damit, wie deine Arbeit wahrgenommen wird?
AB: Ich weiß nicht. Ich lese diese Texte nicht oft. Und wenn, dann versuche ich nicht allzu sehr darauf zu achten, was darin über mich geschrieben wird. Wenn es Lob ist, schön. Und wenn sie mich kritisieren, na ja, wie’s kommt, so kommt’s … Etwas anderes ist es, wenn enge persönliche Freunde gebeten werden, etwas über einen zu schreiben. Das berührt einen.
PR: Als Autor deiner Projekte hast du also schon alles gesagt, was du mit deinen Bauwerken sagen wolltest?
AB: So sollte es idealerweise sein. Aber es macht mir nicht wirklich etwas aus, ob ich missverstanden werde. Ist es wirklich die Zeit wert, sich wegen der unrichtigen Interpretationen von irgendjemandem Sorgen zu machen? Am besten verwendet man die Energie darauf, stattdessen etwas Neues zu schaffen.
PR: Setzt du für dein Büro strategische Ziele oder Aufgaben fest, oder ziehst du es vor, mit dem Strom zu schwimmen?
AB: Wir sind jetzt seit fast sechs Jahren im Geschäft und sagen uns andauernd, dass wir irgendeine Strategie erarbeiten sollten. Ich bin sicher, wenn wir einmal eine erarbeiten, wird es die beste Strategie der Welt sein. Im Augenblick aber schwimmen wir mit dem Strom. Aber nicht mit irgendeinem Strom – es ist der Strom, den wir uns für uns selbst ausgesucht haben. Früher kam unser Büro mir nicht sehr wie ein Architekturbüro vor – es war mehr ein Klub für Architekturfreaks, ein Ort, wo man reinschauen konnte, um eine Tasse Tee zu trinken und ein bisschen was zu zeichnen. Aber jetzt robotet hier jeder bis zum Umfallen.
PR: Verwendest du persönlich einen Computer bei der Arbeit?
AB: Nein, das ist etwas, was ich nicht kann – und ich habe kein Verlangen, es zu lernen. Ich zeichne mit Bleistift auf Pauspapier, und das reicht mir.
PR: Und dann sitzt du neben jemandem aus deinem Team und gibst Anweisungen, während er oder sie am Computer zeichnet?
AB: Das ist ein wunderbares, unvergleichliches Gefühl – hinter jemandem zu sitzen und zu sagen: „Mehr nach rechts, mehr nach links. Nein, nicht so.“ Und dann zuzusehen, wie deine brillante Idee auf dem Bildschirm Gestalt annimmt. Am Ende kam ich drauf, dass diese Passion von mir der Person, die zeichnen muss, kein besonderes Vergnügen macht. Und bei ihm oder ihr sogar zu leichter Irritation führen kann. Aber trotzdem gibt es Momente, in denen ich mir diesen Genuss nicht versagen kann.
Az W: Wie wichtig ist es für dich, Zeit auf der Baustelle zu verbringen?
AB: Sehr wichtig. Es ist erstaunlich, dabei zuzusehen, wie aus einer Skizze, einer Idee ein Gebäude wird. Das Wichtige für mich persönlich ist dabei, dass immer eine kleine Chance besteht, während des Baus noch etwas zu ändern, wenn man einen Fehler entdeckt. Hab ich schon viele Male gemacht.
PR/Az W: Findest du Unterrichten als Beruf attraktiv? Hat man dich eingeladen, am MArchI zu lehren?
AB: Vor einigen Jahren schaute ich auf der Suche nach, glaube ich, gutem Zeichenpapier zufällig im MArchI vorbei und wurde unerwartet von einigen sehr ernsthaften Leuten mit dem Vorschlag angesprochen, dort zu lehren. Ich war dafür überhaupt nicht bereit und sagte das auch. Was hätte ich den Studenten schon beibringen können? Bloß zehn Arten, eine Bierflasche aufzumachen. Letztes Jahr aber habe ich es mir anders überlegt und einen Versuch gemacht, zu unterrichten. Es war ein Semester an der École Especial d’Architecture in Paris. Es war nett und interessant und einmal etwas ganz Anderes. Jetzt habe ich wenigstens ein klein bisschen Erfahrung, aber ich bin nicht sicher, dass ich es bald wieder tue.
PR: Eine anerkannte Ansicht besagt, dass das wichtigste Leitmotiv deiner Arbeit Nostalgie ist. Wie ein Kritiker schrieb: „Brodsky hat aus seiner Nostalgie eine künstlerische Technik gemacht.“ Was für eine Nostalgie ist das?
AB: Diese weitverbreitete Meinung ist, glaube ich, daraus entstanden, dass ich im Laufe der Jahre meines Künstlerdaseins viel Zeit damit verbracht habe, Ruinen abzubilden. Ich habe zusammen mit Ilja Utkin Ruinen gezeichnet, und auch allein. Ich habe Ruinen aus Ton geformt und Ruineninterieurs und -installationen gemacht. Der Grund dafür war möglicherweise, dass das größte Problem, das ich während des Studiums am MArchI hatte, meine Unfähigkeit war, moderne Architektur zu verstehen. Ich hab mich dahintergeklemmt und zu begreifen versucht, wie und warum sie mir gefallen sollte, aber ich konnte es nicht. Allerdings habe ich Piranesi und folglich auch römische Ruinen – und auch alle anderen – immer schon bewundert. Das war für mich Architektur, die ich lieben konnte. Wenn nötig, ging ich wie alle anderen Studenten in die Bibliothek, nahm mir eine Zeitschrift und kopierte Entwürfe von, sagen wir, Paul Rudolph oder James Stirling, ohne das kleinste bisschen Gefühl dafür, ohne zu verstehen, warum ich es tat, und ohne zu glauben, dass irgendetwas Bedeutsames dahinter war. Genauso wenig war ich in der Lage, den russischen Konstruktivismus zu verstehen oder zu mögen. Um mich von meinem eigenen Versagen abzulenken und zu beruhigen, zeichnete ich Ruinen.
PR: Es gibt allerdings auch Leute, die so etwas nicht reizt. Stattdessen entwerfen sie neue Gebäude im klassischen Stil: Michail Filippow, zum Beispiel, oder dein früherer Partner Ilya Utkin.
AB: Sie sind die augenscheinlichen Erben der Tradition Palladios, und dafür soll man sie respektieren. Was mich betrifft, ich war vom reinen Neoklassizismus nie sehr angetan. Jedenfalls nicht so sehr angetan, dass ich bei Palladios Grab auf das System der Ordnung schwören würde. Ich empfand weiterhin eine zarte Liebe zu aller klassischen Architektur, träumte gleichzeitig aber davon, die zeitgenössische Architektur auch zu lieben. Und am Ende gelang mir das auch. Bedanken muss ich mich dafür bei meinem alten Freund Evgene Asse, der bei meiner Bildung in dieser Hinsicht eine Schlüsselrolle spielte. Wann immer wir miteinander tranken und redeten, zeigte er mir irgendetwas, was er in letzter Zeit in verschiedenen Teilen der Welt gebaut hatte, und das traf immer genau den Punkt und fesselte meine Fantasie. Allmählich gewann ich einen Standpunkt, erwarb mir einen eigenständigen Geschmack und hatte Lieblingsbauten, Lieblingsarchitekten.
PR: Du hast also in dem Moment ein Verständnis für zeitgenössische Architektur entwickelt, als du selbst praktizierender Architekt wurdest?
AB: Nein, ein bisschen davor. Sonst hätte ich den ersten Schritt wahrscheinlich gar nicht gemacht.
Az W: Kann man sagen, dass deine jüngsten Projekte ein wenig von der nostalgischen Note verloren haben, von der die früheren so stark geprägt waren?
AB: Schwierig, eine solche Frage über meine eigenen Projekte zu beantworten. Ich weiß, dass meine Arbeiten sich verändern, und ich finde das gut.
PR: Interessierst du dich für neue Moden in der Architektur – präziser gefragt, für organische oder blasenartige Formen?
AB: Um ehrlich zu sein, nein. Im Augenblick jedenfalls muss ich wohl noch ein bisschen wachsen, ehe ich an organischen Formen Gefallen finden kann. Aber wer weiß, vielleicht fangen auch Blasen eines Tages an mir zu gefallen …
PR/Az W: In verschiedenen Interviews hast du einige kuriose Kriterien dargelegt, nach denen sich der Wert der von dir entworfenen Gebäude bemisst. Die Hauptsache dabei ist anscheinend, dass ein Gebäude dich nicht irritieren soll. Kann dich das Erleben von zeitgenössischer Architektur bewegen?
AB: Nicht oft, aber gelegentlich schon. Leider kenne ich die wenigen modernen Gebäude, die ich aufregend finde, meistens nur von Fotos. Bauwerke von Peter Märkli, [Heinz] Bienefeld und [Peter] Zumthor beispielsweise. Ich habe allerdings das Glück gehabt, ein paar Gebäude auch in echt zu sehen – zum Beispiel [Gunnar] Asplunds Staatsbibliothek in Stockholm oder die Kirche von [Sigurd] Lewerentz in derselben Stadt. Ich habe festgestellt, das Gebäude, die auf Fotos herrlich aussehen, nicht immer herrlich sind, wenn man sie vor Ort sieht, und umgekehrt. Einmal ging ich nachts in London mit einem Freund spazieren, als der mich in den Hof des British Museum schleppte. Es war unerwartet und erstaunlich, obwohl ich natürlich von diesem Werk von Norman Foster schon gehört hatte. Ich muss sagen, ich fand diesen Raum hinreißend. Und vor ein paar Jahren hatte ich das Glück, ein Gebäude zu besichtigen, das ich aus Büchern kannte und schon die längste Zeit hatte sehen wollen, Peter Märklis Museum La Congiunta in Giornico im Tessin. Es ist ein erstaunliches Stück Architektur, und ich bin wirklich froh, dass ich ein wenig Zeit davor und darin verbringen konnte.
PR: Was hat es mit der Futurophobie auf sich, die dir üblicherweise zugeschrieben wird? Ist es möglich, futurophob zu sein und sich gleichzeitig an Fosters Hightech zu erfreuen?
AB: „Futurophobia“ war der Titel meiner Ausstellung 1997 in der Galerie Guelman. Damals war ich sicher, ich hätte das Wort erfunden. Selbst jetzt habe ich nicht wirklich nachgesehen, ob es im Wörterbuch steht. Also, es war eher ein schöner Name, der zum Inhalt der Ausstellung passte, als eine Deklaration meiner wahren Gefühle. Obwohl, wenn ich darüber nachdenke, gibt es vielleicht tatsächlich etwas von dieser Art, das in den Tiefen meines Wesens lauert. Ich sehe, wie viel von dem, was meinem Verstand und meinem Herzen lieb und teuer war, verschwunden ist. Es gibt immer weniger Interessantes, es zu ersetzen. Das lässt unzweifelhaft Futurophobie genauso wie Nostalgie entstehen.
PR: Du meinst, was gerade in Moskau passiert?
AB: Hauptsächlich in Moskau, aber nicht nur in Moskau. Zum Beispiel habe ich unlängst erfahren, dass das alte Peking so gut wie zerstört ist. Alles, was davon übrig ist, sind Bruchstücke für Touristen, wie Souvenirs. Es bedeutet, dass ein weiterer wunderbarer Ort, den ich bisher nicht die Zeit fand zu besuchen, verschwunden ist.
PR: Ist je ein Bauerherr mit einem Abriss- und Neubauauftrag an dich herangetreten?
AB: Noch nicht. Die meisten Auftraggeber haben, scheint’s, ein gewisses Maß an Vorahnung. Sie merken, an welche Architekten sie sich für welchen Auftrag wenden müssen, also verschwenden sie nicht ihre Zeit.
Az W: Wie oft hast du noch mit Kunstprojekten zu tun?
AB: Leider viel weniger oft, als mir recht wäre. Kunst mit der Arbeit als Architekt zu kombinieren ist sehr schwierig: Es fehlt einem einfach die Zeit. Aber ich brauche die Kunstprojekte und versuche jede Möglichkeit dazu zu nutzen. 2009 und 2010 waren zwei Jahre, in denen ich es geschafft habe, viele verschiedene Dinge zu tun; das wichtigste Kunstprojekt in diesem Jahr wird für mich die Ausstellung in Wien sein.
PR: Bei deinen Kunstprojekten haben dich Städte als Thema immer interessiert, was deine Einladung zur Architekturbiennale in Venedig 2006 – wo das Thema „Städte“ war – nur logisch erscheinen lässt.
AB: Mein ganzes Leben lang habe ich Städte abgebildet. Als Künstler habe ich sie abgebildet, aber ohne mich auf Fragen der Stadtplanung mit ihren sozialen Anliegen und Verkehrsproblemen usw. einzulassen. Mich fasziniert das Dasein der Stadt als Objekt, als kulturelles Phänomen. Die poetische Seite von Städten spricht mich an. Ich genieße es, Städte zu erfinden und zu zeichnen – genau so, wie Leute Träume zeichnen.
PR: Und welche Städte lassen die schönsten Träume entstehen?
AB: Moskau ist in jeder Hinsicht meine Lieblingsstadt. Zurzeit gerade ist es für mich eine echte Folter, das tagtägliche Verschwinden dieser Stadt mitanzusehen, die ich immer geliebt habe und weiter liebe. In den letzten fünfundzwanzig Jahren hat mir das den größten Schmerz bereitet. Aber darüber zu reden ändert nichts daran und bringt keine Erleichterung.
PR: In einem Interview hast du gesagt, dass die Zeit der „Paper Architects“ von einem Gefühl des festlichen Überschwangs geprägt war, befeuert von einem hohen Grad an Alkoholisierung. „Wir haben es nie geschafft, uns gehörig zu konzentrieren, Gott sei Dank“, hast du gemeint. Haben sich deine Gefühle seitdem geändert? Ist in der Architektur heute noch Platz für Freude, Humor, Scherze? Oder ist es ein todernstes Geschäft?
AB: Das Leben damals war völlig anders. Wir waren jung, wollten es uns gutgehen lassen, unbelastet von jedem Gefühl von Verantwortlichkeit. Abgesehen davon, uns zu amüsieren, gab es nichts für uns zu tun. Wir tranken, malten Bilder, bekamen manchmal Preise dafür und tranken dann noch mehr. Das ist es, woran ich mich aus dieser Phase meines Lebens erinnere. Seither hat das Leben sich radikal verändert. Ich habe jetzt Kinder. Jede Form von Verantwortung reduziert den Spiegel an Feierlaune im Blut … Und doch hat, was ich jetzt mache, auch etwas von Freude an sich. Die Tatsache, dass ich junge Leute bei mir im Atelier sitzen habe, ist ein wichtiger Teil dieses Gefühls. Sie könnten alle meine Kinder sein, und das gefällt mir ungeheuer. Es wäre vermutlich schwierig für mich, mit Leuten in meinem Alter oder älter zu arbeiten. So wie ich mich fühle, könnte ich wieder zurück im Jahr 1972 oder so sein. Und diese jungen Leute um mich herum helfen mir, diese Illusion aufrechtzuerhalten. Hin und wieder trinken wir ein paar Runden. Vielleicht ist das Unangenehmste an dieser Situation, dass ich früh aufstehen muss. Frühmorgens ist es schwierig, sich zu freuen, aber im Lauf des Tages steigt die Lebenslust und bis zum Abend hat sie den vollen Schwung.
[Das Interview wurde ursprünglich von Elena Gonzalez und Alexei Muratov für die Spezialausgabe zu Alexander Brodsky der Architekturzeitschrift Project Russia (Nr 41, 2006) geführt. Für die hier abgedruckte Version wurden teilweise Fragen hinzugefügt oder nochmals gestellt.]
Alexander Brodsky: Schwer zu sagen … Mein Vater fing als Künstler an. Er ging in Leningrad auf die Kunstschule und hatte vor, bildende Kunst zu praktizieren. An einem bestimmten Punkt allerdings hat er sich entschieden, an der Hochschule für Architektur zu studieren. Er ist zwanzig Jahre bei der Architektur geblieben und hat eine große Zahl an Gebäuden entworfen, gab die Grafik aber nie auf. Und am Ende war es die Grafik, die zu seinem Hauptberuf wurde. Ich ging auch an die Kunstschule und dachte daran, Maler zu werden. Dann aber, unter dem Einfluss der Erzählungen meines Vaters, wie toll das MArchI (Moskauer Architekturinstitut) ist, ging ich da hin. Das bedeutete überhaupt nicht, dass ich Architekt werden wollte – ich fand es einfach sehr lustig dort. Ich hatte jede Menge Freunde, eine Band namens „Luchshie gody“ („Die besten Jahre“) usw. Ich wurde von einigen brillanten Lehrern unterrichtet – Turkus, Barschtsch, Barchin. Aber jung und dumm, wie ich war, wusste ich sie nicht gebührend zu schätzen. Mir kam vor, unsere Hauptbeschäftigung war es, fröhliche Bilder für Komsomol-Tagungen und Neujahrsfeiern zu malen. Dann begannen Ilja Utkin und ich im Grenzbereich zwischen Kunst und Architektur zu arbeiten.
Az W: In den 1990er Jahren warst du mehrere Jahre lang in den USA, die erste Einladung kam 1990 vom New Yorker Galeristen Ronald Feldman. Wie erinnerst du dich an diese Zeit, den Wechsel zwischen Westen und Osten? Und was hast du für dich mitgenommen, als du nach Russland zurückgekehrt bist und schließlich Architekt wurdest?
AB: Zum ersten Mal kamen wir 1989 zu Besuch in die USA, Ilja Utkin und ich, und zeigten eine Ausstellung bei Ronald Feldman und in anderen Galerien. New York ist eine tolle Stadt für Besuche – schön und interessant. Mehrere Jahre lang reisten wir hin und her. 1996 ging ich mit meiner Familie für ein paar Monate nach New York, um eine Ausstellung aufzubauen. Und dann blieben wir fast vier Jahre. Es war sehr interessant und eine sehr harte Überlebenserfahrung. Ich machte die verschiedensten Dinge – Skulpturen, Installationen, Grafiken … Während dieser Jahre kamen viele neue Freunde hinzu, und darum habe ich immer noch eine starke Verbindung zu New York.
PR: Und wurdest schließlich Architekt …
AB: Schrittweise. Es dauerte mehr als zwanzig Jahre, ehe ich anfing, auf die Frage nach meinem Beruf „Architekt“ zu antworten. Viele Jahre lang war ich fast sicher, dass ich nie anfangen würde, wirklich zu bauen – dass das nicht mein Beruf ist, sondern einer für andere Leute, die auf irgendeine besondere Art dazu passen. Ehrlich gesagt glaube ich das auch heute noch. Es ist wie Auto fahren. Mein ganzes Leben lang war ich mir sicher, dass ich nie Auto fahren würde können; mir schien, dass es besondere Leute gibt, die das können, und dass ich keiner von ihnen bin. Dann stellte sich heraus, dass es keine große Sache ist. Und das erstaunt mich bis zum heutigen Tag. Ich fahre jetzt schon lange Zeit und wundere mich immer noch: Ich steige ins Auto, drehe den Zündschlüssel, der Wagen setzt sich in Bewegung, und plötzlich fahre ich … Mit der Architektur ist es dasselbe. Wir bauen jetzt seit sechs Jahren, und ich kann mich immer noch nicht an den Gedanken gewöhnen, dass ich tatsächlich Architekt bin. Ich staune.
PR: Architektonische Praxis tendiert immer dazu, räumlich zu expandieren – vom Kleinen zum Großen. Und nicht bloß von Plänen auf Papier zur Realisierung eines Entwurfs in Stein und Mörtel, sondern auch von kleinen Gebäuden zu zunehmend großen. Ist dir dieses Bedürfnis, etwas Großes zu schaffen, vertraut, oder bist du mit der Arbeit für private Auftraggeber völlig zufrieden?
AB: Im Moment bin ich mit dem zufrieden, was ich mache. Ich meine nicht, mit den Ergebnissen – die sind immer problematisch –, sondern mit dem Prozess an sich. Die Tatsache, dass ernsthafte Leute an mich herantreten, die wollen, dass ich ein Haus für sie entwerfe, ist mir wichtiger als die physischen Dimensionen dieses Hauses. Mir macht es viel Freude, an kleinen Details herumzutüfteln, obwohl die sich mitunter als ermüdend erweisen. Womöglich ist das ein Grund, weshalb Architekten gelegentlich riesige Gebäude entwerfen sollten – um den Augen eine Pause vom Kleinzeug zu gönnen.
PR: Du widmest dich jedem Detail?
AB: Ich versuche es jedenfalls. Im Augenblick erlaubt der Umfang unserer Aufträge es mir, mir über jede Sockelleiste Gedanken zu machen und bei jedem kleinen Detail das Sagen zu haben. Aber es wird immer schwieriger.
Az W: Wie entscheidest du, welche Materialien bei deinen Projekten verwendet werden? Du scheinst ja Grundbaustoffe wie Holz oder Ziegel zu bevorzugen. Interessierst du dich überhaupt für neue Materialien?
AB: Stimmt, ich mag lieber Baustoffe wie Holz, Ziegel oder Beton – Materialien, die mit der Zeit schöner werden. Normalerweise muss ich gar keine Materialauswahl treffen – die Entscheidung fällt mit den ersten Skizzen. Glas und Metall gefallen mir auch, und ich werde, glaube ich, in Zukunft einige neue Materialien verwenden.
PR: Könnte man sagen, dass deine gebauten Projekte die vollkommene Widerspiegelung deines kreativen Willens sind?
AB: Größtenteils ja. Schließlich kommen die meisten meiner Auftraggeber aus einem bestimmten Grund zu mir. Sie wissen mehr oder weniger, was sie wollen. Es gibt also nie die Notwendigkeit für gravierende Kompromisse.
PR: Sehen sie dich als Architekten oder als Künstler?
AB: Meine ersten beiden Auftraggeber – Marat Guelman und Sascha Eschkow – kannten mich nur als Künstler. Sie wussten allerdings, dass ich einen Abschluss in Architektur habe, und beschlossen, es zu riskieren. Der allererste war Guelman, der mich mit dem Entwurf der Innenausstattung seiner eigenen Wohnung beauftragte. Zuvor war ich einer der Künstler gewesen, die in seiner Galerie ausstellten. Fast zur gleichen Zeit bot Eschkow mir die Chance, ein Sommerrestaurant am Ufer des Kljasminskoe Reservoirs zu entwerfen (siehe Seite 33, 95° Restaurant). Diese Aufträge waren der Start zu meiner Laufbahn als Architekt. Halb Moskau hat schon die Wohnung von Guelman besichtigt. Auch das Restaurant wurde ein beliebtes Lokal; es war das erste in einer ganzen Reihe von Gebäuden, die wir in Pirogowo bauten. Interessanterweise gab es eine Verbindung zwischen den beiden Aufträgen. Eschkow lernte mich kennen, als er ein Kunstobjekt aus meiner Ausstellung in der Guelman- Galerie kaufte. Dann folgte eine Kettenreaktion: Die Entwürfe wurden veröffentlicht, ich bekam neue Projektvorschläge, und allmählich bildete sich ein Kundenkreis.
PR: Folgst du bei der Arbeit an einem Auftrag einer bestimmten Methode? Womit fängst du an: mit einem Bild, der Nutzung, baulichen Überlegungen, dem Kontext?
AB: Meine Methode ist mehr intuitiv als irgendwas sonst. Ich habe keine Grundsätze – zumindest was Stil betrifft. Ich vermute, Architekten sollten ein Art Leitprinzip haben, aber für mich hab ich ich so etwas nie formuliert, erklärt oder zu Papier gebracht. Und ich habe nie mit jemandem über meine Prinzipien gesprochen. Obwohl es Momente gab, in denen ich versuchte, im Kopf ein paar Worte zum Thema auf die Reihe zu bringen.
Az W: Es ist offensichtlich, dass das Zeichnen mit der Hand für dich eine Schlüsselrolle spielt. Aber ist der nächste Schritt in der Übersetzung von der Skizze zum Bau das Arbeitsmodell, um Raumkonzepte weiterentwickeln und testen zu können?
AB: Naürlich fange ich immer mit Zeichnungen an, aber in manchen Projektstadien werden Modelle sehr wichtig. Mein allererstes Gebäude, das 95° Restaurant (siehe Seite 33), entstand ohne alle technischen Zeichnungen, nur anhand eines Modells. Aber leider haben wir in vielen Fällen nicht die Zeit, Modelle zu bauen.
PR: Wie sehr liegen Architektur- und Kunstkritiker richtig, wenn sie über deine Schöpfungen schreiben? Wie glücklich bist du damit, wie deine Arbeit wahrgenommen wird?
AB: Ich weiß nicht. Ich lese diese Texte nicht oft. Und wenn, dann versuche ich nicht allzu sehr darauf zu achten, was darin über mich geschrieben wird. Wenn es Lob ist, schön. Und wenn sie mich kritisieren, na ja, wie’s kommt, so kommt’s … Etwas anderes ist es, wenn enge persönliche Freunde gebeten werden, etwas über einen zu schreiben. Das berührt einen.
PR: Als Autor deiner Projekte hast du also schon alles gesagt, was du mit deinen Bauwerken sagen wolltest?
AB: So sollte es idealerweise sein. Aber es macht mir nicht wirklich etwas aus, ob ich missverstanden werde. Ist es wirklich die Zeit wert, sich wegen der unrichtigen Interpretationen von irgendjemandem Sorgen zu machen? Am besten verwendet man die Energie darauf, stattdessen etwas Neues zu schaffen.
PR: Setzt du für dein Büro strategische Ziele oder Aufgaben fest, oder ziehst du es vor, mit dem Strom zu schwimmen?
AB: Wir sind jetzt seit fast sechs Jahren im Geschäft und sagen uns andauernd, dass wir irgendeine Strategie erarbeiten sollten. Ich bin sicher, wenn wir einmal eine erarbeiten, wird es die beste Strategie der Welt sein. Im Augenblick aber schwimmen wir mit dem Strom. Aber nicht mit irgendeinem Strom – es ist der Strom, den wir uns für uns selbst ausgesucht haben. Früher kam unser Büro mir nicht sehr wie ein Architekturbüro vor – es war mehr ein Klub für Architekturfreaks, ein Ort, wo man reinschauen konnte, um eine Tasse Tee zu trinken und ein bisschen was zu zeichnen. Aber jetzt robotet hier jeder bis zum Umfallen.
PR: Verwendest du persönlich einen Computer bei der Arbeit?
AB: Nein, das ist etwas, was ich nicht kann – und ich habe kein Verlangen, es zu lernen. Ich zeichne mit Bleistift auf Pauspapier, und das reicht mir.
PR: Und dann sitzt du neben jemandem aus deinem Team und gibst Anweisungen, während er oder sie am Computer zeichnet?
AB: Das ist ein wunderbares, unvergleichliches Gefühl – hinter jemandem zu sitzen und zu sagen: „Mehr nach rechts, mehr nach links. Nein, nicht so.“ Und dann zuzusehen, wie deine brillante Idee auf dem Bildschirm Gestalt annimmt. Am Ende kam ich drauf, dass diese Passion von mir der Person, die zeichnen muss, kein besonderes Vergnügen macht. Und bei ihm oder ihr sogar zu leichter Irritation führen kann. Aber trotzdem gibt es Momente, in denen ich mir diesen Genuss nicht versagen kann.
Az W: Wie wichtig ist es für dich, Zeit auf der Baustelle zu verbringen?
AB: Sehr wichtig. Es ist erstaunlich, dabei zuzusehen, wie aus einer Skizze, einer Idee ein Gebäude wird. Das Wichtige für mich persönlich ist dabei, dass immer eine kleine Chance besteht, während des Baus noch etwas zu ändern, wenn man einen Fehler entdeckt. Hab ich schon viele Male gemacht.
PR/Az W: Findest du Unterrichten als Beruf attraktiv? Hat man dich eingeladen, am MArchI zu lehren?
AB: Vor einigen Jahren schaute ich auf der Suche nach, glaube ich, gutem Zeichenpapier zufällig im MArchI vorbei und wurde unerwartet von einigen sehr ernsthaften Leuten mit dem Vorschlag angesprochen, dort zu lehren. Ich war dafür überhaupt nicht bereit und sagte das auch. Was hätte ich den Studenten schon beibringen können? Bloß zehn Arten, eine Bierflasche aufzumachen. Letztes Jahr aber habe ich es mir anders überlegt und einen Versuch gemacht, zu unterrichten. Es war ein Semester an der École Especial d’Architecture in Paris. Es war nett und interessant und einmal etwas ganz Anderes. Jetzt habe ich wenigstens ein klein bisschen Erfahrung, aber ich bin nicht sicher, dass ich es bald wieder tue.
PR: Eine anerkannte Ansicht besagt, dass das wichtigste Leitmotiv deiner Arbeit Nostalgie ist. Wie ein Kritiker schrieb: „Brodsky hat aus seiner Nostalgie eine künstlerische Technik gemacht.“ Was für eine Nostalgie ist das?
AB: Diese weitverbreitete Meinung ist, glaube ich, daraus entstanden, dass ich im Laufe der Jahre meines Künstlerdaseins viel Zeit damit verbracht habe, Ruinen abzubilden. Ich habe zusammen mit Ilja Utkin Ruinen gezeichnet, und auch allein. Ich habe Ruinen aus Ton geformt und Ruineninterieurs und -installationen gemacht. Der Grund dafür war möglicherweise, dass das größte Problem, das ich während des Studiums am MArchI hatte, meine Unfähigkeit war, moderne Architektur zu verstehen. Ich hab mich dahintergeklemmt und zu begreifen versucht, wie und warum sie mir gefallen sollte, aber ich konnte es nicht. Allerdings habe ich Piranesi und folglich auch römische Ruinen – und auch alle anderen – immer schon bewundert. Das war für mich Architektur, die ich lieben konnte. Wenn nötig, ging ich wie alle anderen Studenten in die Bibliothek, nahm mir eine Zeitschrift und kopierte Entwürfe von, sagen wir, Paul Rudolph oder James Stirling, ohne das kleinste bisschen Gefühl dafür, ohne zu verstehen, warum ich es tat, und ohne zu glauben, dass irgendetwas Bedeutsames dahinter war. Genauso wenig war ich in der Lage, den russischen Konstruktivismus zu verstehen oder zu mögen. Um mich von meinem eigenen Versagen abzulenken und zu beruhigen, zeichnete ich Ruinen.
PR: Es gibt allerdings auch Leute, die so etwas nicht reizt. Stattdessen entwerfen sie neue Gebäude im klassischen Stil: Michail Filippow, zum Beispiel, oder dein früherer Partner Ilya Utkin.
AB: Sie sind die augenscheinlichen Erben der Tradition Palladios, und dafür soll man sie respektieren. Was mich betrifft, ich war vom reinen Neoklassizismus nie sehr angetan. Jedenfalls nicht so sehr angetan, dass ich bei Palladios Grab auf das System der Ordnung schwören würde. Ich empfand weiterhin eine zarte Liebe zu aller klassischen Architektur, träumte gleichzeitig aber davon, die zeitgenössische Architektur auch zu lieben. Und am Ende gelang mir das auch. Bedanken muss ich mich dafür bei meinem alten Freund Evgene Asse, der bei meiner Bildung in dieser Hinsicht eine Schlüsselrolle spielte. Wann immer wir miteinander tranken und redeten, zeigte er mir irgendetwas, was er in letzter Zeit in verschiedenen Teilen der Welt gebaut hatte, und das traf immer genau den Punkt und fesselte meine Fantasie. Allmählich gewann ich einen Standpunkt, erwarb mir einen eigenständigen Geschmack und hatte Lieblingsbauten, Lieblingsarchitekten.
PR: Du hast also in dem Moment ein Verständnis für zeitgenössische Architektur entwickelt, als du selbst praktizierender Architekt wurdest?
AB: Nein, ein bisschen davor. Sonst hätte ich den ersten Schritt wahrscheinlich gar nicht gemacht.
Az W: Kann man sagen, dass deine jüngsten Projekte ein wenig von der nostalgischen Note verloren haben, von der die früheren so stark geprägt waren?
AB: Schwierig, eine solche Frage über meine eigenen Projekte zu beantworten. Ich weiß, dass meine Arbeiten sich verändern, und ich finde das gut.
PR: Interessierst du dich für neue Moden in der Architektur – präziser gefragt, für organische oder blasenartige Formen?
AB: Um ehrlich zu sein, nein. Im Augenblick jedenfalls muss ich wohl noch ein bisschen wachsen, ehe ich an organischen Formen Gefallen finden kann. Aber wer weiß, vielleicht fangen auch Blasen eines Tages an mir zu gefallen …
PR/Az W: In verschiedenen Interviews hast du einige kuriose Kriterien dargelegt, nach denen sich der Wert der von dir entworfenen Gebäude bemisst. Die Hauptsache dabei ist anscheinend, dass ein Gebäude dich nicht irritieren soll. Kann dich das Erleben von zeitgenössischer Architektur bewegen?
AB: Nicht oft, aber gelegentlich schon. Leider kenne ich die wenigen modernen Gebäude, die ich aufregend finde, meistens nur von Fotos. Bauwerke von Peter Märkli, [Heinz] Bienefeld und [Peter] Zumthor beispielsweise. Ich habe allerdings das Glück gehabt, ein paar Gebäude auch in echt zu sehen – zum Beispiel [Gunnar] Asplunds Staatsbibliothek in Stockholm oder die Kirche von [Sigurd] Lewerentz in derselben Stadt. Ich habe festgestellt, das Gebäude, die auf Fotos herrlich aussehen, nicht immer herrlich sind, wenn man sie vor Ort sieht, und umgekehrt. Einmal ging ich nachts in London mit einem Freund spazieren, als der mich in den Hof des British Museum schleppte. Es war unerwartet und erstaunlich, obwohl ich natürlich von diesem Werk von Norman Foster schon gehört hatte. Ich muss sagen, ich fand diesen Raum hinreißend. Und vor ein paar Jahren hatte ich das Glück, ein Gebäude zu besichtigen, das ich aus Büchern kannte und schon die längste Zeit hatte sehen wollen, Peter Märklis Museum La Congiunta in Giornico im Tessin. Es ist ein erstaunliches Stück Architektur, und ich bin wirklich froh, dass ich ein wenig Zeit davor und darin verbringen konnte.
PR: Was hat es mit der Futurophobie auf sich, die dir üblicherweise zugeschrieben wird? Ist es möglich, futurophob zu sein und sich gleichzeitig an Fosters Hightech zu erfreuen?
AB: „Futurophobia“ war der Titel meiner Ausstellung 1997 in der Galerie Guelman. Damals war ich sicher, ich hätte das Wort erfunden. Selbst jetzt habe ich nicht wirklich nachgesehen, ob es im Wörterbuch steht. Also, es war eher ein schöner Name, der zum Inhalt der Ausstellung passte, als eine Deklaration meiner wahren Gefühle. Obwohl, wenn ich darüber nachdenke, gibt es vielleicht tatsächlich etwas von dieser Art, das in den Tiefen meines Wesens lauert. Ich sehe, wie viel von dem, was meinem Verstand und meinem Herzen lieb und teuer war, verschwunden ist. Es gibt immer weniger Interessantes, es zu ersetzen. Das lässt unzweifelhaft Futurophobie genauso wie Nostalgie entstehen.
PR: Du meinst, was gerade in Moskau passiert?
AB: Hauptsächlich in Moskau, aber nicht nur in Moskau. Zum Beispiel habe ich unlängst erfahren, dass das alte Peking so gut wie zerstört ist. Alles, was davon übrig ist, sind Bruchstücke für Touristen, wie Souvenirs. Es bedeutet, dass ein weiterer wunderbarer Ort, den ich bisher nicht die Zeit fand zu besuchen, verschwunden ist.
PR: Ist je ein Bauerherr mit einem Abriss- und Neubauauftrag an dich herangetreten?
AB: Noch nicht. Die meisten Auftraggeber haben, scheint’s, ein gewisses Maß an Vorahnung. Sie merken, an welche Architekten sie sich für welchen Auftrag wenden müssen, also verschwenden sie nicht ihre Zeit.
Az W: Wie oft hast du noch mit Kunstprojekten zu tun?
AB: Leider viel weniger oft, als mir recht wäre. Kunst mit der Arbeit als Architekt zu kombinieren ist sehr schwierig: Es fehlt einem einfach die Zeit. Aber ich brauche die Kunstprojekte und versuche jede Möglichkeit dazu zu nutzen. 2009 und 2010 waren zwei Jahre, in denen ich es geschafft habe, viele verschiedene Dinge zu tun; das wichtigste Kunstprojekt in diesem Jahr wird für mich die Ausstellung in Wien sein.
PR: Bei deinen Kunstprojekten haben dich Städte als Thema immer interessiert, was deine Einladung zur Architekturbiennale in Venedig 2006 – wo das Thema „Städte“ war – nur logisch erscheinen lässt.
AB: Mein ganzes Leben lang habe ich Städte abgebildet. Als Künstler habe ich sie abgebildet, aber ohne mich auf Fragen der Stadtplanung mit ihren sozialen Anliegen und Verkehrsproblemen usw. einzulassen. Mich fasziniert das Dasein der Stadt als Objekt, als kulturelles Phänomen. Die poetische Seite von Städten spricht mich an. Ich genieße es, Städte zu erfinden und zu zeichnen – genau so, wie Leute Träume zeichnen.
PR: Und welche Städte lassen die schönsten Träume entstehen?
AB: Moskau ist in jeder Hinsicht meine Lieblingsstadt. Zurzeit gerade ist es für mich eine echte Folter, das tagtägliche Verschwinden dieser Stadt mitanzusehen, die ich immer geliebt habe und weiter liebe. In den letzten fünfundzwanzig Jahren hat mir das den größten Schmerz bereitet. Aber darüber zu reden ändert nichts daran und bringt keine Erleichterung.
PR: In einem Interview hast du gesagt, dass die Zeit der „Paper Architects“ von einem Gefühl des festlichen Überschwangs geprägt war, befeuert von einem hohen Grad an Alkoholisierung. „Wir haben es nie geschafft, uns gehörig zu konzentrieren, Gott sei Dank“, hast du gemeint. Haben sich deine Gefühle seitdem geändert? Ist in der Architektur heute noch Platz für Freude, Humor, Scherze? Oder ist es ein todernstes Geschäft?
AB: Das Leben damals war völlig anders. Wir waren jung, wollten es uns gutgehen lassen, unbelastet von jedem Gefühl von Verantwortlichkeit. Abgesehen davon, uns zu amüsieren, gab es nichts für uns zu tun. Wir tranken, malten Bilder, bekamen manchmal Preise dafür und tranken dann noch mehr. Das ist es, woran ich mich aus dieser Phase meines Lebens erinnere. Seither hat das Leben sich radikal verändert. Ich habe jetzt Kinder. Jede Form von Verantwortung reduziert den Spiegel an Feierlaune im Blut … Und doch hat, was ich jetzt mache, auch etwas von Freude an sich. Die Tatsache, dass ich junge Leute bei mir im Atelier sitzen habe, ist ein wichtiger Teil dieses Gefühls. Sie könnten alle meine Kinder sein, und das gefällt mir ungeheuer. Es wäre vermutlich schwierig für mich, mit Leuten in meinem Alter oder älter zu arbeiten. So wie ich mich fühle, könnte ich wieder zurück im Jahr 1972 oder so sein. Und diese jungen Leute um mich herum helfen mir, diese Illusion aufrechtzuerhalten. Hin und wieder trinken wir ein paar Runden. Vielleicht ist das Unangenehmste an dieser Situation, dass ich früh aufstehen muss. Frühmorgens ist es schwierig, sich zu freuen, aber im Lauf des Tages steigt die Lebenslust und bis zum Abend hat sie den vollen Schwung.
[Das Interview wurde ursprünglich von Elena Gonzalez und Alexei Muratov für die Spezialausgabe zu Alexander Brodsky der Architekturzeitschrift Project Russia (Nr 41, 2006) geführt. Für die hier abgedruckte Version wurden teilweise Fragen hinzugefügt oder nochmals gestellt.]
Für den Beitrag verantwortlich: Hintergrund
Ansprechpartner:in für diese Seite: Martina Frühwirth