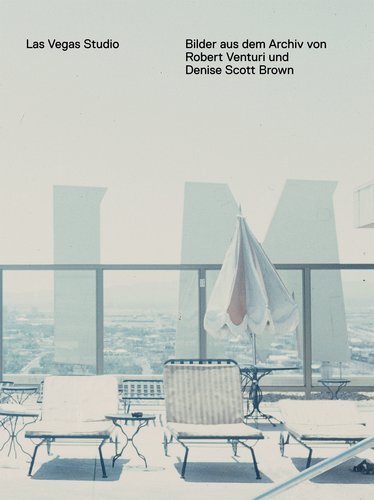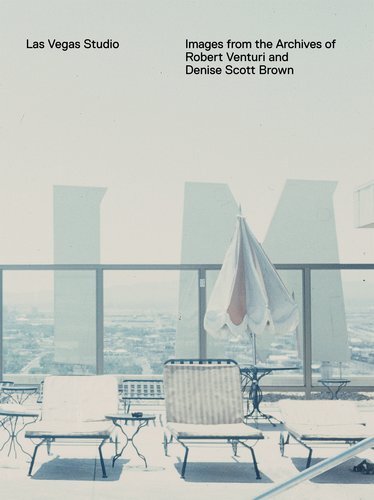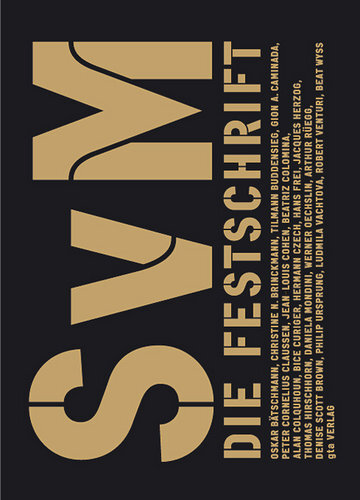Artikel
Ein Laufsteg für die Diva
Die Architektin Zaha Hadid im New Yorker Guggenheim Museum
Das New Yorker Guggenheim Museum feiert Zaha Hadid, das Enfant terrible der zeitgenössischen Architektur, mit einer breit angelegten Retrospektive. Die Ausstellung in Frank Lloyd Wrights Museumsrotunde ist ein fulminanter Bilderreigen, der viele Fragen offen lässt.
Nach der vielbesuchten Frank-Gehry-Schau im Jahr 2001 ist die derzeitige Zaha-Hadid-Ausstellung für das vor bald fünfzig Jahren nach Plänen von Frank Lloyd Wright errichtete Guggenheim Museum in New York die zweite üppig ausgebreitete Retrospektive zu einem Star der zeitgenössischen Architektur. Die 1950 in Bagdad geborene und in London tätige Zaha Hadid, die 2004 als erste und bisher einzige Frau mit dem Pritzker- Architekturpreis geadelt wurde, versteht die New Yorker Veranstaltung als eine Art «Heimkehr», hatte sie doch 1992 für die Ausstellung «The Great Utopia» zur sowjetischen Avantgardearchitektur im Guggenheim Museum das Ausstellungsdesign beigesteuert. Daneben machte sie sich mit ihren prächtigen Architekturbildern auf dem Kunstmarkt einen Namen. Denn ihre architektonischen Visionen galten als unausführbar - bis sie 1994 mit dem Vitra-Feuerwehrhaus in Weil am Rhein den Gegenbeweis antreten konnte.
Schau mit Schwächen
Dass sich das Guggenheim 1992 nicht zufällig an die umtriebige Baukünstlerin gewandt hatte, wird bei einem Gang durch die kürzlich eröffnete Retrospektive deutlich. Diese beleuchtet von Hadids Diplomarbeit an der Londoner Architectural Association im Jahre 1977 bis zur Gegenwart das Gesamtwerk der Architektin und Designerin. Der Schwerpunkt der weitgehend chronologisch aufgebauten Ausstellung liegt bei den grossformatigen Architekturbildern, mit denen der Rundgang eröffnet wird. Für das Medium der Malerei hatte sich Hadid entschieden, weil konventionelle Mittel der architektonischen Repräsentation wie der Grund- und Aufriss oder die Isometrie ihrer Meinung nach dem Entwurf und der Darstellung ihrer experimentellen Raumgebilde nicht genügten. In der Tat handelt es sich um abstrakte Gemälde, die von architektonischer Vorstellungskraft zeugen, aber keine physische Wirklichkeit wiedergeben. Charakteristisch ist das Nebeneinander unterschiedlicher Perspektiven, das es den Betrachtern schwer macht, die Bilder zu dechiffrieren. Es sind gemalte Architektur-Utopien, die an die von gesellschaftlichem Aufbruch und technischem Optimismus geprägten 1960er Jahre ebenso anschliessen wie an die Arbeiten der konstruktivistisch ausgerichteten russischen Avantgarde der 1920er Jahre.
Deren Einfluss ist in Hadids Frühwerk allenthalben ablesbar; die Diplomarbeit «Malewitschs Tektonik» das erste Exponat der Ausstellung bildet gleichsam eine Hommage an den Protagonisten der suprematistischen Malerei. Von visueller Prägnanz und bisweilen berückender Schönheit sind die zweidimensionalen Stadtlandschaften. Sie bezeugen Hadids intensive Recherche an der Schnittstelle von Architektur und Städtebau, die 2003 mit dem Rosenthal Center for Contemporary Art in Cincinnati eine überzeugende Umsetzung fand. Besonderes Augenmerk verdient in diesem Zusammenhang auch das längst legendäre Projekt «The Peak» in Hongkong, mit dem Hadid 1983 schlagartig ins Rampenlicht der Architekturwelt trat. Die Präsentation des Projekts zusammen mit ihren frühesten, ungefähr zeitgleich ausgeführten Möbelentwürfen auf der ersten Rampe von Wrights Rotunde unterstreicht die zentrale Bedeutung dieser Arbeit auch in der Ausstellung.
Dass die Schau primär um formale Fragestellungen kreist, wird in der Sektion der ästhetisch nicht minder ansprechenden Modelle - vom Papierrelief bis hin zur Kunstharzmaquette - deutlich. Dieser Abschnitt bricht den chronologischen Ablauf der Ausstellung vorübergehend auf: Die Modelle sind zu thematischen Blöcken gruppiert und zeigen dabei entwerferische Grundkonstanten Hadids auf. Sie basieren auf Begriffen wie «Felder», «Bänder» oder «Clusters», die den konzeptuellen Ansatz ihrer Architektur illustrieren. Die Sichtbarmachung des Transformationsvorgangs von abstrakten Kräften im urbanen Raum zum gebauten Körper ist eines der Verdienste des für die Ausstellung gewählten formalistischen Ansatzes. Allerdings geht dieser auf Kosten des Informationsgehalts, aber auch der Dokumentation der realisierten Bauten, die nur am Rande mit einigen Schwarzweissfotografien und eingestreuten Videoprojektionen geleistet wird.
Dabei kommen hauptsächlich Grossbauten aus jüngster Zeit wie das Phæno Science Center in Wolfsburg oder die BMW-Fabrik in Leipzig (beide 2005), aber auch Infrastrukturbauten wie die Tramendstation in Strassburg zur Sprache. Unbefriedigend ist auch die Präsentation der aktuellen Projekte im zweiten Teil der Ausstellung. Sie sind wie Tapeten als grossformatige Farbbilder und Renderings auf ondulierende Seitenwände aufgezogen und lassen jede Hintergrundinformation vermissen. Die Visualisierung von Bauwerken ist ebenso wenig das Ziel der Schau wie die Präsentation des Architekturbüros als kreativer Werkstatt, wie es jüngst bei den Ausstellungen von Renzo Piano, Rem Koolhaas oder Herzog & de Meuron der Fall war.
Verflüssigung des Raums
Dafür trägt der chronologische Ausstellungsaufbau zum Verständnis der Evolution des formalen Repertoires bei. Während Hadids frühe Arbeiten mit ihren (de)konstruktivistischen Anleihen von einer Hard-Edge-Ästhetik geprägt sind, zeigt sich in den jüngeren Projekten von urbanem Massstab mehr und mehr eine Tendenz zur Verflüssigung, indem sich die futuristischen Entwürfe als geronnene Hohlformen dynamischer Kraftfelder oder als Kommunikations- und Bewegungskanäle der Stadt erweisen.
Das Thema der Verflüssigung des Raumes die grundlegende Entwicklungstendenz von Hadids Architektur in den vergangenen drei Jahrzehnten knüpft überdies an den Genius Loci an, wurde doch schon Wrights Museumsbau in der zeitgenössischen Kritik als Triumph räumlicher Verflüssigung gefeiert. Die Dialektik zwischen dem Oberpriester der Moderne und der Diva des zeitgenössischen Architekturbetriebs hätte in diesem Spannungsfeld durchaus noch eine pointiertere Inszenierung erlaubt.
[ Bis 25. Oktober. Katalog: Zaha Hadid. Guggenheim Museum Publications / D. A. P., New York 2006. 198 S., $ 39.95. ]
Kristalline Schatzkisten
Renzo Pianos Erweiterung der New Yorker Morgan Library
Die Sammlung der New Yorker Morgan Library zählt mit Schwerpunkten auf den Gebieten der europäischen Meisterzeichnung, der literarischen und musikalischen Handschriften, der Buchmalerei sowie der Siegel weltweit zu den bedeutendsten ihrer Art. Die Ursprünge der Institution gehen auf die private Bibliothek des Financiers Pierpont Morgan (1837-1913) zurück, dessen Sammlertätigkeit die kulturellen Aspirationen des damaligen New Yorker Geldadels bezeugt. Zur Behausung der wachsenden Bestände beauftragte Morgan 1902 Charles McKim mit dem Bau eines Bibliotheksgebäudes im Stil der italienischen Renaissance, das wegen seiner exquisiten Steinfassade und seiner prunkvollen Innenausstattung als Vorzeigebau der amerikanischen Beaux-arts-Architektur gilt.
Dem wachsenden Raumbedarf antwortend, nahm man in den folgenden Jahrzehnten bauliche Ergänzungen vor, so dass sich der Sitz der Institution zuletzt als unübersichtliches Konglomerat von Einzelbauten präsentierte. Mit der jüngst vollendeten Erweiterung, der grössten in der Geschichte der Morgan Library, sollte dieser Situation Abhilfe geschaffen und zugleich die Ausstellungsfläche des Museums verdoppelt werden. Überdies sah das Programm den Bau eines Auditoriums, eines neues Lesesaals sowie zusätzlichen Lagerraums vor. Mit der Ausführung wurde Renzo Piano betraut, der nun nach knapp dreijähriger Bauzeit in Zusammenarbeit mit dem lokalen Büro Beyer Blinder Belle seinen ersten Bau in der Stadt fertigstellen konnte.
Pianos Intervention zeichnet sich durch einen respektvollen Umgang mit dem Baubestand aus, dem gegenüber sich die neue Stahl-Glas-Architektur in vornehmer Zurückhaltung übt. Die zentrale Entwurfsidee besteht in einem viergeschossigen, glasüberdachten Innenhof, der die einzige dramatische Geste des Neubaus darstellt. Als interne Piazza ausgebildet, verbindet er die komplexe Anlage zu einer kleinen Stadt in der Stadt. Von hier aus werden die Altbauten sowie die drei pavillonartig dazwischengestellten neuen kristallinen Kisten erschlossen. Das geschickte Spiel des Architekten mit dem Licht zeigt sich im Kontrast von lichtdurchfluteter Halle und abgedunkelten Galerieräumen, aber auch im ausgeklügelten System von indirektem Natur- und Kunstlicht im Cube genannten kleinsten der drei Pavillons, in welchem Höhepunkte der Sammlung präsentiert werden. Als entscheidend für den erneuerten Auftritt der «Morgan» in New Yorks kulturellem Leben erweist sich die Verlegung des Haupteingangs von einer Seitenstrasse an die Madison Avenue.
Obwohl Piano mit der verglasten Eingangsebene und zwei mit Metallpaneelen verkleideten Obergeschossen auf Reduktion setzt, wird der repräsentative Anspruch durch die Symmetrie und die schöne Proportionierung der Fassade dezent, aber nachhaltig unterstrichen. Daneben trägt auch die Transparenz zur gewünschten Öffnung der Institution bei. Trotz diesen Vorzügen sind einige Fragezeichen zu setzen - nämlich bei der Materialwahl. So bezeichnet der Architekt zwar Stahl und Glas als «ehrliche» Materialien, lässt dann aber sämtliche Metalloberflächen unter einer hellen Bemalung verschwinden, deren leichter Rosaton sich am Marmor von McKims Gebäude orientiert. Auch sind die sichtbaren Träger und Stützen sowie die etwas banal anmutende Vertikalverglasung im Stil der anonymen Geschäftshausarchitektur eher den High-Tech-Attitüden des Architekten geschuldet als dem Ausdruck des Charakters der Institution. Indes belegt der rege Besucherzustrom seit der Wiedereröffnung, dass die Erweiterung Anklang findet. Und bereits kündigen sich mit dem Neubau des Hauptsitzes der «New York Times», der geplanten Erweiterung des Whitney Museum und der Neuplanung des Campus der Columbia University weitere New Yorker Arbeiten des Italieners an.
Leise Aufbruchstimmung am Jurasüdfuss
Bauten von Geninasca Delefortrie in Neuenburg
Baukunst ist derzeit in der Romandie weit weniger ein Thema als in der deutschsprachigen Schweiz. Gleichwohl trifft man vom Wallis bis zum Jura vermehrt auf interessante Architekturbüros. In Neuenburg sind es Geninasca Delefortrie Architectes, die in den vergangenen Jahren mit einer Reihe spannender Neubauten überraschten.
Im Jahr 2002 durfte man aufgrund der Expo hoffen, dass Neuenburg fortan auch in Sachen Architektur vermehrt ins nationale Bewusstsein rücken würde. Doch richtete sich der Blick der Schweizer Öffentlichkeit nur einen Sommer lang auf die Stadt am Jurasüdfuss, um sich anschliessend wieder dem Courant normal zuzuwenden. In Architektenkreisen begegnete man der Indienstnahme des Bauens durch das Spektakel ohnehin mit Reserve, ist doch die Baukunst im Zeichen des Bilbao-Effekts ohnehin schon längst auf die Logik von Stadtmarketing und Tourismus eingeschwenkt. Auch in der Neuenburger Architekturszene scheint die Aufbruchstimmung der Expo 02 mehr oder weniger wirkungslos verpufft zu sein, wenngleich die Neubauten von Bauart Architekten für das Bundesamt für Statistik am Espace de l'Europe noch immer die Aufmerksamkeit des Fachpublikums auf sich zu ziehen vermögen. Die weniger inspirierten Wohn- und Geschäftshäuser mit ihren Lochfassaden, die den Strassenzug seit kurzem komplettieren, belegen jedoch ein weiterhin eher geringes Interesse an zeitgenössischer Architektur. In der Tat erhält die lokale Szene keine Impulse von einer Fachhochschule, und auch die Universität bietet keine Architekturausbildung an. Die Architekten beziehen ihre Inspiration daher von aussen oder aber aus der lokalen Tradition, die eine Reihe barocker Palais und klassizistischer Gebäude im harmonischen Stadtbild hinterlassen hat.
Auseinandersetzung mit der Stadt
Dafür, dass sich auch unter erschwerten Bedingungen qualitätvolle Architektur planen und ausführen lässt, stehen die in jüngerer Zeit entstandenen Bauten des Büros Geninasca Delefortrie Architectes. Die treibenden Kräfte des seit rund zehn Jahren in Neuenburg agierenden Büros sind der Belgier Bernard Delefortrie sowie Laurent Geninasca, der sein Diplom an der ETH Zürich erwarb. Das Büro beschäftigt rund 25 Mitarbeiter, was umso mehr überrascht, als Geninasca Delefortrie ihr Auftragsbuch bisher vorwiegend durch siegreiche Wettbewerbsprojekte füllen konnten. Spätestens mit dem Gewinn der Ausmarchung um das neue städtische Fussballstadion in der Maladière, das sich zurzeit im Rohbau befindet, drang das Büro auch in das Bewusstsein einer breiteren Öffentlichkeit; auf dem benachbarten Grundstück konnten die Architekten kürzlich ebenfalls im Auftrag der Stadt eine Dreifachturnhalle mit charakteristischer schwarzer Holzfassade und Sheddach fertig stellen. Dass Laurent Geninasca zu den kreativen Köpfen der Stadt gehört, stellte der Architekt mit Jahrgang 1958 bereits 1994 unter Beweis: Gemeinsam mit dem Architekten Luca Merlini und dem Journalisten Michel Jeannot heckte er damals ein Konzept für die Durchführung einer Landesausstellung in Neuenburg aus. Obwohl die einstigen Vordenker von der anlaufenden Expo-Maschinerie ausgebootet wurden und in deren öffentlicher Wahrnehmung keine Rolle mehr spielten, ist doch die erfolgreiche Idee der Arteplages dem ad hoc gebildeten Dreierbund zu verdanken.
Trotz der Marginalisierung im Rahmen der Expo 02 ist Geninascas Büro zu einer treibenden Kraft der lokalen Architekturszene geworden. Das sichtbarste Zeichen dafür bildet neben dem im Entstehen begriffenen Maladière-Stadion die vor Jahresfrist vollendete neue Filiale der Migrosbank. Der siebengeschossige Bau über polygonalem Grundriss befindet sich an städtebaulich sensibler Stelle, bildet er doch den Kopf einer kurzen Häuserzeile zwischen dem schmalen Faubourg du Lac und der Avenue du Premier-Mars, die die Neustadt mit dem mittelalterlichen Stadtkern verbindet. Damit liegt das Geschäftshaus an einer wichtigen Scharnierstelle im Stadtgrundriss, an der unterschiedliche Epochen und Massstäbe aufeinander treffen. Diese Ausgangslage erhoben die Architekten zur entwerferischen Leitidee: Von Osten her gesehen, markiert der turmartige Neubau das Eingangstor zum historischen Stadtkern und tritt mit seinen sieben Geschossen der monumentalen Hauptpost von 1896 auf der anderen Seite der Avenue du Premier-Mars selbstbewusst entgegen. Von der im Altstadtbereich gelegenen Place Numa-Droz aus sind dagegen aufgrund eines Fassadenknicks nur zwei Achsen des Neubaus erkennbar. Dadurch und dank der mittels eines abfallenden Pultdachs verringerten Geschosszahl orientiert sich der Bau in dieser Richtung am Massstab der kleinteiligen Bebauung der Häuserzeile aus dem 18. Jahrhundert, deren östlichen Abschluss er bildet.
Das Gebäude präsentiert sich also mit zwei grundlegend verschiedenen Gesichtern; der Einordnung in die traditionelle Zeilenbauweise steht der prononciert öffentliche Charakter zur Place Alexis-Marie Piaget entgegen. Hier ist auch der Eingang zu den Schalterräumen situiert. Ist das Parterre der Banknutzung vorbehalten, befinden sich in den Obergeschossen Büroräume sowie Wohnungen. Die rigide Gliederung der Lochfassade durch raumhohe, hochrechteckige Fenster mit seitlichen Lüftungsklappen wird durch die verglaste Eckpartie mit Eingangszone, die Schaufenster im Erdgeschoss sowie ein quadratisches Panoramafenster an der Ostfassade unterlaufen, die bündig an der Fassade anliegen und die Tektonik des Rasters aus der Ferne in ein zweidimensionales Bild auflösen. Körperlichkeit gewinnt der Bau erst von nahem durch einen groben, ockerfarbenen Putz. Dessen Farbton verweist auf den Hauterive-Kalkstein, das traditionelle Baumaterial, welches wesentlich zum einheitlichen Gepräge der Stadt beiträgt.
Janusköpfige Bauten
Der gebaute Kontext bildet auch bei einer Wohnüberbauung, die Geninasca Delefortrie jüngst in Serrières realisieren konnten, einen ersten Referenzpunkt. In diesem heterogenen Aussenquartier von Neuenburg stossen Industriebauten, Wohnblöcke der sechziger Jahre sowie Zeugen der Zeit um 1900 unvermittelt aufeinander. Im Auftrag der städtischen Pensionskasse bauten die Architekten hier vierzig preiswerte Mietwohnungen, die auf vier Etagen U-förmig um einen zentralen Innenhof mit Spielplatz angelegt sind, was der Überbauung einen intimen Charakter verleiht. Daneben sind primär zwei Elemente bestechend: erstens die Privilegierung des öffentlichen Raumes gegenüber den konventionell zugeschnittenen Wohnungen. Diese werden über breite Laubengänge erschlossen, die sich als Aufenthalts- und Begegnungsraum eignen, aber die private Möblierung ausdrücklich zulassen. Zweitens überzeugt die ungewöhnliche Verwendung herkömmlicher Materialien, wie man sie von der niederländischen Architektur - etwa der Siedlung von MVRDV auf Hageneiland - her kennt: Von den mit leuchtend roten Dachziegeln verkleideten Fassaden heben sich die Lauben rundum in hellem Holz ab, so dass man sich selbst im Aussenraum wie in einem Chalet wähnt. Ihren Sinn für Materialien und Strukturen haben Geninasca Delefortrie auch bei einem Wohnbau im Stadtteil Peseux bewiesen, der gewissermassen das bürgerliche Pendant zur Siedlung in Serrières bildet.
In abschüssiger Lage sind in dem kompakten Bau mit annähernd quadratischem Grundriss zehn Wohnungen untergebracht. Im Vergleich zur populären Materialsprache in Serrières kam man hier mit einer Betonfassade den Geschmacksvorstellungen eines gehobeneren Zielpublikums entgegen. Die aufgeraute, linear strukturierte Oberfläche erweist den rustizierten Sockeln aus Jurakalkstein in der Nachbarschaft eine Reverenz, bildet aber für den kubischen Solitär zugleich eine ansprechende, ornamental über die Aussenseite des Baus gelegte Bekleidung. Ihre haptische Qualität wird am ehesten in einer schmalen Stiege spürbar, die dem Haus entlang vom höher gelegenen Plateau zur Hauptstrasse führt. In die schuppenartige Oberfläche sind verglaste Türen, breite, bronzefarbene Metallfenster sowie tiefe Eckterrassen eingeschnitten, ohne dass dadurch der monolithische Gesamteindruck des Baus beeinträchtigt wird. Trotz der einheitlichen Oberflächengestaltung ist er wie die Migrosbank von janusköpfigem Charakter: Während er mit seiner Höhe zur Hauptstrasse hin Urbanität markiert, passt er sich rückseitig raffiniert dem Massstab der vorherrschenden Einfamilienhausbebauung an.
Beispielhafte Lösungen
Dass Geninasca und Delefortrie einen Sinn für topographische Besonderheiten haben, bewiesen sie nicht zuletzt mit dem Kindergarten der Gemeinde Bevaix. Das Programm umfasste neben einem Lehrerzimmer sechs Klassenräume, die in einem Bau auf dem Gelände des ehemaligen Gemeindefriedhofs untergebracht werden sollten. Von diesem blieben lediglich die Umfassung aus Bruchsteinmauerwerk sowie das prachtvolle Eingangstor erhalten. Geninasca Delefortrie begegneten dieser Vorgabe, indem sie in das leicht abschüssige Geviert einen flachen, eingeschossigen Neubau stellten. Sein Rückgrat bildet ein interner Weg, der sich längs durch das Gebäude zieht und dem ansteigenden Terrain folgt. Die holzverkleideten Klassenräume sind aufgrund dieses Arrangements durch leichte Niveausprünge voneinander abgesetzt, was insbesondere im umlaufenden Aussenraum deutlich wird, wo jedes Zimmer über eine kleine Grünfläche zwischen Gebäude und Umfassungsmauer verfügt.
Zusätzlichen Freiraum bietet der rückwärtige Teil der Anlage, wo eine ausgesparte Gebäudeecke mit der Umfassungsmauer einen geschützten und doch offenen Pausenraum entstehen lässt. Der Neubau mit seinen grossen Fensterscheiben duckt sich unauffällig auf seinem Terrain. Es entsteht eine quasi symbiotische Beziehung mit der Umgebung, die durch das begrünte Flachdach und die raue, die Natursteinmauer architektonisch reflektierende Textur des Sichtbetons betont wird. Damit konnte auch im Fall des Kindergartens von Bevaix eine beispielhafte Lösung für die Neunutzung einer nicht unproblematischen Parzelle gefunden werden.
Ein Stück Stadt auf dem Lande
Das neue Verwaltungszentrum in Affoltern am Albis
Affoltern am Albis hat in den letzten Jahren einen Bauboom erlebt, der kaum von einem Bekenntnis zu qualitativ hochstehender Architektur begleitet war. Nun setzt die Gemeinde mit dem neuen Verwaltungszentrum ein Zeichen. Der Neubau von Müller Sigrist Architekten verleiht dem wild gewachsenen Ort ein urbanes Selbstverständnis.
Trotz der regionalen Bedeutung von Affoltern am Albis als Hauptort des Knonauer Amtes waren die Behörden der Ortschaft bis vor kurzem auf eine Reihe von Häusern im halben Dorf verteilt. Mit dem Entscheid, ihre Ämter unter einem Dach zu vereinen, ging für die Gemeinde das mutige Bekenntnis zu einer Architektur einher, die der zunehmen-den Urbanisierung von Affoltern gerecht werden will. Einen zweistufigen Wettbewerb konnten Müller Sigrist Architekten in Zusammenarbeit mit B+p Baurealisation 2002 für sich entscheiden. Als die Stimmberechtigten 2003 den Kredit von 21 Millionen Franken bewilligten, stand der Realisierung des Neubaus nichts mehr im Wege. Er wird heute offiziell seiner Bestimmung übergeben; die Gemeindeverwaltung hat ihn schon vor Wochen bezogen.
Ort der Begegnung
Der Bau steht am Anfang einer städtebaulichen Offensive im Bereich der Oberen Bahnhofstrasse. Die Durchgangsstrasse soll in den kommenden Jahren aufgewertet und so zu einem Begegnungsort werden. Damit würde die regionale Bedeutung des Bezirkshauptortes auch städtebaulich unterstrichen - eine Bemühung, die sich um so mehr rechtfertigt, als die Einwohnerzahl Affolterns wegen der neuen Autobahn durch das Säuliamt auch in den kommenden Jahren zunehmen dürfte. Müller Sigrist Architekten haben einen Bau realisiert, der auf Urbanität setzt und dabei den ästhetischen Widerspruch zur „Hüsli“-Architektur in der Umgebung wagt.
In Bezug auf die Obere Bahnhofstrasse ist das neue Verwaltungszentrum zurückversetzt; es befindet sich auf der Rückseite des bestehenden Kasinobaus, dessen Sanierung Bestandteil des Architekturwettbewerbs war; die entsprechenden Arbeiten dauern noch bis Ende 2006. Die etwas versteckte Lage erscheint nicht unproblematisch, erweist sich jedoch als Glücksgriff, konnte so doch die geschlossene Strassenbebauung erhalten werden. Anstelle des abgebrochenen ehemaligen Mehrzwecksaals in der Verlängerung des Kasinos wurde ein weiter Platz angelegt, der als Marktplatz dient und zugleich eine Art öffentliches Forum für die Gemeinde bildet.
Der Neubau schliesst an den neuen Platz an und präsentiert sich als mehrfach abgetreppter Baukörper, dessen unterschiedliche Bauhöhen die Funktionen markieren. Prägnant tritt ein grossflächiges Dach hervor, das zwischen Platz und Gebäude eine Übergangszone bildet und eine geschützte und dennoch offene Fläche zwischen zwei Gebäudeflügeln überspannt. Dahinter schliesst das etwas höhere, geschlossene Volumen der neuen Mehrzweckhalle an; seitlich befindet sich der eigentliche Verwaltungstrakt mit Büroräumlichkeiten für fünfzig Angestellte, dessen drei Obergeschosse die übrigen Trakte überragen. Die durchgehend anderthalbfache Raumhöhe des Erdgeschosses steht für Öffentlichkeit und kommunale Repräsentation.
Spiel aus Licht und Schatten
Architektonisch ist die aufwendig hinterlüftete Glasfassade augenfällig, die mit Stützen aus braun eloxierten Aluminiumprofilen eine prägnante Vertikalgliederung aufweist. Spielt diese Formensprache auf die Ästhetik des Geschäftshausbaus der 1970er Jahre an, so relativieren die Architekten diesen Eindruck durch grün getönte Glasscheiben, die im Sinne von Fensterbrüstungen vor diese erste Fassadenschicht gehängt sind. In den fensterlosen Bereichen des Verwaltungstrakts sowie der Mehrzweckhalle bilden die getönten Glasscheiben gar eine durchgehende, die Gesamtwirkung des Baus bestimmende Haut. Der Lichteinfall auf die dahinter liegende Blechverkleidung aus Streckmetall führt zu einem Spiel aus Licht und Schatten und verleiht der Fassade Struktur und Tiefe. Somit erreichen die Architekten einen einheitlichen Gesamteindruck. Unterschiedlich getönte Glasscheiben sind in quadratischen Kassetten in das Vordach eingesetzt und lassen auf dem darunter liegenden Vorplatz facettenreiche Farbstimmungen zu.
Positives Gestaltungskonzept
Die neue, in Anlehnung an den abgebrochenen Bau „Kasinosaal“ benannte Mehrzweckhalle wird über ein karg anmutendes Foyer erschlossen, das wie die restlichen Erschliessungszonen in Sichtbeton gehalten ist. Die Längsseite nimmt ein Wandbild in beissendem Aprilia-Gelb des Zürcher Künstlers Reto Boller auf. Der anschliessende Saal bietet mit seiner orangeroten Verkleidung einen optischen Kontrast zur Aussenfassade. Er verfügt über ein Parkett für 500 Sitzplätze sowie eine Galerie mit weiteren 155, fest installierten Sesseln.
Als Gestaltungselement weist die Halle grosse runde, in die Decke eingelassene Leuchten auf, die heruntergefahren werden können, um bei intimeren Anlässen den passenden räumlichen Rahmen zu bieten. Im Unterschied zu diesem fast fensterlosen Saal bilden die Büros im Verwaltungstrakt gegen innen und aussen verglaste Raumzellen, die auf je-dem Stockwerk von einer möblierten Wartezone aus erschlossen werden. Was als Ausdruck einer transparenten Ver-waltung zu begrüssen ist, bietet den Beschäftigten wie den Kunden nur wenig Privatsphäre. Dennoch überwiegen die Pluspunkte eines Gestaltungskonzepts, das sich bis auf die Ebene der eigens entwickelten Schrifttype erstreckt.
Dokumentation und Nostalgie
Eine Ausstellung zum Hallenstadion
Das Hallenstadion ist nicht nur seit Jahrzehnten fester Bestandteil des sportlichen und kulturellen Lebens Zürichs; als bedeutendes Zeugnis des Neuen Bauens geniesst es auch im Fachpublikum hohes Ansehen. Konnte die Stadt mit der Eröffnung 1939 stolz auf den damals grössten Hallenbau Europas verweisen, so wurde seine architektonische Bedeutung 2001 durch die Unterschutzstellung offiziell bekräftigt. Zu diesem Zeitpunkt waren Pfister Schiess Tropeano Architekten in Zusammenarbeit mit Meier & Steinauer schon vollauf mit der Planung für die Sanierung und die Erweiterung beschäftigt, die diesen Sommer ihren Abschluss fanden. Mit einem riegelartigen Vorbau hat das Hallenstadion ein prägnantes neues öffentliches Gesicht erhalten; die Umbauten zollen zugleich der Vorgabe von Karl Egender und Wilhelm Müller Respekt und garantieren die Nutzung der Mehrzweckhalle für die Zukunft.
Aus aktuellem Anlass hat das Institut gta der ETH im Hauptgebäude der Hochschule gemeinsam mit den Architekten und dem Landesmuseum eine sehenswerte Ausstellung eingerichtet, welche die Geschichte des Neubaus und der Erweiterung anhand von Skizzen, Plänen, Filmen, aber auch zeitgenössischen Fotos und Originalexponaten spannend nacherzählt. Der erste und der (vorerst) letzte Zustand des Stadions stehen einander dialogisch gegenüber: Auf der linken Seite zeigen Exponate die ursprüngliche Planung und Ausführung auf, während auf der anderen Seite die jüngsten Eingriffe dokumentiert werden. Zu den Höhepunkten der Schau gehören die grossformatigen Originalpläne Egenders aus den Beständen des gta-Archivs, aber auch ein sensibler Fotoessay von Nico Krebs und Taiyo Onorato, die das Hallenstadion vor, während und nach dem Umbau in zahlreichen Aufnahmen porträtierten. Die Ausstellung pendelt zwischen sachlicher Baudokumentation und Nostalgie. So wird etwa mit der Installation eines Teils des traditionsträchtigen Velodroms eine vergangene Ära beschworen. Zahlreiche Fundstücke - ein ausgedienter Feuerlöscher ist ebenso zu sehen wie die ehemalige Neonbeschriftung oder die alte Bestuhlung - lassen das alte Hallenstadion noch einmal aufleben. Dagegen veranschaulicht ein Modell die Überlegungen, die zum neuen Annexbau an der Wallisellenstrasse führten.
Die Ausstellung dürfte mit ihrer attraktiven Aufmachung ein Publikum über den engeren Kreis der Architekturinteressierten hinaus ansprechen, wird doch das Hallenstadion als eine mit vielen Emotionen befrachtete Arena präsentiert. Als Ergänzung zur Ausstellung ist eine schön gestaltete und reich illustrierte Monographie erschienen, welche die Geschichte des Hallenstadions anhand von lesenswerten Essays wissenschaftlich aufarbeitet. Als besonderer Vorzug kann der Band zudem mit einer Reihe von Faksimiles der Pläne im Originalformat aufwarten.
Hallenstadion Zürich 1939/2005. Die Erneuerung eines Zweckbaus. gta-Verlag, Zürich 2005. 128"S., Fr. 44.-. Aus-stellung bis 26. Januar.
Bescheidenes Mittelmass
Eine vertane städtebauliche Chance an der Badenerstrasse
Das Überbauungsprojekt an der Badenerstrasse gegenüber dem Bezirksgebäude war umstritten. Dieser Tage werden die letzten Wohnungen der Neubauten bezogen. Sie sind zwar grosszügig. Städtebaulich und architektonisch ist aber vieles nicht gelungen.
Seit kurzem hat das „Schmuklerski“ an der Badenerstrasse zu beiden Seiten mächtige Nachbarn. Die Bauten lassen das schmucke Lokal aussehen wie ein zwischen riesigen Brandmauern eingeklemmtes Hexenhäuschen. Im Geviert Ankerstrasse, Grün- und Wyssgasse errichtete Andreas Eberle, St. Galler Unternehmer mit eigenem Architekturbüro, eine Blockrandbebauung, die mit ihrer Bauhöhe und den wuchtigen Volumina den Massstab der bestehenden Siedlungsstruktur in mehrfacher Hinsicht sprengt. Auf den ersten Blick hat gegenüber dem Bezirksgebäude eine grosszügige Urbanität Einzug gehalten, die das historische Stadtmuster zeitgemäss aktualisiert. Im Detail besehen überwiegt die Skepsis gegenüber den Neubauten.
Widerstand von Beginn an
Von Beginn an hatte sich im Quartier Widerstand geregt, als im September 2001 Eberle sein Projekt für Wohnungen und Büros der Öffentlichkeit präsentierte. Ein eigens gegründeter „Verein Viereck“ setzte sich für eine bessere Einbettung der Architektur in den städtischen Kontext ein sowie für die Erhaltung von günstigem Wohn- und Gewerberaum, die eine soziale Durchmischung gewährleisten sollten. In der Tat wurde das Bauvorhaben einige Monate später von der städtischen Bausektion zurückgewiesen, die den Neubau als nicht konform mit der geltenden Quartiererhaltungszone einschätzte. Konkret bemängelt wurden die Bauhöhe sowie die fehlende Rücksichtnahme auf das Bezirksgebäude und das Kino Plaza, die beide im Inventar der schützenswerten Bauten verzeichnet sind.
Das überarbeitete Projekt mit Änderungen in der Volumetrie, im Grundriss und in der Fassadengestaltung wurde im August 2002 bewilligt und gegen den Widerstand des Anwohnervereins und des Stadtzürcher Heimatschutzes realisiert. Dem Neubau musste unter anderem auch das bis Anfang 2004 besetzte Haus „Egocity“ weichen. Im vergangenen Mai richteten Unbekannte im fast fertig erstellten Gebäude einen Sachschaden in der Höhe von rund einer halben Million Franken an.
Der Neubau besteht aus drei Baukörpern, die zusammen mit zwei Altbauten an der rückwärtigen Grüngasse einen Innenhof umschliessen. Aufgrund ihrer fünf Geschosse setzen sich die Bauten vom städtischen Umfeld ab. Von urbanem Charakter ist die grosszügige Raumhöhe von 4"Metern im Erdgeschoss, welches gewerblichen Nutzungen vorbehalten bleibt. Das Attikageschoss ist jeweils gegenüber der Fassade zurückversetzt, was die Baukörper etwas weniger dominant in Erscheinung treten lässt. Von den insgesamt 41 Wohnungen in den Obergeschossen sind 10 Mietwohnungen im Haus an der Badenerstrasse, das übrige sind Eigentumswohnungen an den ruhigeren Seitenstrassen; die meisten davon sind bereits bezogen.
Was die äussere Gestaltung betrifft, orientiert sich die Schauseite zur Badenerstrasse an den benachbarten Lochfassaden mit hochrechteckigen Fenstern. Sie werden von einem Betonrahmen eingefasst, was die sonst grau verputzte Fläche angenehm belebt. Solche gestalterische Finesse sucht man an den seitlichen Fassaden vergeblich: Mit einer Konsequenz, die man sonst allenfalls aus dem Kasernenbau kennt, reiht sich ein Breitfenster ans nächste, was einen äusserst banalen Gesamteindruck hinterlässt.
Grundlegende Schwierigkeiten
Im Innern wird man von flexiblen Grundrissen überrascht, die über einen ausnehmend grosszügigen Wohnbereich und nur einzelne abgetrennte Zimmer verfügen. Was die Mietwohnungen betrifft, dürften die offenen Grundrisse sowie der edle Parkettboden in geräucherter Eiche, aber auch die modernen Einbauküchen mit Marmorabdeckungen den Geschmack des urbanen Zielpublikums treffen. Allerdings vermag der schöne Schein der Oberflächen auch hier nicht über grundlegende Schwierigkeiten hinwegzutäuschen, gerade, was die Grundrisse betrifft: Bei den Mietwohnungen werden die abgesonderten Zimmer praktisch vom Kochherd aus erschlossen, so dass ein Aufenthalt ohne Lärm- und Geruchsbelästigung kaum vorstellbar ist. Anderswo sind die Duschräume direkt hinter der Wohnungstür und in grösstmöglicher Distanz zu den Schlafräumen situiert. Insbesondere die Mietwohnungen sind aufgrund ihrer Zuschnitte kaum für Familien oder Wohngemeinschaften geeignet. Eine soziale Durchmischung, wie sie für die Stadt wünschbar wäre, dürfte daher nur schwer zu erzielen sein.
Der Gesamteindruck eines architektonisch wenig durchdachten Projekts nimmt schliesslich auch beim Innenhof überhand. Die Ausblicke von den Balkons auf das belebte Quartier stimmen zwar versöhnlich. Indes wirken diese Balkone wie turmförmige Fremdkörper, die vor die Fassaden gestellt wurden. In der Gestaltung des Innenhofs wird zudem die Grundidee der Blockrandbebauung in Frage gestellt: Die asphaltierte Fläche ist derart unglücklich mit Steinmauern von Pflanzenkisten verstellt, dass eine sinnvolle Nutzung praktisch unmöglich wird. Man hätte sich an dieser städtebaulich sensiblen Stelle ambitioniertere Architektur gewünscht.
Selbstinszenierung mit Buch
Eine unterhaltsame Ausstellung im Architekturforum Zürich
Für einmal gibt es im Architekturforum nicht Entwürfe, Modelle oder Architekturfotografie zu besichtigen, sondern das intellektuelle Futter, das diesen zugrunde liegt. Von der Annahme ausgehend, dass Bücher für Architekten von zentraler Bedeutung sind, haben die Kuratorinnen Sibylle Bucher und Claudia Coellen rund hundert Architekten und Architekturvermittler darum gebeten, ihr „wichtigstes“ Buch für eine Ausstellung zur Verfügung zu stellen. Entstanden ist eine Schau aus über siebzig Titeln, die als museale Exponate den Wänden entlang aufgehängt sind. Von der kostbaren Erstausgabe bis zum abgegriffenen Taschenbuch findet sich die gesamte Palette der Buchproduktion. Auch thematisch ist das Feld vom Groschenroman über die Künstlermonographie und das Entwurfslehrbuch bis hin zum theoretischen Manifest weit gesteckt. Die präsentierten „Originale“ aus der persönlichen Bibliothek der Architekten gewinnen durch ihre Unberührbarkeit den Charakter eines Kunstwerks; eine eigens eingerichtete Leseecke lädt aber zum Schmökern in den Zweitexemplaren ein. In einem Begleitheft erläutern die Beteiligten die Gründe für ihre Wahl.
So schön die Ausstellung präsentiert wird: Im Zentrum steht wohl nicht so sehr das Interesse an den Büchern selbst, sondern die Frage, wer welchen Titel gewählt hat - und was für Rückschlüsse sich daraus ziehen lassen. So bildet die Schau weniger einen Kanon der wichtigsten Bücher im Gebiet der Architektur ab als vielmehr eine Reihe persönlicher Statements, die sich hervorragend zur Selbstinszenierung der angefragten Persönlichkeiten eignen. Nutzen die einen ihre Buchwahl dazu, ihrem theoretischen Standpunkt Nachdruck zu verschaffen, so steht bei anderen ihr Selbstbild als Intellektuelle im Vordergrund. Wieder andere markieren mit einem gekonnten Missgriff ihr Rebellentum. Diese Eindrücke werden durch eine Serie von an die Wand projizierten Bildern unterstrichen, die einen Blick in die Bibliotheken der Architekten gewähren und mithin darauf, welches Bild sie von sich selbst gegen aussen präsentieren.
In der Ausstellung sind alle Generationen der Zürcher Szene gut vertreten, während einige gewichtige auswärtige Grössen der Schweizer Architektur wie etwa Herzog & de Meuron, Mario Botta oder Diener & Diener fehlen. Das Resultat ist unterhaltsam und vermag obendrein die Lust des Voyeurs am Star zu befriedigen. Eine Ausstellung nicht nur für Bibliophile, sondern auch für Forscher im Biotop der Architektenspezies.
[ Zürich, Architekturforum (Neumarkt 15), bis 26. November. Am 26. Oktober findet um 18 Uhr 30 eine Podiumsdiskussion zum Thema „Architektenbücher - Bücherarchitekten: Vom Lesen, Schreiben und Verlegen“ statt. ]
Ein Kopf für Oerlikons Schildkröte
Das Zürcher Hallenstadion ist saniert und erhält dank einem neuen Vorbau mehr Raum
Nach vierzehnmonatiger Bauzeit steht das Hallenstadion kurz vor der Wiedereröffnung. Wie präsentiert sich das Projekt aus architektonischer Sicht? Pfister Schiess Tropeano Architekten haben dem Gebäude aus den 1930er Jahren mit einem riegelartigen Vorbau eine neue Schauseite verliehen und setzen so ein städtebauliches Zeichen. Im Innern dieser Ikone des Schweizer Sportbaus wird erstmals die spektakuläre originale Dachkonstruktion sichtbar.
Oerlikon erhält dieser Tage sein altes Wahrzeichen zurück: Nachdem das Hallenstadion vor Jahresfrist für Umbau- und Renovationsarbeiten geschlossen worden ist, steht die traditionsreiche Sporthalle an der Wallisellenstrasse kurz vor der Wiedereröffnung. An der Struktur der „Schildkröte“, wie der Mehrzweckbau aufgrund seiner polygonalen Grundform gerne genannt wird, fällt die wesentliche Neuerung deutlich ins Auge: Das Hallenstadion hat mit einem riegelförmigen Anbau zur Strasse hin eine neue Fassade erhalten, die das Gesicht des Baus grundlegend verändert. Durch diesen Annex rückt das Stadion bedeutend näher an die Strasse heran und trägt damit zu einer städtebaulichen Definition seines Standortes bei. Als weiteres ablesbares neues Element sind an den Breitflanken des Stadions je zwei Lüftungstürme aus Zinkblech hinzugekommen. Um sie herum sind Fluchttreppen gelegt.
Gestalterischer Mittelweg
Der neue Kopfbau ist ein viergeschossiger Riegel. Er lagert sich an die bereits zuvor vorhandenen, externen Treppenhäuser an und integriert diese. Die verantwortlichen Architekten des Büros Pfister Schiess Tropeano greifen mit ihrer prominenten Erweiterung die ursprüngliche Idee Karl Egenders aus den dreissiger Jahren auf. Wegen Geldmangels musste damals auf die Ausführung verzichtet werden. Dies führte zur seither gültigen architektonischen Lösung mit dem Vorplatz, der zu beiden Seiten von je einem Treppenhaus umklammert wurde - so gesehen erhält das Hallenstadion erst jetzt sein wahres Gesicht.
Beim Umgang mit dem bestehenden Bau - charakteristisch sind auch dessen Betonskelett und der gelbliche Backstein - hatten die Architekten eine grundlegende Entscheidung zu fällen. Sie hätten den Neubau mit der kruden Ästhetik Egenders kontrastieren oder aber ihn an diese angleichen können. Sie entschieden sich für einen Mittelweg. Zum einen ist der Neubau mit seiner Sichtbetonfassade unzweifelhaft als solcher erkennbar. Zum andern aber greift er mit seiner Materialisierung und mit der Fertigbauweise die powere Ästhetik des „alten“ Hallenstadions auf. Die Reverenz erwiesen wird dem seit 2001 unter Denkmalschutz stehenden Hallenstadion zudem durch die relativ niedrige Gebäudehöhe.
Die Hauptfassade des neuen, sogenannten „Conference Center“ an der Wallisellenstrasse ist geprägt durch einen leichten Fassadenknick, der zum benachbarten Messegebäude vermittelt. Im Erdgeschoss befindet sich hier neben den Billettkassen und einem Imbissbetrieb ein Treppenaufgang zum öffentlichen Restaurant im ersten Obergeschoss. Wo man in den Obergeschossen zwischen dem Betonraster der Fassade grosse Fensteröffnungen erwarten würde, überraschen teils blinde, teils gelochte Paneele aus Zinkblech. Des Rätsels Lösung liegt in der internen Raumorganisation, befinden sich doch an der zur Wallisellenstrasse gelegenen Fassade nur die Erschliessungszonen sowie eine Reihe weiterer „dienender Räume“, etwa Toilettenanlagen und Küchen. Das öffentliche Restaurant im ersten sowie die Konfe-renzräume und das VIP-Restaurant im zweiten Obergeschoss sind dagegen nach innen orientiert. Sie blicken auf das zentrale überdachte Foyer, das an die Stelle des früheren, offenen Vorplatzes getreten ist. Im obersten Stock finden sich Verwaltungsräume der Hallenstadion AG.
Trotz leichten Variationen hat der neue Riegel einen industriellen Touch; so werden etwa die Gitterroste an den Decken, aber auch Neonröhren offen präsentiert. Der vom Neubau vermittelte Eindruck ist nicht nur in Bezug auf Egenders eigene Materialästhetik angemessen. Er ist auch durch die gewählte Fertigbauweise zu erklären, die das hohe Tempo der Umbauarbeiten überhaupt erst ermöglichte. Aus der Not wurde so gewissermassen eine gestalterische Tugend.
Zwei Eingänge auf den Schmalseiten
Betreten wird das Stadion nicht an der Hauptfassade des Neubaus, sondern an den beiden Schmalseiten Richtung Tramstation und Messegebäude. Im Innern folgt eine spannungsreich inszenierte Raumfolge: Nach dem niedrig gehaltenen Eingangsbereich, der sich über die gesamte Länge des Neubaus zieht, folgt kontrastierend das neue Foyer. Es ist als hohe Halle zwischen Conference Center und Hallenstadion aufgespannt. Die ehemalige Aussenhülle wird somit zu einer Innenwand und präsentiert sich reizvoll fast im Sinne eines musealen Exponats. Ursprünglich schlugen die Architekten ein Glasdach über dem Foyer vor. Aus Kostengründen mussten sie aber einen Kompromiss eingehen. Die gefundene Lösung mit Oberlichtern aus Kunststoff überzeugt nicht vollends. Sie stört aber den Gesamteindruck des Raumes kaum, in dem sich von verschiedenen Ebenen immer wieder reizvolle Ausblicke ergeben. Über breite Treppen und niedrige Korridore werden von hier aus die Halle und die Garderobe im Untergeschoss sowie die Ränge in den Obergeschossen erschlossen.
Für die besonderen Gäste wird das Foyer im zweiten Obergeschoss zusätzlich von einer kleinen Brücke überspannt, die vom VIP-Restaurant im Neubau direkt zu den neuen Logen im Stadion führt. Die Logen geben nicht nur einen privilegierten Blick auf das Geschehen auf der Fläche frei, sondern auch auf die sich grossartig präsentierende Halle. Insbesondere beeindruckt die originale Konstruktion des Flachdaches, die nach ihrer Freilegung erstmals in vollem Um-fang zu sehen ist. Die VIP-Logen sind im Bereich der Südkurve als gekrümmter Bau in die Halle hineingestellt und bilden hier neben der freien Sicht aufs Dach die markanteste architektonische Neuerung. Das breite Publikum in den Rängen darf sich an der neuen Bestuhlung mit gepolsterten Sesseln in dunklem Blau erfreuen.
Die Tribünen in den unteren Bereichen lassen sich ein- und ausfahren, so dass die Fläche des Stadions je nach Anlass vergrössert oder verkleinert werden kann. Weniger sichtbar, für den Betrieb des Hallenstadions als Mehrzweckhalle aber nicht minder wichtig sind die neuen Lüftungs- und Akustiksysteme sowie das verbesserte sicherheitstechnische Dispositiv.
Aus Sicht der Veranstalter wird der Betrieb auch dadurch erleichtert, dass das Stadion neu direkt für Lastwagen befahrbar ist. Für das Wohl der Besucher befinden sich in den Seitengängen diverse Verpflegungsstätten, die einheitlich zurückhaltend gestaltet wurden. Architektonisch ist der Spagat zwischen dem Respekt vor dem Alten und der Anpassung an die veränderten Anforderungen gelungen.
Lektüre des Ortes
Zum Tod von Giancarlo De Carlo
Die Architektur, so einer der Kernsätze Giancarlo De Carlos, sei zu wichtig, um allein den Architekten überlassen zu werden. Er bringt jenen Humanismus zum Ausdruck, der Denken und Werk des italienischen Architekten wie ein roter Faden durchzieht und der ihm einen eminenten Platz in der Geschichte der modernen Architektur gesichert hat. De Carlos Name ist mit Urbino verknüpft. In jahrzehntelanger Auseinandersetzung prägte der am 12. Dezember 1919 in Genua Geborene das Gesicht der Universitätsstadt in den Marken. Bei all seinen Interventionen war ihm der Respekt für die historischen Stadtstrukturen oberstes Gebot. Als erstes Hauptwerk entstand 1962-66 am Stadtrand das sensibel in die Hügellandschaft eingepasste Collegio del Colle. Im historischen Zentrum ist die Fakultät der Erziehungswissenschaften, „Il Magistero“ (1968-76), hervorzuheben, die klug die Bausubstanz eines verlassenen Klosters mit einer modernen Formensprache verbindet. Eine vergleichbare Operation realisiert De Carlo in Catania (1984-95), wo er bei der Umnutzung eines Benediktinerklosters erneut dem architektonischen Dialog zwischen Vergangenheit und Gegenwart ein Feld eröffnete.
Aus den Herausforderungen von Urbino entwickelte De Carlo das „Reading“ als zentrales Moment seiner Methodik, das am Anfang jedes Entwurfs steht: eine profunde Analyse von Topographie, Geschichte und sozialem Umfeld des Bauplatzes, eine eigentliche Lektüre des Ortes. Mit diesem kontextualistischen Ansatz stand De Carlo in Opposition zu den Prinzipien der CIAM, von denen er sich als einer der Wortführer von Team X abwandte. Das zweite Schlüsselelement seiner Arbeitsmethode war die Idee der Partizipation. Am konsequentesten wurden die zukünftigen Bewohner beim Bau der Arbeitersiedlung Matteotti bei Terni (1969-74) in den Entwurfsprozess mit einbezogen. De Carlo konnte hier zugleich die städtebaulichen Utopien von Team X verwirklichen: Terrassen, Passerellen und Verbindungstreppen sorgen für eine komplexe Vernetzung des öffentlichen Raumes und schaffen die Voraussetzungen zu Begegnung und Austausch.
Das gebaute Werk De Carlos blieb auf Italien beschränkt. Aber als Inhaber eines Lehrstuhls in Venedig, als Gastprofessor im In- und Ausland sowie als Gründer des ILAUD (International Laboratory of Architecture and Urban Design) hat er Generationen von Architekten ausgebildet. Als Publizist erreichte er mit der Herausgabe der Zeitschrift „Spazio e Società“ ein breiteres Publikum für seine Vision einer Architektur, die sich an den Gegebenheiten des Orts und seiner Geschichte sowie an den Bedürfnissen der Menschen orientiert. Wie erst jetzt bekannt wurde, ist Giancarlo De Carlo am 4. Juni im Alter von 85 Jahren in Mailand gestorben.
Neuer Glanz für alte Räume
Erste restaurierte Säle im Kunsthaus Zürich sind geöffnet
Die laufende Ausstellung im Kunsthaus Zürich gibt Gelegenheit zu einer Art Vorbesichtigung: Sie zeigt, was von der Renovation des Gebäudeflügels von Karl Moser zu erwarten ist. Die Sammlungsräume, in denen zurzeit fünfzig Stillleben des niederländischen Barockmalers Pieter Claesz hängen, sind weitgehend originalgetreu rekonstruiert.
Seit kurzem ist im Zürcher Kunsthaus eine Ausstellung mit Stillleben des niederländischen Barockmalers Pieter Claesz (1597-1660) zu sehen. Gleichzeitig bietet sich dem Publikum Gelegenheit, einen ersten Blick auf die bereits restaurierten Säle im Kunsthaus-Bau Karl Mosers aus dem Jahr 1910 zu werfen. Noch sind erst einige sanierte Räume im Gebäudeflügel an der Ecke Heimplatz/Rämistrasse zugänglich. Die prächtig hergestellten Säle und Kabinette lassen aber erahnen, was man von der Renovation der weiteren Sammlungsräume erwarten darf. Diese sollen Ende Juli dem Publikum übergeben werden. Der mehrjährige Umbau steht unter der Leitung des Zürcher Architekturbüros SAM Schnebli Ammann Menz. Mit letzten Eingriffen im rückseitigen, von Erwin Müller stammenden Erweiterungsbau soll das Vorhaben noch vor dem Ende dieses Jahres seinen Abschluss finden.
Originalgetreue Rekonstruktion
Soeben vollendet worden ist die Raumfolge im ersten Obergeschoss links des grossen Treppenhauses. Dieses erschliesst vom Haupteingang und vom kürzlich ebenfalls neu gestalteten Foyer aus die oberen Etagen; die Stockwerke sind neu mit einem Lift erreichbar. Während in diesen Sälen bis zum Umbau die Werke von Füssli, Böcklin und Segantini präsentiert wurden, bilden sie nun vorübergehend den Rahmen für die niederländischen Stillleben. Die Vorhalle der mittleren Achse stellt einen würdigen Auftakt zum zentralen Oberlichtsaal dar (dem ehemaligen Füssli-Saal). Dessen beige Wände werden künftig einen dezenten Hintergrund für die Präsentation der Hodler-Bestände der Kunsthaus-Sammlung abgeben.
Die restauratorischen Eingriffe in den Räumen folgen weitgehend dem Prinzip einer originalgetreuen Rekonstruktion. Mit Hilfe von historischen Fotografien konnte eine Raumfolge wiederhergestellt werden, die den Esprit Mosers und seiner Zeit neu aufleben lässt. So wurde etwa der schwarzweisse Teppich mit einem geometrischen Ornament nachgewoben. Dieses antwortet seinerseits auf die kassettierte Decke. Ebenso wurden die Ornamentfriese nach alten Befunden rekonstruiert und die wertvolle Palisanderverkleidung der Heizkörper entlang den Fussenden von ihren Übermalungen befreit. In den seitlich angrenzenden Räumen, wo einfachere Holzarten verwendet worden waren, griff man dagegen auf die historische, farbige Schwammtechnik zurück, um einen Marmoreffekt zu erzeugen.
Eine Trouvaille befindet sich in den kleinen Kabinetten am Kopfende des Baus: Die jetzt wieder sichtbare Verkleidung der Heizkörper zeugt von der hohen Qualität der Tischler-, Drechsler- und Einlegearbeiten jener Zeit. Zum Gesamteindruck tragen auch die neu bezogenen Originalmöbel nach Entwürfen Mosers bei, die ebenso wie die geometrischen Ornamente in den Sälen von den Wiener Werkstätten inspiriert sind. In einem kleinen Raum mit Seitenlicht ist sogar der Verkaufstisch aufgestellt, an dem die Künstler damals mit den Sammlern um den Preis ihrer Werke verhandelten.
Haustechnik auf dem neusten Stand
Die Restaurationsarbeiten sind lediglich der sichtbare Teil der aufwendigen Sanierungsarbeiten der letzten Jahre, mit denen die Haustechnik auf den neuesten Stand gebracht und das Haus durchwegs rollstuhlgängig gemacht wurde. Auch in den historischen Räumen wurde zwischen gläserner Saaldecke und dem äusseren Glasdach eine neue Klimaebene eingezogen, während hinter den Wänden eine neue Lüftung entlangführt. Diese Eingriffe sind auf den ersten Blick kaum bemerkbar und beeinträchtigen den Raumeindruck kaum. Wo Modifikationen dennoch sichtbar werden, fügen sie sich ins Gesamtbild, bleiben aber dennoch ablesbar.
Die Ausstellung mit Stillleben von Pieter Claesz im Kunsthaus Zürich ist noch bis zum 21. August zu sehen.
Gebaute Zeitlosigkeit
Der neue IBM-Hauptsitz in Altstetten setzt den Quartierumbau fort
Mit dem neuen IBM-Hauptsitz in Altstetten setzt der Architekt Max Dudler einen grossstädtischen Akzent. Der eindrucksvolle Grossbau genügt höchsten technischen Ansprüchen, bekennt sich aber zugleich zur Tradition der euro-päischen Stadt. Für den wachsenden Stadtkreis Altstetten ist der Neubau städtebaulich bedeutsam.
Ein wenig im Schatten der grossen Entwicklungsgebiete der letzten Jahre in Zürich Nord, West und Süd tut sich neuerdings auch im Westend von Zürich architektonisch Bemerkenswertes: Nachdem bereits mit dem Bürohochhaus Obsidian von Baumschlager und Eberle Architekten ein markantes städtebauliches Zeichen gesetzt worden ist (NZZ 30. 10. 04), doppelt nun auf der gegenüberliegenden Seite des Geleisefeldes der IBM-Konzern mit seinem neuen Schweizer Hauptsitz nach. In einem „eingeladenen Wettbewerb“ konnte sich der international tätige Schweizer Architekt Max Dudler mit seinem Entwurf durchsetzen. Dudler galt in den neunziger Jahren als einer der Protagonisten der Gestaltung des „Neuen Berlin“.
Konzentration auf einen Standort
Investorin und Totalunternehmung in einem war bei diesem 180-Millionen-Projekt die Allreal AG, wobei mit IBM vorgängig ein langjähriger Nutzungsvertrag abgeschlossen werden konnte. So ist der nun fertig gestellte Bau optimal auf die Bedürfnisse des Technologiekonzerns zugeschnitten, lässt aber auch anderweitige künftige Nutzungen problemlos zu. Der Neubau beherbergt auf einer Nutzfläche von 37"000 Quadratmetern über 1200 Arbeitsplätze für rund 2200 Mitarbeiter und erlaubt es der IBM Schweiz, ihre bisher auf mehrere Zürcher Standorte verteilten Aktivitäten in einem einzigen Gebäude zu konzentrieren. Dass der Bau als grösster seiner Art den Minergie-Standards genügt, ist ein weiterer Pluspunkt, der stark zu einer effizienten Bewirtschaftung beitragen dürfte.
Gemeinsam mit der Scheibe über dem Bahnhof Altstetten und dem Hochhaus Obsidian schräg gegenüber spannt der Neubau an der Vulkanstrasse ein städtebaulich bedeutsames Dreieck in einer architektonisch sonst mässigen Umgebung. Zwar nimmt der IBM-Neubau die Vorgabe von Baumschlager und Eberle auf und egalisiert deren Gebäudehöhe von rund fünfzig Metern mit dreizehn Stockwerken. Doch Dudlers Entwurf verkörpert eine grundlegend andere Auffassung von Architektur. Während der Obsidian-Turm hinter einer schwarz-grünen Glashülle ganz den Eindruck von Transparenz und Leichtigkeit vermittelt, setzt Dudler mit einem rigiden Fassadenraster aus Granit, in das grossflächige Scheibenrechtecke eingesetzt sind, auf eine Verbindung von traditioneller Monumentalität und Hightech. Der Bau ist ein Bekenntnis zu einer dezidiert grossstädtischen Architektur; ein Stück steinernes Berlin gleichsam im kleinräumigen Zürich, ohne deswegen überdimensioniert oder gar massstabslos zu wirken. Mit der Verbindung von Stein und Glas und seiner minimalistischen, bisweilen monoton anmutenden Formensprache erweckt das Gebäude den Eindruck von Zeitlosigkeit, mit dem es sich von den teilweise nicht vorteilhaft gealterten Bauten der Umgebung abhebt.
Die Fassadengestaltung wird geprägt durch den Raster mit den hochrechteckigen Fensteröffnungen, der sich gleichförmig über das Gebäude zieht. Einzig in den beiden unteren Geschossen sowie im obersten Stockwerk werden jeweils zwei Achsen durch grossflächige Panoramafenster miteinander verbunden, womit die drei klassischen Aufriss-Elemente des Hochhauses - Sockel, Schaft und oberer Abschluss - deutlich ablesbar werden. Dabei bildet der Turm lediglich das städtebaulich sichtbarste Zeichen eines weit komplexeren Volumens: Der Bau entwickelt sich aus einem sechsgeschossigen Wurmfortsatz an der Nordwestseite des Grundstücks, verzweigt sich sodann in einen rechteckigen Flachbau gleicher Höhe, der einen zentralen Innenhof umschliesst, und schwingt sich schliesslich an der Südostseite zum dreizehngeschossigen Turm auf. Die Grundrissfigur und die Kontrastierung von horizontalen und vertikalen Volumen tragen zur Dynamisierung des klar strukturierten Baus bei.
Der neue IBM-Hauptsitz wird an der Stirnseite des Turmes an der Vulkanstrasse betreten. Die Empfangshalle stellt durch ihre lichte Raumhöhe sowie durch die Kontinuität des Materials Öffentlichkeit her, indem der Granit der Aussenfassade in diesen Bereich hineingezogen wird. Nach dem Passieren zweier schwarzer, formal streng gestalteter Pavillons führt eine seitliche Treppe hinauf zu den Sitzungs- und Repräsentationsräumen des ersten Obergeschosses, während ein schmaler Gang zum zentralen Innenraum überleitet, der sogenannten Markthalle. Es handelt sich um einen grosszügigen, überdeckten Innenhof mit doppelter Geschosshöhe, der mit Elementen wie der verglasten Kassettendecke oder dem Pfeilerumgang auf den Fundus der klassischen Architektursprache zurückgreift. Das Ausgreifen der Bestuhlung der seitlich anschliessenden Cafeteria macht die Halle zu einer Art städtischem Platz. Gegenüber der vorherrschenden kühlen Materialisierung in Stein und Glas sind die Wände des Verpflegungsbereichs mit hellen Eichenpaneelen beschlagen, so dass der Eindruck von Intimität und Wohnlichkeit entsteht.
Gekonntheit in den Details
Die oberen Geschosse sind der Nutzung als Grossraumbüros und der Haustechnik vorbehalten. Die Etagen werden durch Erschliessungszonen erreicht, deren schwarzer Kunststein der edlen Materialisierung der übrigen öffentlichen Bereiche in nichts nachsteht. Auch die Pausenbereiche auf den einzelnen Stockwerken brauchen Vergleiche nicht zu scheuen. Dem Architekten oblag ebenfalls die Gestaltung dieser Innenräume, so dass stimmige Ensembles entstanden sind. Die Pausenbereiche öffnen sich auf den Innenhof oberhalb der Markthalle, dessen Aussenfassaden mit schwarzen Gitterrosten bedeckt sind. Das Dach der gedeckten Halle gewinnt von hier oben den Aspekt eines geometrisch konzipierten, jedoch unzugänglichen Gartens. Im Unterschied zu den öffentlichen Bereichen gestalten sich die Grossraumbüros wesentlich profaner, wobei die Mitarbeiter mit steigender Stockwerkzahl mit einem grossartigeren Blick belohnt werden. Gleichwohl wird auch hier den Details grosse Aufmerksamkeit zuteil, was sich etwa in den konsequent durchgezogenen Sockelleisten oder den durchwegs verborgenen Deckeninstallationen zeigt.
Die in den Fussböden eingelassenen Deckel, unter denen sich diverse Anschlüsse für die Arbeitsplätze und kilometerlang verlegte Kabel verbergen, lassen erahnen, dass der IBM-Neubau neben der repräsentativen Schauseite auch über ein hochgradig technologisiertes Unterbewusstsein verfügt. Dieses wird zwar kaum sichtbar, ist für die Funktion des Gebäudes aber unabdingbar. Der rastlosen Welt der Bits und Bytes hält der Architekt mit seinem Werk bildhaft die Kontinuität der Stadt entgegen.
Turnen im Turm
Die neue kantonale Technische Berufsschule am Sihlquai
Das Schulquartier zwischen Ausstellungsstrasse und Sihlquai im Industriequartier wird durch einen markanten Neubau ergänzt: Vor kurzem haben Stücheli Architekten für den Kanton die Technische Berufsschule vollendet. Der Bau überzeugt sowohl in seiner städtebaulichen Einbindung als auch in seiner architektonischen Ausgestaltung. Aus den Turnhallen im Turm bietet er zudem spektakuläre Ausblicke auf die Stadt.
In Zürich machen architektonisch derzeit vor allem grosse Schulbauten von sich reden: Nachdem im letzten Sommer mit Peter Märklis Schulanlage im Birch das grösste Schulhaus bezogen werden konnte, das die Stadt Zürich je gebaut hat, steht nun am Sihlquai die neue Technische Berufsschule kurz vor der Vollendung. Der prominente Bau, der im Auftrag des Kantons ausgeführt wurde, zieht schon seit einiger Zeit die Aufmerksamkeit auf sich. Insbesondere von der Kornhausbrücke aus wird deutlich, dass die Stadt ein neues urbanes Zeichen erhalten hat, erhebt sich doch der zehngeschossige Turm deutlich über die Bauten der Umgebung. Den Wettbewerb für das Projekt konnte das Zürcher Büro Stücheli Architekten 1997 für sich entscheiden.
Zeichen und massvolle Ergänzung
Dennoch setzt sich der Neubau keineswegs über Massstab, Materialität und formale Ausgestaltung der existierenden Bebauung hinweg. Er ist deutlich in zwei Volumen gegliedert. Neben dem Turm verfügt er über einen langgestreckten Schultrakt entlang dem Sihlquai, der bis an das Hauptgebäude der Berufsschule aus den siebziger Jahren heranreicht. Diesem ordnet sich der Riegel mit seinen lediglich vier Geschossen bescheiden unter und erweist ihm seine Reverenz. Somit wird der Neubau den städtebaulichen Erfordernissen in doppeltem Sinne gerecht: als weithin sichtbares städtebauliches Zeichen wie auch als eine massvolle Ergänzung des bestehenden baulichen Kontexts.
Doch nicht nur im Hinblick auf den Massstab sind die Bezüge des Neubaus zu seiner Umgebung auszumachen. Auch in der Proportionierung der Fensteröffnungen, in der Farbgebung, der rational-orthogonalen Formensprache und im Bauprogramm tritt die Schule mit dem bestehenden Hauptgebäude sowie mit der Schule für Gestaltung in einen Dialog; Letztere errichteten Karl Egender und Adolf Steger zwischen 1930 bis 1933. Auch die Elementbauweise des Nachbars findet im Neubau ihren Niederschlag: Strukturell basiert die neue Schule auf einem streng regelmässigen Betonskelett aus Horizontalen und Vertikalen. Diese Struktur ist an einem Netz aus vorstehenden Stützen und Sturzbändern ablesbar, welche die Fassade in einen regelmässigen Raster unterteilen. Von aussen ergeben die zurückhaltende Formensprache und Materialisierung den Eindruck von selbstverständlicher Eleganz, auch wenn das gesamte Volumen mit seiner Materialisierung aus Sichtbeton recht massiv in Erscheinung tritt.
Das Gebäude wird durch zwei einander diagonal gegenüberliegende Eingänge vom Sihlquai und von der Ausstellungsstrasse her erschlossen, wobei in beiden Fällen eine relativ steile Treppe in ein Hochparterre hinaufführt und somit in einer Würdeformel die höheren Weihen der Schulbildung suggeriert. Die vertikalen Erschliessungszonen an beiden Enden des Baus sind mit einem grosszügigen, breiten Korridor miteinander verbunden, der den Zugang zu den beidseitig angeordneten Schulzimmern erlaubt. Der reguläre Raster des Grundrisses bleibt auch im Innern an den Stützen ablesbar. Zwischen ihnen bilden orangerot eingefärbte Betonwände mit eingelassenen Holztüren die Begrenzungen zu den Klassenräumen; diese wirken wie eingestellte Schubladen. Die Böden der Gänge sind aus hellem Kunststein, die Dekken mit fliesbespannten Metallplatten belegt. Der Kontrast zwischen tragender Konstruktion und Füllelementen wird durch die Farbigkeit und die abgerundeten Kanten an den Wänden zusätzlich betont. Gegenüber der kühlrationalen äusseren Erscheinung des Gebäudes erweckt das Innere den Eindruck von Wärme und Behaglichkeit. Dieser wird durch Details wie die ergonomisch geformten hölzernen Handläufe in den Treppenhäusern noch verstärkt.
Ausblick auf Limmat und Stadt
Für die Organisation der Berufsschule bietet die neue Anlage, die dem Kanton mit rund 65 Millionen Franken zu Buche schlagen wird, einen entscheidenden Vorteil: Gegenüber dem früheren Standort in Oerlikon befinden sich die Elektro- und Elektronik-Abteilungen direkt am Hauptsitz der Technischen Berufsschule, wodurch die internen Abläufe vereinfacht und Synergieeffekte genutzt werden können. Die hohen und lichten Schulräume für die rund 800 Schüler sind alle im viergeschossigen Riegel untergebracht; im Soussol befinden sich zusätzlich Unterrichtszimmer für die Technikerschule, die in der Erwachsenenbildung tätig ist. Das Dach des horizontalen Gebäudeteils dient den Schülern als Pausenfläche und wird vom Turmbau aus erschlossen.
Der Turmbau ist, abgesehen von einem Aufenthaltsraum, dem Sport vorbehalten: Neben einem Gymnastik- und einem Kraftraum sind in den oberen vier Geschossen zwei Sporthallen übereinander gestapelt, die beim Turnen hoch über dem Sihlquai einen spektakulären Blick auf die Limmat und die Stadt erlauben. Diese ungewöhnliche Unterbringung der Turnhallen gehört zu den originellsten Lösungen der Anlage; vom Treppensteigen vor und nach dem Sportunterricht darf man sich vielleicht gar einen zusätzlichen Fitnesseffekt erhoffen. Ohnehin werden die Schüler oben mit einem Blick auf die Stadt belohnt, der nicht nur im Schulbau seinesgleichen sucht.
Chalet und Schweizer Kiste
Modernität und Nostalgie in der Schweizer Baukultur
Unter dem augenzwinkernden Titel «Nicht Disneyland» hat der Zürcher Kunsthistoriker Stanislaus von Moos ein neues Buch zur jüngeren Schweizer Architektur- und Kunstgeschichte vorgelegt. Wenn so suggestiv eine Verneinung an den Anfang des Titels gestellt ist, liegt der Verdacht nicht fern, dass die hier angestellten Betrachtungen mit dem angesprochenen Sachverhalt mehr teilen, als den Protagonisten des Buches vielleicht lieb ist. Und in der Tat beobachtet von Moos in seinen einleitenden Überlegungen zur Schweizer Kulturlandschaft zwei einander widersprechende Phänomene: eine «puritanische Verhärtung im Ästhetischen», die jedoch durch eine «hedonistische Entkrampfung im Kulturpolitischen» zusehends unterwandert werde. Entsprechend ist der Ansatz des Autors von einem Misstrauen gegenüber dem vorgeblich Authentischen in Architektur und Stadtgestaltung geprägt, auf das sich der «gehobene ästhetische Mainstream» als Bannerträger im Dienste des guten Geschmacks mit Vorliebe beruft.
Landesausstellungen und Städtebau
Das Buch «Nicht Disneyland», in seiner Gestaltung vielleicht ein bisschen gar gesucht unprätentiös, vereint neben einer programmatischen Standortbestimmung zehn Aufsätze, die zwischen 1993 und der Gegenwart entstanden sind. In ihrer Gesamtheit bilden die Essays ein Panoptikum zur jüngeren Schweizer Architektur- und Kulturgeschichte, wobei der zeitliche Rahmen durch zwei für die Identitätsstiftung des Landes bedeutende Grossereignisse abgesteckt wird - die Landi 1939 am einen Ende sowie die Expo 02 am anderen. Diese Events eignen sich vorzüglich zur Illustration der These, die sich lose durch die gesamte Argumentation zieht: dass nämlich - gerade in der Schweiz - Architektur und Stadtgestaltung seit etwa der Mitte des 20. Jahrhunderts zunehmend der Logik der Ausstellung folgten; dass mithin beide einem ästhetischen Diskurs unterliegen, womit freilich die politische und ökonomische Dimension von Architektur zusehends aus dem Blick gerät.
Die Gesamtschau zielt dabei nicht auf eine umfassende lineare historische Darstellung ab, sondern entwirft anhand ausgewählter Tiefenbohrungen ein präzises und mitunter überraschendes Bild schweizerischer kultureller Befindlichkeit. Die Untersuchungen werden gelenkt von einem Interesse an den Kreuzbestäubungen nicht nur zwischen den Gattungen Kunst, Architektur und Design, sondern auch zwischen den Polen der Hochkunst und der Massenkultur (sofern es diese überhaupt noch gibt); ein Denkansatz, der einem bereits aus früheren Publikationen von von Moos bestens vertraut ist. Dabei ist die Operation motiviert durch eine Neugier an soziologischen und kulturgeschichtlichen Zusammenhängen, die einer «gewissen Ungeduld mit einer vor allem beschreibenden, inventarisierenden oder abgehoben theoretisierenden Kunsthistorie» entspringt.
Die ersten beiden Aufsätze des Bandes befassen sich mit allgemeinen Überlegungen zur Thematik und verstehen sich als theoretische Grundlegung. Während in einem dieser Beiträge die historische Dimension der Karnevalisierung des Urbanen bis etwa zu den «sacri monti» der Gegenreformation zurückverfolgt wird, stellt von Moos im anderen im Hinblick auf die schweizerische kulturelle Identität das schizophrene Nebeneinander von Nostalgie und Modernität fest. Und kommt dabei zum Schluss, dass das Chalet als Prototyp nationalromantischen Schwelgens und die in den neunziger Jahren zum Exportschlager avancierten minimalistischen «Swiss Boxes» vielleicht gar keine sich ausschliessenden Erscheinungen sind, sondern die Kehrseiten ein und derselben Medaille. In den weiteren Essays werden sodann exemplarische Einzelbetrachtungen angestellt, wobei der Fokus nun spezifisch auf die Schweiz gerichtet ist. So zeigt von Moos an den Beispielen von Luzern und der Unterschutzstellung der Burganlagen von Bellinzona durch die Unesco den Zusammenhang zwischen der Ökonomie des Massentourismus und der Kultur des Spektakels auf.
Unterhaltsam und subversiv
Des Weiteren werden zwei für die kulturelle Schweiz zentrale Figuren aufs Korn genommen: der von der Kunstgeschichte seit Jahrzehnten totgeschwiegene Hans Erni sowie Max Bill, dessen Projekt einer «konstruktiven Schweiz» gewissermassen im Gegenzug eine Adelung zur offiziellen Staatskunst erfuhr. Aber auch Figuren und Ereignisse aus der jüngeren Vergangenheit rücken in den Blickpunkt der Betrachtungen, so das Duo Fischli/Weiss und Pipilotti Rist in ihrer Funktion als künstlerische Direktorin der Expo 02 bei den Künstlern sowie Mario Botta und Herzog & de Meuron bei den Architekten. All das wird in einem sprachlichen Duktus vorgeführt, der nicht nur anregend und erhellend, sondern unterhaltsam und bisweilen subversiv zugleich ist. Die Beiträge verbinden ein scharfsinniges Nachdenken über Phänomene, die nur allzu gerne unter den Teppich gekehrt werden, mit essayistischer Verve. Wem die Schweiz und das Schicksal des Projekts der Moderne hierzulande am Herzen liegt, der wird in dem Band in mehrfacher Hinsicht lesenswerte Beiträge finden.
[ Stanislaus von Moos: Nicht Disneyland. Und andere Aufsätze über Modernität und Nostalgie. Verlag Scheidegger & Spiess. Zürich 2004. 236 S., Fr. 48.-. ]
Gebaute Schatten der Vergangenheit
Das architektonische Erbe des Kommunismus
In Rumänien wird derzeit eine lebhafte Debatte zum Umgang mit dem gebauten Vermächtnis des Kommunismus geführt. Zwei Brennpunkte haben dabei jüngst die Gemüter erregt: der Carol-Park mit seiner leerstehenden Grabstätte für die Helden des Sozialismus sowie der Ceausescu-Palast als neuer Sitz des Parlaments.
Die Zeiten, da Bukarest sich «Paris des Ostens» nennen konnte, sind längst vorbei. So ist es weniger das bunte städtische Treiben auf eleganten Boulevards der Jahrhundertwende, das unsere Vorstellung von der rumänischen Kapitale heute prägt, als vielmehr ein Gebäude, das den Bewohnern Bukarests vor nicht allzu langer Zeit Inbegriff für Unterdrückung und Staatsterror schlechthin war: Es handelt sich dabei um das gigantische «Haus des Volkes», das Ceausescu in den achtziger Jahren unter enormen Aufwendungen erbauen liess und das heute als einer der weltweit grössten Profanbauten überhaupt gilt. Es mag die schiere Grösse sein, die den südlich des Zentrums sich erhebenden Koloss im neostalinistischen Gewand zu einer der gefragtesten Tourismusattraktionen der Stadt hat werden lassen, ja zu ihrem eigentlichen Emblem.
Architektur und Identität
Die Faszination der Touristen ist das eine, die Haltung der Bukarester das andere. Im Unterschied zur Intelligenzia des Landes scheint die Bevölkerung den Palast nicht nur lieb gewonnen, sondern ihn zum identitätsstiftenden Objekt erhoben zu haben. Vergessen sind die entbehrungsreichen achtziger Jahre, als erhebliche Teile des Bruttoinlandprodukts dem Bau zuflossen und Zwangsarbeit an der Tagesordnung war. Und vergessen scheint auch die noch immer sichtbare Wunde, die das Unternehmen in den Stadtorganismus riss. Gut ein Fünftel der Innenstadt hatte damals dem Grössenwahn des Diktators weichen müssen; 40 000 Menschen wurden in Retortensiedlungen am Stadtrand umgesiedelt. Dass ausgerechnet dieses Bauwerk nun als «Parlamentspalast» das neue, demokratische Rumänien verkörpern soll, erscheint als eine Ironie der Geschichte.
Die erstaunliche Ausblendung der politischen Dimension von Architektur und ihrer Instrumentalisierung durch Ceausescu zeigt sich deutlich in der Debatte um die Nutzung des Palastes, der ursprünglich als repräsentativer Regierungssitz vorgesehen war. Kurz nach dem Sturz des «Genius der Karpaten» hatte zunächst ein Wettbewerb eine Reihe utopischer Projekte hervorgebracht, die auf das Problem hinwiesen, dass sich der Bau angesichts seiner semantischen Überlagerungen vermutlich gar nicht ohne weiteres würde umnutzen lassen. Schnell ging man indes zur Tagesordnung über. Nach dem Einzug eines Kongresszentrums, das seit längerem zu den horrenden Unterhaltskosten des unvollendeten Baus beiträgt, kamen im Jahr 2000 das Abgeordnetenhaus und im vergangenen Jahr auch noch der Senat des nationalen Parlaments dazu.
Die heikle Frage der Transformation eines Bauwerks des Totalitarismus zum architektonischen Platzhalter des jungen demokratischen Staats wird wohl von einer späteren Generation aufgegriffen werden müssen. Pikant ist nicht zuletzt, dass die für den Senat notwendigen Um- und Ausbauarbeiten von Anca Petrescu ausgeführt wurden, der ehemaligen Chefarchitektin Ceausescus, die damit unbehelligt an ihrem Lebenswerk weiterbauen kann. Gnädiger stimmte da vor kurzem die Eröffnung eines Museums für Gegenwartskunst im rückwärtigen Teil des Hauses (NZZ 4. 12. 04). Der Architekt Adrian Spirescu kontrastierte den neobarocken Prunk mit einer zurückhaltenden, modernistischen Formensprache und handelte sich so prompt die Kritik Petrescus und ihrer Parteigänger ein. Als Handicap für den Museumsbetrieb könnte sich erweisen, dass der Palast, vom städtischen Leben durch weite Brachen abgetrennt, ein ziemlich isoliertes Dasein fristet.
Ein Mausoleum ohne Helden
Fragen zum Umgang mit dem architektonischen Erbe der jüngeren Vergangenheit stellen sich in Bukarest derzeit auch an anderen Objekten. Eine lebhafte Debatte entspann sich jüngst um den «Parcul Carol», wo sich in fast exemplarischer Weise die für Bukarest so typische Überlagerung von historischen Schichten beobachten lässt. Der Park wurde 1906, anlässlich der 40-jährigen Regentschaft des ersten Königs der Rumänen, vom französischen Landschaftsarchitekten Edouard Redont als Gelände für eine Landesausstellung konzipiert. Er verstand sich einerseits als Gegenstück zur traditionell wenig kompakten, dem orientalischen Muster verpflichteten Stadtstruktur und damit als Bekenntnis zu deren «Europäisierung». Andrerseits bestand er aus einer romantischen Collage von landschaftsgestalterischen Elementen wie Alleen, See und Hügel sowie von Beispielen rumänischer Architektur, die durch gewundene Wege miteinander verbunden waren.
Die kommunistischen Repräsentationsansprüche führten dann zu einer bedeutenden Umgestaltung des beliebten Naherholungsgebiets, errichteten die Architekten Horia Maicu und Nicolae Cucu hier doch Anfang der sechziger Jahre ein Denkmal für die Helden des Sozialismus, das gleichzeitig als Mausoleum für die Spitzenfunktionäre der Partei und als Wahrzeichen diente. Damals wurde vom Parkeingang her eine monumentale Achse mit Treppenabschluss durch die Anlage gelegt, was ihren Charakter nachhaltig veränderte. Zwar wurden Symmetrie und Monumentalität als Leitprinzipien des bereits überwundenen Stalinismus beibehalten; architektonisch aber artikuliert sich das Denkmal durch formale Reduktion im Sinne eines modernisierten Klassizismus. Nach dem Sturz des Regimes wurden die Gebeine der kommunistischen Machthaber entfernt, womit das Denkmal seinen ursprünglichen Daseinszweck verlor.
Ausgerechnet an diesem historisch neuralgischen Punkt, der sich als Ort zur Reflexion der jüngeren Geschichte (etwa in Form eines Museums) geradezu anböte, möchte nun die rumänisch-orthodoxe Kirche eine riesige «Kathedrale des Volkes» errichten. Kritik erwuchs diesem Projekt nicht nur aufgrund seiner eindeutig nationalistischen Ideologie. Anstoss erregte auch der Umstand, dass das Vorhaben mit dem bestehenden Park in bekannt unzimperlicher Weise umzuspringen gedenkt. Nicht zuletzt wurde dem Bukarester Patriarchen seine Unterstützung des Projekts zum Vorwurf gemacht, nachdem er einst die Zerstörung zahlreicher künstlerisch wertvoller Kirchen im Zeichen des gigantomanischen Stadtumbaus unter Ceausescu widerspruchslos hingenommen hatte. Erst als die Vorarbeiten zum Abbruch des Denkmals im Park - notabene ohne Konsultierung der Denkmalkommission - bereits begonnen hatten, verfügte der Bürgermeister der Stadt, der inzwischen als Vertreter der Opposition zum Staatspräsidenten gewählt worden ist, vorerst einen Baustopp.
Gleichwohl sind der Fortbestand von Park und Denkmal und die Möglichkeit zur Schaffung eines zentralen Orts der Auseinandersetzung mit der kommunistischen Vergangenheit noch keineswegs gesichert, verfügt die Kirche in der Bevölkerung doch über grossen Rückhalt. Immerhin aber ist die gegenwärtige Denkpause dem beherzten Widerspruch der Mehrheit der Einwohner der Hauptstadt, den Intellektuellenkreisen und der Presse zu verdanken. Die Reife der heranwachsenden Zivilgesellschaft wird sich nicht zuletzt an ihrer Fähigkeit ermessen lassen, die Vergangenheit als Element der eigenen Identität zu akzeptieren, statt sie hinter leeren Gesten der (nationalen) Repräsentation zu verstecken.
Zwischen Schweizer Rationalität und amerikanischem Prunk
Das neue Fünfsternhotel Park Hyatt Zürich von Meili und Peter
Seit kurzem verfügt Zürich mit dem „Park Hyatt“ über ein neues Hotel der Höchstklasse. Das Haus an der Beethovenstrasse zeigt nach aussen einen kühlen schweizerischen Rationalismus, im Innern dominiert gediegener Luxus. Zu einer Einheit verbinden sich die beiden Konzepte nicht. 90 im Gebäude verteilte zeitgenössische Kunstwerke sollen nicht die Gäste provozieren, sondern dezent Akzente setzen.
Ein Grossprojekt aus der Feder von Meili und Peter Architekten war letzten Sommer in aller Munde: das geplante Stadion Zürich mit der umstrittenen Mantelnutzung. Im Schatten dieser Diskussionen konnte Ende September ein vom gleichen Zürcher Büro stammender Grossbau bezogen werden. Mit dem Hotel Park Hyatt an der Beethovenstrasse wurde in der Stadt erstmals seit zwanzig Jahren wieder ein Fünfsternehotel eröffnet. Damit kämpft in der Kategorie der Luxushotels neben den Zürcher Traditionshäusern ein weiterer Konkurrent um die Gunst der Kundschaft. Dass die bestehenden Häuser nicht untätig sind, belegen die Erneuerungen von Eingangshalle, Restaurants und Zimmern im Hotel Savoy Baur en ville, die jüngsten Umbauten im und am „Baur au Lac“ und die laufende Erneuerung des Dolder Grand Hotel. Die Phase der Planung und des Baus der jüngsten Zürcher Erstklasshotels erstreckte sich über eine Zeit von mehr als einem Jahrzehnt.
Dem Quartiercharakter angepasst
Für das „Park Hyatt“ wurde das Grundstück des Parkhauses Escherwiese an der Beethovenstrasse ausgewählt. Das Haus befindet sich mitten in einem Geschäfts- und Büroviertel, in unmittelbarer Nachbarschaft zum Kongresshaus und nahe dem See. Nach einem Wettbewerb wurden die (ursprünglich zweitplacierten) Zürcher Architekten Marcel Meili und Markus Peter mit der Ausführung des Neubaus betraut. Sie entwarfen einen sechsstöckigen Baukörper, der die architektonische Sprache der umliegenden Geschäftshäuser aufnimmt und sich dem Quartiercharakter anpasst.
Durch die Materialisierung und die Gliederung der Fassade vermeiden die Architekten den Eindruck eines langweiligen Serienbaus. Das Erdgeschoss ist fast durchwegs verglast und unterscheidet sich von den übrigen Stockwerken durch eine Metallverkleidung. Vom Parterre aus werden nicht nur die Hotellobby, sondern auch die verschiedenen Restaurants sowie der grosse Ballsaal mit je eigenen Eingängen erschlossen. In den fünf Obergeschossen kommt ein Sichtbetonkörper zum Vorschein. Er wird durch grosse, rechteckige Fensterflächen in olivfarbenen, bedruckten Glasrahmen gegliedert, die wie Schubladen in den Baukörper hineingeschoben sind. Gegenüber dem Betonkörper stehen sie um einige Zentimeter vor, was auf der Fassade ein bewegtes Spiel von Licht und Schatten ergibt.
Das solide Volumen wurde von Meili und Peter an mehreren Stellen aufgebrochen. So stehen an der Beethovenstrasse die beiden unteren Geschosse der rechten Fassadenhälfte um mehrere Meter zurück. Damit wird der Eingangsbereich zum Hotel markiert und Raum für die Aussenbestuhlung des Restaurants geschaffen. Zu den gestalterischen Attraktionen gehören die beiden aus dem Baukörper ausgeschnittenen, offenen Innenhöfe, die sich jeweils über die vier obersten Stockwerke erstrecken. Der eine Hof ist mit einer Moos-Skulptur bewachsen, der andere mit einem Feld aus grünlichen Steinplatten belegt, das die Bühne für ein dezentes Wasserspiel bildet. Beide Arbeiten - sie stammen von Vogt Landschaftsarchitekten - nehmen den rechteckigen Raster der Fassade auf.
Gänzlich andere Innenarchitektur
Bei einem Gang ins Innere des Hotels wird der Eindruck luzider Rationalität beinahe in sein Gegenteil verkehrt. Meili und Peter zeichneten bei der Innenausstattung nur für das - öffentlich zugängliche - Personalrestaurant verantwortlich, in welchem sie ihre kühle Ästhetik mit der Verwendung von Metall und Glas fortsetzten. Für die übrigen Räume war die auf Hotelausstattung spezialisierte amerikanische Firma Hirsch Bedner Associates in Zusammenarbeit mit Ramseier & Associates zuständig. Die weiträumige und zehn Meter hohe Lobby wirkt trotz ihrer grosszügigen Bemessung dunkel und in Erwartung eines einheitlichen, die innere und äussere Erscheinung verbindenden Konzepts beinahe muffig. Dennoch erzielen die Innenarchitekten mit eklektischen Ensembles aus klassisch-eleganter Möblierung, einem Cheminée, einem Bambusgarten sowie Kunstwerken eine stimmige Atmosphäre, die der Gediegenheit eines luxuriös ausgestatteten Wohnzimmers entspricht. Verschiedene Elemente wie der schwarze Marmorboden oder die hellen Lederpaneele und Kirschbaumverkleidungen an den Wänden sind Anleihen beim Corporate Design der Hyatt-Gruppe und vermitteln dem primär anvisierten Zielpublikum der Geschäftsreisenden ein vertrautes Bild.
Der Eindruck von etwas biederem Luxus besteht auch in den übrigen öffentlichen Bereichen und bei den 142 grosszügigen Zimmern und Suiten mit ihren raumhohen Fenstern. Besonderen Wert legten die Architekten auf das Zusammenspiel edler, dunkler Hölzer mit hellen Wandpartien. Die Badezimmer in den Suiten lassen keine Wünsche offen und gestatten aus ihren freistehenden Wannen Ausblicke - im besten Fall bis auf den See. Es stimmt fast schon versöhnlich, dass schweizerisches Bekenntnis zu zeitgemässer Urbanität und amerikanisches Faible für üppige Interieurs keinen gemeinsamen Nenner gefunden haben.
„The City as Loft“
Ausstellung an der ETH zur Architektur von Kees Christiaanse
Kees Christiaanse, seit 2003 Professor für Städtebau an der ETH Zürich, hat jüngst mit seinem Masterplan für die „Science City“ auf dem Hönggerberg und mit seinen Plänen zur Überbauung des Areals südwestlich des Zürcher Hauptbahnhofs von sich reden gemacht. Die Ausstellung „The City as Loft“ bietet derzeit Gelegenheit, sich ein Bild von Christiaanses architektonischen und planerischen Ideen zu verschaffen. Der Schwerpunkt der Ausstellung liegt bei Projekten zur Umnutzung ehemaliger Industrie-, Hafen- und Bahngelände, der „waiting lands“ der europäischen Städte. Vorgestellt werden etwa die Planung für die Hamburger „Hafen City“, wo auf ehemaligem Hafengebiet innerhalb der nächsten 25 Jahre Raum für 5500 Wohnungen und 20 000 Arbeitsplätze entstehen soll, die Entwicklungsstudie für einen neuen Stadtteil am Hafen von Oslo, das Konzept für das Bahnhofsgebiet von Groningen und die Erweiterung des Eindhovener Flughafens.
Projekte aus Holland
Besonders prominent sind Projekte aus den Niederlanden vertreten. Dort wurden in den letzten Jahren zahlreiche ambitiöse urbanistische Planungen in Angriff genommen, deren Grossräumigkeit hierzulande undenkbar erscheint. Der Loft als grosser, formal unbestimmter und flexibel nutzbarer Raum dient Christiaanse und seinem Büro KCAP/ASTOC dabei als Modell für städtebauliche Überlegungen: Die Offenheit des Entwurfs soll im urbanen Raum eine Nutzungsvielfalt ermöglichen, ohne künftige Entwicklungen vorwegzunehmen oder gar zu verunmöglichen.
Fokus auf der Theorie
Die Ausstellung ist weniger Leistungsschau als vielmehr Plattform für eine grundlegende theoretische Stellungnahme anhand von sieben Thesen. So verleiht die Sektion „Control & Laissez Faire“ der Überzeugung Ausdruck, dass Totalplanung aufgrund unkontrollierbarer Faktoren unmöglich, eine entwerferische Vision aber dennoch nötig ist. Die Trennung von Text und Bild und die Präsentation der Projekte in Form einer fotografischen Collage erlauben es dem Besucher nicht ohne weiteres, sich einen umfassenden Eindruck der einzelnen Projekte und Planungen zu verschaffen - der Fokus auf der Theorie geht zulasten der Anschaulichkeit. Die Ausstellungszeitung liefert die nötigen Informationen nach.
[ Bis 20. Januar. ETH Zentrum, Haupthalle, Rämistrasse 101.]
Gebautes, Geplantes und Verworfenes
Arbeiten der Architekten Gigon/Guyer im Architekturforum
Für die Ausrichtung der letzten Ausstellung des Jahres erteilt das Architekturforum Zürich in der Regel einem Büro Carte blanche. Die Wahl ist in diesem Jahr auf das Duo Annette Gigon und Mike Guyer gefallen. Die Architekten leisteten der Einladung mit der Präsentation von 25 Projekten aus den letzten vier Jahren Folge. In drei Sektionen werden nicht nur bereits realisierte Bauten gezeigt, sondern auch etwelche, die sich noch in der Planungsphase befinden. Zu sehen sind zudem Projekte, die nicht über den Entwurf hinausgekommen sind, die der gegenwärtigen Arbeit der Architekten aber als Ideenfundus dienen. Die Ausstellung vermittelt somit ein Bild über das Schaffen der Architekten, die sich erfolgreich nicht nur im Raum Zürich, sondern auch auf internationalem Parkett bewegen.
Einblick in den Entwurfsprozess
Der Besucher betritt einen abgedunkelten Raum, in dem 25 schwarz bemalte Kisten mit je einem Diaprojektor aufgestellt sind. Diesen ist je eines der präsentierten Projekte zugeordnet. Der Ausstellungsraum funktioniert als Projektionsraum, an dessen Wände simultan Lichtbilder der gebauten und geplanten Projekte geworfen werden. Dem Kenner der Arbeit von Gigon/Guyer erlaubt die Simultanprojektion einen raschen Gesamteindruck über das jüngste Schaffen. Bauten wie der unterirdische Hörsaal der Universität Zürich und das jüngst eröffnete Museum Albers/Honegger im südfranzösischen Mouans-Sartoux, aber auch künftige Planungen wie der Hochhausentwurf für das Löwenbräuareal lassen sich auf einen Blick vergegenwärtigen.
Zugleich bietet die Ausstellung die Möglichkeit zur vertieften Auseinandersetzung mit einzelnen Projekten. Diese werden ausführlich mit Bildern vorgestellt, die von der Fotografie über das Computer-Rendering bis zum Grundriss reichen. Die gezeigten Modelle aus der Planungsphase ermöglichen zudem einen Einblick in den Entwurfsprozess. Ergänzt werden die Bilder durch Informationstafeln, die neben den wichtigsten Baudaten auch eine prägnante Baubeschreibung aufweisen.
Verzicht auf Modelle
Der vollständige Verzicht auf Modelle und Materialmuster ist ein Experiment im Genre der Architekturausstellung. Er sorgt für einen homogenen Gesamteindruck und verwischt die Grenzen zwischen „gebaut“ und „nicht gebaut“, indem Projekte in derselben Form wie ausgeführte Bauten präsentiert werden. Es war eine Intention der Architekten, mit der Ausstellung die Gleichwertigkeit der Projekt gebliebenen Entwürfe gegenüber den gebauten zu verdeutlichen.
Indes müssen mit dem Konzept in anderen Belangen Abstriche gemacht werden. Zwar haben Gigon/Guyer mit Plänen und Modellaufnahmen vermieden, die verführerische Architekturfotografie für sich alleine sprechen zu lassen. Mehrere für ihre Arbeit wichtige Aspekte kommen aber nur bedingt zum Ausdruck. Zum einen stellt die gewählte Form der Ausstellung eine Blütenlese der besten Projekte dar, und entsprechend sind vergleichsweise viele Bauten für Kunst und Kultur anzutreffen. Bei der Präsentation solcher Einzelbauten lassen sich städtebauliche und kontextbezogene Überlegungen jedoch weniger gut thematisieren; diese sind gerade in den jüngsten Vorschlägen der Architekten für Hochhäuser auf dem Löwenbräu- und dem Maag-Areal zentral. Zum andern bleibt auch die Frage der Materialien nur ansatzweise beantwortet, können doch Aspekte wie etwa die Textur nur erahnt werden. Entstanden ist dennoch eine informationsreiche und auch gestalterisch ansprechende Schau.
[ Architekturforum Zürich, Neumarkt 15. Zur Ausstellung erscheint eine Begleitpublikation zu einer Reihe nicht realisierter Planungen: Projekte - Gigon/Guyer. Text Hubertus Adam, Hrsg. Heinz Wirz. Quart-Verlag, Luzern 2004. 72 S., Fr. 48.-. ]
Neue Basler Architektur
Basel ist die unbestrittene Architekturhauptstadt der Schweiz. Dieser Umstand veranlasste vor einigen Jahren Lutz Windhöfel zur Publikation eines handlichen Führers durch die „trinationale Stadt“, in welchem die wichtigsten zwischen 1980 und 2000 entstandenen Neubauten in Bild und Text dokumentiert wurden. Der architektonischen Entwicklung Basels, die auf anhaltend hohem Niveau weitergeht, trägt nun eine überarbeitete und erweiterte Neuauflage des Bandes Rechnung, der das Geschehen bis in die Gegenwart nachführt. In bewährter Manier werden die insgesamt 108 Projekte jeweils auf einer Doppelseite anhand von Fotografien, Plänen und einem kurzen Kommentar präsentiert. Als besonders nützlich für unterwegs erweisen sich die Stadtpläne, auf denen die behandelten Bauten eingezeichnet sind, sowie die Angaben zur Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Unterteilung in 13 Kapitel legt Rundgänge in den verschiedenen Stadtbezirken nahe, wobei auch die Gemeinden um Basel sowie die grenznahen Städte im Ausland angemessen berücksichtigt werden. Gegenüber der ersten Auflage hat eine ganze Reihe seither erstellter Neubauten Eingang in den Führer gefunden; einige vormals verzeichnete Gebäude fanden dagegen keine Aufnahme mehr. Zu den neuen Einträgen gehören so wichtige Bauten wie das Schaulager oder der St.-Jakob-Park von Herzog & de Meuron, der Messeturm von Morger, Degelo und Marques oder die Bahnhofs-Passerelle von Cruz & Ortiz und Giraudi & Wettstein. Die Auswahl einer relativ beschränkten Anzahl besonders hervorstechender Beispiele ist dabei für einen Führer notwendig und sinnvoll. Dennoch wird man auch in der Neuauflage einige prominente Gebäude schmerzlich vermissen, darunter das Wohn- und Geschäftshaus an der Schützenmattstrasse von Herzog & de Meuron oder Zaha Hadids (ehemalige) Feuerwehrstation auf dem Gelände von Vitra in Weil - immerhin das erste Hauptwerk der Gewinnerin des diesjährigen Pritzker- Preises.
[ Lutz Windhöfel: Architekturführer Basel 1980-2004. Birkhäuser-Verlag, Basel 2004. 272 S., Fr. 34.-. ]
verknüpfte Publikationen
- Architekturführer Basel 1980-2004