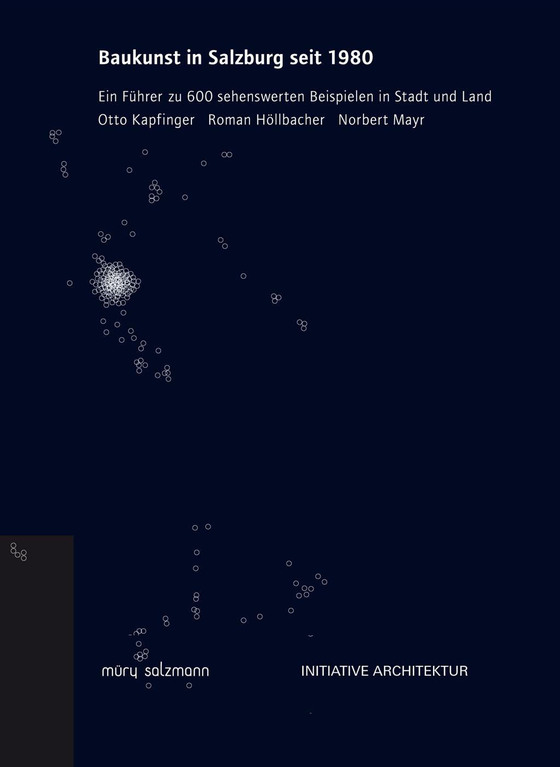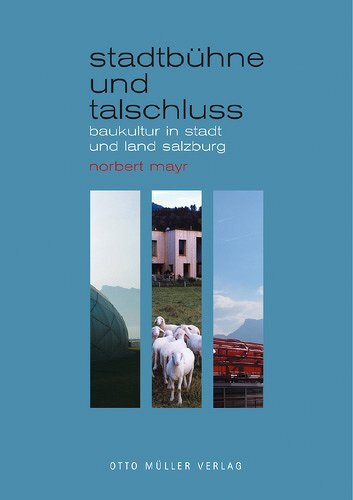Am Ende doch grün
Der Salzburger Stadtteil Lehen wird dank ambitionierter Nutzungskonzepte immer grüner und lebenswerter. Das vierte neue Konzept ist nun fertig: Parklife – ein vielfältiges Gebäude inmitten einer Grünfläche.
Das Erscheinungsbild des Salzburger Stadtteils Lehen wird noch heute vom Bauboom und dem sozialen Wohnbau der Nachkriegsjahrzehnte geprägt. Ende der 1970er-Jahre formierte sich gegen die zu maßlose Verdichtung und Bauspekulation die Initiative für mehr Lebensqualität. Die Protestbewegung forderte Verbesserungen ein. So entstanden durch Rückwidmungen von ausgewiesenem Bauland in Grünland kleine Parks und Spielplätze. Diesen von den Lehenern erkämpften Parks wollen die zuständigen Dienststellen allerdings keine „richtigen“ Namen geben: „Namensgebungen ohne postalische Auswirkungen werden nur in besonders begründeten Fällen vorgenommen“, heißt es im Amtsbericht. Damit wird der „postlose“ Freiraum ausgegrenzt statt aufgewertet. Vielleicht greift eineDiskussion Platz, wenn ab 7. Juni die Ausstellung „Landschaft Lehen“ im Salzburger Künstlerhaus gezeigt wird.
Das Rahmenprogramm der „Initiative Architektur“ bietet auch den Besuch der Parks und mehrerer Neubau-Ensembles. Vier ambitionierte Nach- bzw. Neunutzungen sind infolge des „Entwicklungskorridors Ignaz-Harrer-Straße/Münchner Bundesstraße“ 1998 entstanden. Diese mit dem Gefüge des Stadtteils vernetzten Interventionen erhielten 2007 als „Raum:Werk:Lehen, Salzburg – Strategien einer Stadterneuerung“ den 5. Otto Wagner Städtebaupreis: Das Architekturbüro Halle 1 plante das Wohn- und Geschäftshaus @fallnhauser (2006) und die „Neue Mitte Lehen“ (2009), das „Stadtwerk Lehen“ beherbergt auf Basis des Masterplansvon Max Rieder einen Nutzungsmix mit 300 Wohnungen. Das oberirdisch vom motorisierten Verkehr frei gehaltene Quartier weist eine für Salzburg sehr hohe Bebauungsdichte auf. Die zweite Bauetappe wird gerade umgesetzt, sodass die Nagelprobe bald zeigen kann, ob der angeblich 46Prozent einnehmende öffentliche Raum den notwendigen Ausgleich leisten kann.
Der vierte Baustein Parklife wurde 2010/ 2012 als modifiziertes Siegerprojekt von „Europan 07“ 2003 realisiert. Touzimsky Herold & Mehlem verknüpften das geforderte Raumprogramm mit dem von der Stadtplanung vorgegebenen öffentlichen Park von 3000 Quadratmetern: Die Architekten nahmen einen Heckenring in Form des Blockrands zum Ausgangspunkt der Gebäudestruktur. Aus dem eigentlich privaten Hof generieren neu geschaffene Verbindungswege einen attraktiven Treffpunkt der Bewohner mit der Öffentlichkeit.
Der die Grundstücksränder markierende Sockel beherbergt etwa den Supermarkt. Er wölbt sich im Osten zum künstlichen „Hügel“ mit 32 teilbetreuten Seniorenappartements. Über dem Sockelgeschoß aufgeständert sind das prägnante, sechsstöckige Apartmenthaus mit 56 geförderten Mietwohnungen im Westen und das Seniorenwohnhaus um einen Hof im Süden. So begrenzt diese topografisch überformte „Blockrandbebauung“ locker den öffentlichen Park im Zentrum. Der Freiraum sollte sich als „erweiterter Park“ über gefaltete Flächen auch auf die Decks, die Zonen unter der Aufständerung, ausweiten und zur barrierefreien Bewegungsfläche mit Kuppen, Tälern und Graten werden. Mit der Umsetzung kamen zahlreiche, verschiedene Territorien absteckende Zäune.
Die vom Generalunternehmer äußerst mäßig ausgeführte Sichtbetonqualität in denStiegenhäusern des Wohnhauses verweist auf das „Streichkonzert“, das die Architektur erleiden musste. Realisiert werden konnten die umlaufenden Terrassenringe als wesentlicher Teil der hohen Wohnqualität in den 56 Einheiten. Auch konnten die Architekten die Aufständerung mit öffentlichen Decks und ihre Durchgängigkeit halten, mehrfach musste der Gestaltungsbeirat zentrale Konzeptideen unterstützen und verteidigen.
Sind auch die Fassaden heute nicht mehr von vertikalem Grün, sondern einer Gestaltung mit weißen und dunklen Alucobond-Platten geprägt, so konnten die Architekten doch das Entwurfskonzept horizontaler Schichtung in drei Ebenen umsetzen. Die Basis erfährt in Reaktion auf die Nachbarschaft ihre präzise Geometrie. Das Deck darüber ist begehbarer Außenraum, den dritten Bereich bilden die aufgeständerten Baukörper. Der öffentliche Park im Zentrum ist nicht nur auf die rund 3000 Quadratmeter begrenzt, im Kontinuum mit den begrünten Dächern erscheint er viel größer. Diese Großzügigkeit der Grünanlage bei einer angrenzenden Geschoßflächenzahl von 1,15 blieb seit dem Wettbewerbssieg 2003 ein zentraler Mehrwert. Leider wurde der Landschaftsarchitekt vom Wohnbauträger eingespart. Nun liegt es an diesem und dem städtischen Gartenamt, ob sich die Lehener inmitten gepflegter Wiesen- und Sedumflächen wohlfühlen können.
Auf zwei der vier erwähnten Areale in Lehen wurde der gesamte Gebäudebestand abgerissen, beim dritten blieb nur das Stadtwerke-Hochhaus (1968) erhalten. Bei Parklife auf dem einstigen Mercedes-Areal vernichtete diese Haltung die bauhistorisch sehr bemerkenswerte Lkw-Reparaturwerkstätte von Gerhard Garstenauer und Wolfgang Soyka. Sie hatte 1960/62 den „Beginn der Auseinandersetzung mit dem konstruktiven Fertigteilbau aus Stahlbeton im Industriebau“ markiert. Für die vielfältig nutzbare Räumlichkeit entwickelte die Stadt keinerlei Nachnutzungsszenarien, obwohl es etwa konkreten Bedarf an einer multifunktionalen Freizeithalle für die Jugend im Norden der Stadt gab.
Eine optimierte, ressourcenschonende Stadtteilreparatur mit Substanz, die den Bestand und dessen räumliche Potenzialenutzt, statt unhinterfragt taugliche Gebäude(teile) zu entsorgen, ist in Salzburg noch nicht angekommen. Bei der aktuellen Nachnutzung der „Rauchgründe“ ist das markante, um 1900 entstandene Silogebäude vom Abriss bedroht. Diese beeindruckende Landmark der Rauchmühle ist ein Identifikationspunkt für Lehens Süden, besitzt aber weder einen Denkmalschutz noch ein Erhaltungsgebot der Stadt. Dieses unverantwortliche Versäumnis der öffentlichen Handtrifft auch die Riedenburg-(Turn)Halle von 1926 und die sogenannte „Panzerhalle“ von 1939. Letztere befindet sich im benachbarten Maxglan. Dort erkannte erfreulicherweise der neue Eigentümer die Qualitäten sowie das Einsparungspotenzial gegenüber einem Neubau. Die Holzhalle wird zur Zeit adaptiert, sie soll ihre räumliche Großzügigkeit behalten und könnte ein Begegnungsort im Stadtteil werden.