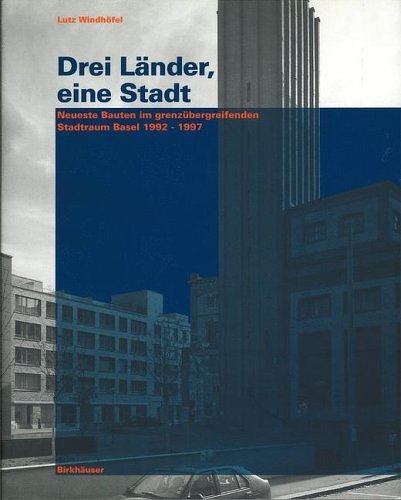Artikel
Betontürme und Glasskulpturen
Die Ausstellung «Balkanology» im Schweizerischen Architekturmuseum Basel
Die bauliche Entwicklung der letzten sechzig Jahre im Gebiet zwischen Adria und Donau ist Thema einer schillernden Ausstellung im Schweizerischen Architekturmuseum Basel. Die informative Schau zeigt unbekannte Bauten der Nachkriegszeit und zeitgenössische Meisterwerke.
In spätantiker Zeit war die östliche Adriaküste ein Zentrum der Weltpolitik. Zu Beginn des 3. Jahrhunderts liess sich Kaiser Diokletian in Split einen riesigen Wehrpalast erbauen. Split ist heute nach der Hauptstadt Zagreb die zweitgrösste Stadt Kroatiens. Zusammen mit Slowenien, Serbien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro, Mazedonien, Kosovo und Albanien ist Kroatien noch heute Teil eines alten Kulturraums, der an Italien und Österreich, an Ungarn, Rumänien, Bulgarien und Griechenland grenzt. Die Zentren und Hauptstädte sind Ljubljana, Belgrad, Sarajevo, Podgorica, Skopje, Pristina, Tirana und Zagreb. Einen architektonischen Querschnitt durch diese Kulturlandschaft, die nach dem Zweiten Weltkrieg sozialistisch regiert wurde, vor 15 Jahren durch einen Bürgerkrieg die Welt in Atem hielt und heute dem rauen Wind der wirtschaftlichen Öffnung ausgesetzt ist, legt nun die von Gastkurator Kai Vöckler zusammengestellte Ausstellung «Balkanology» im Schweizerischen Architekturmuseum Basel.
Architektonischer Wandel
Das komplexe Thema ist in einen historischen und einen zeitgenössischen Ausstellungsteil gegliedert. Einerseits zeugen 21 grösstenteils realisierte Einzelprojekte und stadtplanerische Visionen von der avantgardistischen Architekturmoderne nach dem Zweiten Weltkrieg. Anderseits veranschaulichen zahlreiche seit 1991 entstandene Vorzeigebauten bausoziologische und bauökonomische Probleme, engagierte Initiativen sowie architektonische Hybridformen. Die Exponate werden auf hängenden, zu strukturierenden Raumeinheiten arrangierten Tisch- und Wandflächen präsentiert, die sich mitunter wie ein Fischmaul oder ein Blütenkelch öffnen.
Der retrospektive Blick setzt ein mit Jože Plečniks klassischer National- und Universitätsbibliothek in Ljubljana (1940). Nachhaltiger aber war der Einfluss von Le Corbusier, in dessen Pariser Atelier vor dem Beginn des Zweiten Weltkriegs zahlreiche Architekten des späteren Jugoslawien gearbeitet hatten und dessen Werk 1953 im Balkanstaat in einer repräsentativen Wanderausstellung gezeigt wurde. So spiegelt sich seine Unité d'Habitation in Marseille (1952) in Juraj Neidhardts Apartmenthaus in Sarajevo (1958). Man rezipierte auch die Baudoktrin der Congrès internationaux d'architecture moderne (CIAM), gemäss der die Trabantenstädte Neu-Belgrad (ab 1947) und Neu-Zagreb geplant und teilweise gebaut wurden. Mit Vjenceslav Richters jugoslawischem Pavillon auf der Weltausstellung in Brüssel (1958) zeigte sich die planwirtschaftliche Baukultur auf der Höhe der zeitgeistigen Nachkriegsmoderne. Neben solch respektablen Einzelwerken thematisiert «Balkanology» auch den Wiederaufbau des durch ein Erdbeben zerstörten Skopje nach Plänen von Kenzo Tange (1963).
Selbsthilfe
Für die postkommunistische Baukultur steht der beispielhafte Sitz der slowenischen Industrie- und Handelskammer in Ljubljana von Sadar & Vuga (1999) oder das Museum für zeitgenössische Kunst in Zagreb von Studio Za Arhitekturu und Igor Franić, das im kommenden Jahr eröffnet wird. Herausragend wirkt ein grosser, unkonventioneller Hausriegel der kroatischen Architekten Iva Letilović & Morana Vlahović in Krapinske Toplice (2003), der für einen vitalen sozialen Wohnungsbau steht. Dies sind die Hoffnungsträger künftiger Baukultur. Doch die Realität ist nüchterner; und die Ausstellung versteht sich als konstruktiver Kontrapunkt zum neoliberalen Architekturgeschehen, welches in einen gewaltigen Gestaltungs-Dilettantismus ausufert. An den Beispielen des neuen Kleinstaates Montenegro, der kosovarischen Hauptstadt Pristina (deren Einwohnerzahl sich mit 800 000 seit 1991 mehr als verdoppelte) oder der albanischen Hauptstadt Tirana wird der sogenannte Turbo-Urbanismus anhand von Grafiken, Fotos und Plänen erklärt und dokumentiert. Eine Baukultur ohne Regelwerk und die Abwesenheit einer staatlich-planenden Vernunft führen zu völliger Nichtbeachtung von sozial ausgewogener und ökonomisch notwendiger Infrastruktur. Bauherren, die mit profitversprechenden Billigbauten von der Wohnungsnot profitieren, und Investoren, die für schnelle Renditen bauliche Scheusslichkeiten erstellen, scheinen sich gegenseitig zu euphorisieren.
Doch nun greifen kritische Architekten und Planer zunehmend zur Selbsthilfe. Die Initiative «Archis Interventions» in Pristina sieht ihre Aufgabe in planerischen Handlungskonzepten an der Schnittstelle von Plan- und Marktwirtschaft. Hier stellt sich die Frage, ob diese Situation jener des 19. Jahrhunderts nicht ähnelt, als in der Zeit des Übergangs vom merkantil-monarchistischen zum industriell-republikanischen Europa die Städte explodierten und die soziale Frage einen Kernpunkt der entstehenden Disziplin des Städtebaus bildete. Nur ist dieses Kapitel der Urbanisierung wissenschaftlich kaum untersucht, da die Moderne in ihrem blinden Fortschrittsglauben alles immer nur für ein Problem der Zukunft hielt. In den städtebaulichen und architektonischen Krisengebieten des ehemaligen Jugoslawien wird nun aber die Gegenwart plötzlich mit der Vergangenheit konfrontiert. Da man sich dieser nie stellte, meint man noch immer alles neu erfinden zu müssen. Ein Beispiel dafür, dass die Fächer Architekturgeschichte und Urbanistik an europäischen Hochschulen in modernistischer Verblendung seit Jahrzehnten ihre Hausaufgaben ungenügend machen. Und für die städtebaulichen Probleme und architektonischen Kuriositäten kann man auf dem Balkan – anders als in Lagos, São Paulo oder Mexiko-Stadt – nicht den europäischen Kolonialismus und Imperialismus verantwortlich machen. Denn das Geschehen liegt nur einen Steinwurf von Venedig oder Graz entfernt vor unserer Haustüre.
[ Bis 28. Dezember. Katalogheft: Balkanology. Hrsg. Schweizerisches Architekturmuseum Basel und Kai Vöckler. Christian-Merian-Verlag, Basel 2008. 87 S., Fr. 19.–. ]
Öffnung, Ordnung, Dialog
Der Umbau des Kunstmuseums Basel von Gigon/Guyer
Als 1936 die Öffentliche Kunstsammlung Basel ihren Neubau am St.-Alban-Graben bezog, standen die politischen Zeichen auf Sturm. Auch der Konflikt zwischen Moderne und Tradition, den die Kulturgeschichte bis heute dramatisiert, konnte an einer Stadt kaum vorbeigehen, die den wertkonservativen Kunsthistoriker Jacob Burckhardt ebenso hervorbrachte wie den marxistischen Architekten und Bauhaus-Direktor Hannes Meyer. Der Bau, den letztlich der Basler Architekt Rudolf Christ zusammen mit seinem Stuttgarter Kollegen Paul Bonatz realisierte, ist ein massiver Steinkörper mit italienisch anmutender Eingangsarkade, der sich um zwei offene Höfe legt. Die Erschliessung ist weitläufig, und die Ausstellungssäle haben eine lineare Raumdisposition. Die Böden sind aus hellgelben bis graublauem Kalkstein und das Parkett aus versiegelter Eiche. Hier wie bei den Hoftüren und Panoramafenstern in Rahmen aus Baubronze arbeiteten die Architekten bewusst mit der Solidität und Qualität des Materials. Tradition und Moderne waren keine Antagonismen, sondern Faktoren zeittypischer Formgebung.
Als die Mäzenin Maja Oeri 1999 dem Kunstmuseum das palastartige, 1926 errichtete Nachbarhaus schenkte, bedeutete dies für das Museum einen Flächengewinn von rund 2000 Quadratmetern. Den Wettbewerb für Umstrukturierung und Zusammenführung der beiden Häuser gewann 2001 das Zürcher Büro Gigon/Guyer. Der etappierte, rund 18 Millionen Franken teure Eingriff begann 2004 und konnte jetzt abgeschlossen werden. Im «Laurenz-Bau» (der ehemaligen Nationalbank) sind nun Verwaltung und Direktion des Museums, das Kunsthistorische Seminar der Universität und die öffentliche Kunstbibliothek untergebracht, wobei sich die unterirdischen Tresorräume mit ihren 1000 Quadratmetern als Magazin (für Bücher und Bestände der grafischen Sammlung) geradezu anboten. Der frei gewordene Platz im Stammhaus konnte für neue Arbeitsräume des Kupferstichkabinetts (bisher im Untergeschoss oder beengt mit der Bibliothek verbunden), für eine erweiterte Ausstellungsfläche von 760 Quadratmetern in Zwischengeschoss und Parterre, für eine Buchhandlung und für ein Café-Restaurant zur Verfügung gestellt werden.
Der Eingriff von Gigon/Guyer steht im Zeichen von Öffnung, Ordnung, Dialog und ist im konstruktiven Sinn denkmalpflegerisch. Das Zwischengeschoss um den hinteren Innenhof wurde als Rundgang erschlossen und für die Sammlung geöffnet. Hier zeigt man Werke von Picasso, Rouault und Jawlensky aus der Sammlung «Im Obersteg». Der analoge Raum im Parterre, der bisher als Café und als Erschliessung des universitären Bereichs diente, ist zu einem Ort für die Minimal Art mit Werken von Nauman, Judd und Stella geworden. Angrenzend befindet sich neu auch der Bookshop. Die meisten Möbel sind prototypische Entwürfe, wobei der Kassenkorpus in dunkelbraun lackierter Buche gehalten ist, während die Bibliothekseinbauten im Laurenzbau aus schwarz gestrichener Akazie bestehen.
Das Parterre des rechten Eingangsflügels wurde völlig umgebaut. Die Räume der ehemaligen Bibliothek sind zu einer mäandrierenden Enfilade von vier Ausstellungssälen geworden. Zur Eröffnung zeigt man hier Werke von Judd, Warhol, Rauschenberg, Johns und Twombly, von Claes Oldenburg, Lichtenstein und Ryman, von Stella, Richard Artschwager, Gerhard Richter, Richard Prince, Thomas Ruff und Jeff Wall. Die kleinen Fenster im ehemaligen Bibliothekskorridor hat man zu bodenlangen, mit Baubronze gefassten Fenstertüren vergrössert. Der schlanke Raum wurde zu einem Restaurant, das sich grosszügig zum Eingangshof öffnet und Pariser Bistro-Flair verströmt. Hier entstand auch ein neuer Strasseneingang. Die Bar im Entrée nimmt mit einer Messingverkleidung bewussten Materialbezug zum Altbau.
Im Eingangssaal des Museums wird die Philosophie des Eingriffs augenscheinlich. Der Raum wurde bis auf das kubische, dunkle Kassenmöbel und ein Sofa leer geräumt. Die Decke erhielt schlanke Neonröhren, die sich zu minimalistischen Lichtrastern addieren. Und die eleganten Pfeiler an den Schmalseiten stehen mit ihren rosafarbenen Kalksteinplatten vor hausinternen Verbindungsbrücken, wie man diese von Schiffen kennt. Diese Modernität hatte das Haus schon bei der Eröffnung 1936.
Baukünstlerische Fundsachen
Eine Ausstellung im Schweizerischen Architekturmuseum Basel
Ihre erste Ausstellung im Schweizerischen Architekturmuseum nennt Francesca Ferguson «Unaufgeräumt». Ziel der Schau ist es, eine neue Ästhetik des Unvollendeten und Provisorischen zu definieren.
Projekte von 16 Architektur- und Landschaftsarchitekturbüros aus Deutschland, Grossbritannien, Österreich, Polen, Spanien und der Schweiz stehen im Mittelpunkt der gegenwärtigen Ausstellung im Schweizerischen Architekturmuseum (SAM) in Basel. Sie stammen aus den letzten vier Jahren, sind teilweise bereits realisiert worden, befinden sich teilweise aber auch erst in Planung oder Ausführung. Die Gestalter veränderten mit ihren Interventionen Industrieareale, Wohnbrachen, Verkehrsbauten, alternative und etablierte Kulturforen, historische Herrschaftsarchitektur, landwirtschaftliche Nutzbauten und Freizeitlandschaften.
Bilder und Gedankenfragmente
Die diskursive Vielfalt, die Fergusons Debattier- Zyklus «Free Zone» (NZZ 6. 2. 07) auszeichnete, wird nun im Medium der Ausstellung mit Fotos, schriftlichen Angaben, Zeichnungen, Modellen oder O-Ton-Einspielungen aus einzelnen Werkprozessen zu einer unstrukturierten Addition von Bild-, Raum- und Akustik-Bausteinen. In Form von Collagen an den Wänden und räumlichen Inszenierungen auf Lagerkisten unterschiedlicher Grösse betont die Schau mit ihrer «gefundenen Unaufgeräumtheit» all das, was man anhand der Bauprojekte zeigen will. Und, wo diese gar nicht so «gefunden» oder «unaufgeräumt» aussehen, wird der thematische Rahmen mit gestalterischen Mitteln erzeugt. Etwa so, wie wenn man Schaufensterpuppen die Füsse abschraubt, weil die Hose, die man zeigen will, sonst zu kurz wäre.
Durch die Präsentationscollage, die Nutzungs- und Dimensionsvielfalt der architektonischen Projekte und die Ambition des Ausstellungstitels stimmt einfach alles oder auch gar nichts. Die Organik, die jeder Bauprozess hat (vom Nutzungsbedürfnis über Typologie und Ort bis hin zu Projekt, Planung und Ausführung) wird grandios ignoriert und phantasievoll arrangiert: ein Sampling von Bildern und Gedankenfragmenten. Und mit strenger Antiautorität wird auch jedes Beispiel einer Konstruktion der Zukunft zu einer Dekonstruktion der Gegenwart gemacht. Dies geschieht nicht ohne Komik.
In Ramsen zum Beispiel wurde eine landwirtschaftliche Miniatur-Stallung, die ohne Dach und Fenster, mit angebröckeltem Mauerwerk und tiefen Fassadenrissen auf der grünen Wiese stand, für 25 000 Euro wieder zum Leben erweckt. Dies mit einem sorgfältig geschreinerten Holzkubus, den ein Kran mit einer Präzisionsmontage von oben in die Ruine einsetzte. Denn statt die baufällige Konstruktion abzubrechen, entschied sich das Architekturbüro Fischer Naumann aus Stuttgart für eine Art Denkmalschutz für dieses marginale Baufragment in der Landschaft. In Südwestspanien, der kaum industrialisierten Landschaft nahe der portugiesischen Grenze, wo es noch Herden freilebender Wildpferde gibt, haben Andrès Jaque Architectos aus Madrid ein herrschaftliches, aus dem Spätmittelalter stammendes und im 19. Jahrhundert erweitertes Wohnhaus zu einer Altersresidenz für katholische Priester umgebaut. Aber die in hellem Rosa, Blau und Grün eingefärbten Gläser der neuen Fenster oder die rollbaren Freizeitliegen mit portablen Sitzkissen im Foyer des Hauses lassen eher an ein temporäres Architektur-Arrangement für einen Film von Pedro Almodóvar oder Luis Buñuel, vielleicht sogar an die Dekoration einer Weekend-Party von Paris Hilton denken. Schwer vorstellbar, dass eine kirchennahe Institution einer derart kurzatmigen Freizeitgestaltung zustimmte; und doch muss man eine solche wohl als Bauherrin des 4,8 Millionen Franken teuren Altersheims für Geistliche vermuten. Im Kontext der Ausstellung fragt man sich aber auch, wo hier die «Ästhetik des Unvollendeten und des Provisoriums neu definiert» wird. - In Polen wird es etwas konkreter. Im oberschlesischen Steinkohlenrevier in Bytom (in der Nähe Krakaus) haben die Architekten Przemo Lukasik / Medusa Group aus Gliwice eine aufgeständerte Baracke für 64 000 Franken mit einer angeschobenen Treppenkonstruktion neu erschlossen und für eine Nutzung als Kulturzentrum, Bar und Freizeitraum total saniert. Eine ähnliche Baumassnahme realisierten Index Architekten aus Frankfurt im Main-Osthafen für 1,35 Millionen Franken. Sie setzten ein zweigeschossiges, auskragendes Kultur- und Freizeithaus auf einen ehemaligen Bunker und erschlossen den «Hochbau» mit einer angeschobenen Metalltreppe, die formschön, praktisch und nutzungsgerecht wirkt. Isa Sturm und Urs Wolf aus Zürich werden gemäss Ausstellungs-Leporello bis Ende 2008 in St. Gallen für rund 13,2 Millionen Franken die 1911 vollendete Lokremise von Karl Moser mit drei Raum- Einbauten zu einem der Freizeitnutzung dienenden «Kulturaggregat» umgestalten. Ihr minimalistisches und materialrohes Raumkonzept entstand nach einer intensiven Befragung von künftigen Nutzern, die über Lautsprecher zu hören ist.
Karger und luxuriöser Minimalismus
Aufschlussreich ist die Ausstellung durch die Öffnung des Blicks auf insgesamt sechs Länder Europas. Denn die Ästhetik des Elementaren, der Begriff des Minimalen oder die Situation des Mangels durchläuft bei Projekten, die maximal 1500 Kilometer auseinanderliegen, verschiedene nationale Wirtschaftsräume mit beträchtlichem Einkommensgefälle. Was die Schau im Kern zeigen will, funktioniert bei Beispielen aus Polen oder allenfalls noch bei solchen aus Liverpool und Berlin. Beim Priesterheim in Südspanien oder beim Lokremisen-Kulturprojekt in der Ostschweiz stösst diese Art des architektonischen Minimalismus an ihre Grenzen. Baukosten von 13 Millionen Franken für eine minimalistische Intervention müssen Menschen in Osteuropa wohl als seltsamen Luxus empfinden.
[ Bis 27. Mai. Zur Ausstellung ist ein Plakat-Leporello mit allen Projekten und den wichtigsten Daten erschienen. ]
Ménage-à-trois
Das Designerpaar Charles und Ray Eames in einer Ausstellung im Vitra-Museum in Weil am Rhein
Das Designerpaar Charles und Ray Eames lebte und arbeitete 38 Jahre zusammen. Seine Kreationen werden seit 50 Jahren von Vitra produziert. Eine Ausstellung in Zaha Hadids Feuerwehrhaus in Weil am Rhein beleuchtet nun diese aussergewöhnliche Ménage-à-trois.
Im Feuerwehrhaus von Zaha Hadid trifft man derzeit auf eine zeltartige Konstruktion. Dieser «Kiosk», wie ihn seine Entwerfer Charles und Ray Eames nannten, entstand für die Produktpräsentation der Firma IBM auf der Weltausstellung 1964 in New York. Er steht auf feingliedrigen Holzpfosten, hat ein kreisförmiges, textiles Dach und zeigt Einflüsse von Jahrmarkt-Buden des 19. Jahrhunderts. Mehrere dieser Kioske hatten die Eameses auf der Weltausstellung am Hudson unter einen grossen synthetischen Raumkörper gestellt, der auch ein Auditorium enthielt. In diesem «Riesen-Ei» präsentierte der Büromaschinen- und Computerproduzent IBM mit Filmen und Bildern seine Vision der digitalen Zukunft. In der Ausstellung «Die Möbel von Charles & Ray Eames - Produkte, Prozesse, Prototypen» im Vitra-Feuerwehrhaus in Weil am Rhein erinnert ausserdem ein Video an diese Geburtsstunde der elektronischen Kommunikation. Darum herum wird das Werk der Eameses gezeigt, deren kreative Lebensgemeinschaft das Zusammenspiel von «Kunst und Leben» in exemplarischer Weise veranschaulicht.
Eames-Jubiläum
Die Schau in Weil am Rhein hat zwei Anlässe. Am 17. Juni könnte der 1907 in St. Louis, Missouri, geborene Charles Eames seinen 100. Geburtstag feiern. Gleichzeitig blickt die Firma Vitra, deren Gründer Willi Fehlbaum 1957 mit der Produktion von Stühlen und Sesseln des Designer- und Architektenpaares in Europa begann, auf 50 Jahre Eames-Vermittlung zurück. Valérie Braidi-Ketter hat als verantwortliche Kuratorin der Ausstellung den zweiteiligen Grundriss von Hadids Feuerwehrhaus für das Konzept dieser Schau aufgenommen. Im Osten des verglasten Hauses werden alle heute von Vitra produzierten Eames-Produkte und der dreidimensionale Nachlass der Eameses gezeigt. Im westlichen Teil, wo früher die Garderoben und Aufenthaltsräume der Feuerwehrleute waren, visualisiert man ausschnitthaft das gestalterische Universum des aussergewöhnlichen Paares, welches Möbel entwarf, auf dem Gebiet der Grafik und des Films («Powers of ten», 1968) tätig war, nützliche Raumskulpturen («Musical Tower», um 1960) konzipierte und immer wieder Kinderspielzeug (mit dem Elefanten im Zentrum) schuf. Nachdem die als Bernice Alexandra Kaiser in Sacramento geborene und bei Hans Hofmann in New York zur Malerin ausgebildete Ray Eames 1988 - zehn Jahre nach ihrem Mann Charles - gestorben war, erwarb Rolf Fehlbaum den räumlichen Eames-Nachlass (der schriftliche Teil ging an die Library of Congress in Washington). Dieser Ankauf löste Planungen des in Venice lebenden Architekten Frank O. Gehry für das Vitra-Werkgelände in Weil am Rhein aus, die 1989 zum ersten Gehry-Bau in Europa führten: dem Vitra Design Museum.
Mit gewinnender politischer Unkorrektheit sprach Rolf Fehlbaum bei der Ausstellungseröffnung von der kreativen Recherche der Eameses als ästhetischem Darwinismus im Sinne eines «survival of the fittest». Man kennt Fehlbaum als Design-Unternehmer und engagierten Bauherrn. Aber der Vitra-Chairman, der mit einer Arbeit über den Frühsozialisten Henri de Saint-Simon (der den Begriff «Avantgarde» in die westliche Geistesgeschichte einführte) an der Universität Basel promoviert wurde, verbindet sein Marketing mit profunder Kenntnis der modernen Soziologie, ihren humanen Inhalten und deren Umsetzung in Gestaltung und Produktion. Die Ausstellung zeigt sowohl den Prozess der Formentwicklung als auch den ebenso prozesshaften Weg des Prototyps zur seriellen Produktion.
Immer wieder und über Jahre hinweg optimierte der autodidaktische Entwerfer, Konstrukteur und Architekt Charles Eames die Details für die industrielle Fertigung seiner Prototypen. Der visuelle Vergleich der Entwicklungsmodelle mit den verkaufsfertigen Produkten in der Ausstellung macht anschaulich, wie vereinfachte technische Lösungen die Form im Sinne der Nutzung und des Komforts positiv beeinflussten. Parallel dazu konnte die industrielle Produktion einfacher, linearer, materialgerechter und schöner werden. Erwartungsgemäss stehen mit dem «Lounge Chair», der «Ottomane» (produziert ab 1957) und dem «Alu Chair» (produziert ab 1959) die grossen Eames-Entwürfe in allen Varianten und Farben im Zentrum der Schau, obwohl Hierarchien bewusst vermieden werden und die chronologische Didaktik der Ausstellung nie aufdringlich wirkt.
Im Hinblick auf das Eames-Jubiläum ging der «La Fonda Chair» von 1961 neu in Produktion. Dieser wird nun selbstverständlich auch in der Schau gezeigt. Mit einer Neu-Edition des in den Grössen- und Auflagen-Varianten von Möbel und Kleinskulptur hergestellten «Plywood Elephant» (1945) wird an die Kinderliebe von Charles und Ray Eames erinnert. Ab 1941 lebten die Eameses in Südkalifornien. In Pacific Palisades bauten sie 1949 für sich und ihren Nachwuchs inmitten von Eukalyptusbäumen ein zauberhaftes Zuhause. Es entstand ein Gebäude von elementarer Materialität aus einfachen (und kostengünstigen) industriellen Bauprodukten. Der Bau am Pazifik, der heute zu den Meilensteinen der modernen Architekturgeschichte zählt, ist in der Ausstellung im Modell 1:50 zu sehen.
Kreative Zusammenarbeit
Es ist der «Trial and Error»-Prozess im Zusammenwirken mit der modernen Materialentwicklung, der sowohl der Eames-Produktion als auch der Ausstellung das Gerüst und die Spannung gibt. Die kreative Zusammenarbeit belegt ab 1940 mit Prototypen, die zunächst aus Holz, dann aus Draht, Stahlrohr, Synthetik- und Aluminiumguss gefertigt wurden, neben der Design- auch ein Stück Technikgeschichte. All dies sieht man den Produkten nicht an, wenn sie heute an den besten Geschäftslagen präsentiert werden. In Hadids Feuerwehrhaus kann man nun aber den Blick in eine Werkstatt werfen, über der Karl Valentins Bonmot «Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit» leitmotivisch zu schweben scheint.
[ Die Ausstellung in Zaha Hadids Feuerwehrhaus auf dem geschlossenen Vitra-Werkgelände in Weil am Rhein ist bis zum 26. August im Rahmen von Führungen täglich um 11 und 16 Uhr zugänglich. Die Begleitpublikation erscheint im Mai (Euro 39.90). ]
Design fürs Leben
Die ideale Wohnung im Vitra Design Museum in Weil am Rhein
Der Traum vom schönen Wohnen prägte das 20. Jahrhundert. Unter dem Titel «Die Zerstörung der Gemütlichkeit?» zeigt nun das Vitra Design Museum in Weil am Rhein die Entwicklung von Wohn- visionen am Beispiel von sechzehn legendären Wohn- und Design-Ausstellungen.
Im Jahre 1895 wurde in Leipzig erstmals eine Mustermesse durchgeführt - ein neuer Messetyp, den die boomende Industrie des späten 19. Jahrhunderts zur Warenschau ihrer Produktepalette benötigte und der 1917 mit der Mustermesse Basel auch in der Schweiz Einzug hielt. Die Wirtschaft interessierte sich für Ästhetik, und beide waren Teil der lebensreformerischen Bewegung um 1900 und ihres pädagogischen Impulses: der Veränderung des menschlichen Bewusstseins durch das Phänomen des Bauens und Wohnens. Der «industrialisierte» Mensch sollte durch seine im Alltag gebrauchten Textilien, seine Möbel, sein Besteck, Geschirr und Glas oder seine Lichtkörper zu einem gewandelten, bewussteren und gesünderen Umgang mit sich selbst und seiner sozialen Umwelt erzogen werden. Die Kunst sollte von nun an ins Leben kommen.
Inszenierte Wohnfragmente
Als man 1901 in Darmstadt unter dem Titel «Ein Dokument deutscher Kunst» die heute legendäre Mathildenhöhe eröffnete, gab es das Medium Radio noch nicht, das Telefon war noch eine Rarität, und in den Städten war die Elektrifizierung der Strassenbeleuchtung im Gang. Aber schon damals wurden industriell, halbindustriell oder noch immer handwerklich produzierte Alltags- und Haushaltgegenstände unter dem Dach der Architektur vereint und wurde nach einem ästhetischen Nenner gesucht. Die Architekten Joseph Maria Olbrich und Peter Behrens hatten dort neun elegante Einfamilienhäuser gebaut, dazu ein grosses Gemeinschaftshaus mit Turm, Künstlerhaus genannt, und andere Baulichkeiten mehr. Den Stil benannte man nach der in München erscheinenden Zeitschrift «Die Jugend». Und der «Jugendstil» in Architektur und in sogenannt formschön gestalteten Industrieprodukten (welche man später als «Design» bezeichnen sollte) wurde bis zur ersten grossen Katastrophe des 20. Jahrhunderts, dem Ersten Weltkrieg, in Darmstadt und Wien, in St. Petersburg und Brüssel, in Paris, Nancy und Edinburg, in Budapest, Prag und Helsinki, aber auch in St. Gallen, Zürich, Bern und Basel, in Genf, La Chaux-de-Fonds und Lausanne zum Dernier Cri.
Die visuelle Geschichte dieser Entwicklung von industrieller Formgebung und Mode am Beispiel des Sitzmöbels und der Lampe erzählt nun eine Ausstellung im Vitra Design Museum in Weil am Rhein. Unter dem Titel «Die Zerstörung der Gemütlichkeit?» hat man aus der beträchtlichen Zahl von Wohn- und Design-Ausstellungen im 20. Jahrhundert sechzehn ausgewählt, die zwischen 1901 und 1993 in Westeuropa und Nordamerika zu sehen waren. Im Museumsbau von Frank Gehry hat Jochen Eisenbrand nicht die Ereignisse rekonstruiert, sondern Fragmente inszeniert: Zu sehen sind historische Fotos und Dokumente, Kunstobjekte und - die Ausstellung dominierend - Stühle, Liegen, Sessel und Lampen aus der hauseigenen Sammlung. Ergänzt werden sie um bedeutende Leihgaben wie den Speisezimmerstuhl aus Peter Behrens' Haus auf der Mathildenhöhe (1900/01). Die Reise durch neun Jahrzehnte führt von Darmstadt nach Wien, Stuttgart, Paris und New York, nach Detroit, Basel («Die gute Form», 1949) und Chicago, nach Leverkusen, nach Mailand, Düsseldorf, Frankfurt am Main und nach Berlin. Etwa die Hälfte der gezeigten Ausstellungen zum vorbildlichen Wohnen fand bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges, der Rest seither statt.
Die vier Säle des Design-Museums wurden von Gehry einst zwar eigens für die Vitra-Stuhl- Sammlung konzipiert. Doch sie zeigen auch bei dieser Schau ihre Qualitäten. Auf einer rhythmischen Ausstellungsarchitektur aus Boden- und Wandpodesten, auf vertikal oder treppenförmig gereihten Konsolen, die wie Minimal-Plastiken von Donald Judd den Präsentationsraum bis in oberste Zonen der expressiven Architektur erweitern, sind die Stühle, Sessel, Wandmöbel und Kunstobjekte von Peter Behrens, Josef Hoffmann, Marcel Breuer und Ludwig Mies van der Rohe, von Verner Panton, Joe Colombo, Ettore Sottsass und Florence Knoll, von Charles Eames, Eero Saarinen, Alvar Aalto und Jasper Morrison, von Philippe Starck, Ron Arad und Cesare Casati in Form eines anarchisch wirkenden, aber sorgfältig komponierten Setzkastens auf die Wände und Böden verteilt. In Zwischenzonen gibt es kleinere räumliche Arrangements mit Tischen und Lampen wie den kaum bekannten Leuchten von Adolf Meyer und Poul Henningsen, die 1927 in Stuttgart bei der Eröffnung der Weissenhofsiedlung in der Ausstellung «Die Wohnung» gezeigt wurden. Die elektronische Welt hatte in den späten sechziger Jahren mit den anlässlich der Kölner Möbelmesse auf einem umgebauten Schiff veranstalteten «Visiona»-Ausstellungen (1968 bis 1970) ihren Auftritt in der Design-Vermittlung. Und entsprechend den damaligen - von der Pop- Art inspirierten - Wohnlandschaften kann man sich dazu in Weil am Rhein Filmclips im Liegen auf hängenden Monitoren anschauen.
Kunst und Alltag
Vier wichtige Ausstellungen aus neuerer Zeit - «Italy, The New Domestic Landscape» (1972 im MoMa in New York), «Gefühlscollagen: Wohnen von Sinnen» (1986 im Kunstmuseum Düsseldorf), «Some New Items for the Home» (1988 in der DAAD-Galerie in Berlin) und «Droog Design» (1993 auf der Möbelmesse Mailand) - bilden den chronologischen Abschluss der Weiler Schau. Die Sitz- und Wohngeräte aus Kunststoff, Metall, Holz und Beton wirken verspielt, streng und provokant. Das Ziel ihrer anthropologischen Nutzung umkreisen sie zwischen völliger Loslösung und fokussierter Annäherung. Dazu passt das zum Auftakt der Ausstellung am Museumseingang gezeigte Dokumentationsvideo «Kleine Ereignisse» von Roman Signer: Auf einer sattgrünen Bergwiese in Zuoz im Oberengadin hatte der Appenzeller Explosionsvirtuose 1996 alte Polstermöbel als Kinobestuhlung arrangiert und den Zuschauern des Happenings lärmschützende Helme verpasst. Ausstellungsbesucher aus Beirut oder Bagdad könnten Signers Kunst für eine CNN-Übertragung aus ihrer gegenwärtigen Lebenswelt halten. - So hatten sich die Lebensreformer um das Jahr 1900 die Verbindung von Kunst und Leben nicht vorgestellt.
[ Bis 28. Mai im Vitra Design Museum in Weil am Rhein. Die Begleitbroschüre kostet Euro 4.50. ]
Swiss made
Diskussionsmarathon im Schweizerischen Architekturmuseum Basel
Ende letzten Jahres übernahm die Ausstellungsmacherin Francesca Ferguson die Leitung des Schweizerischen Architekturmuseums Basel. Nun versucht das Haus erst einmal mit einem Diskussionsmarathon Besucher anzulocken.
«Free Zone» nennt Francesca Ferguson, die neue Direktorin des Schweizerischen Architekturmuseums (SAM), ihr erstes in Basel realisiertes Projekt. Diese «Freizone», die 25 Veranstaltungen mit über 100 Teilnehmenden umfasst, stellt mit Podiumsdiskussionen und Performances während eines Monats eine Art Open House dar. Architekten, Journalisten, Ausstellungsmacher und Architekturlehrer aus der Schweiz, aus Deutschland, Italien, den Niederlanden, Dänemark und Portugal diskutieren in diesen Wochen vor zahlendem Publikum ein breites Themenspektrum. Ferguson hat dazu im hintersten Saal eine «Reading Zone» mit einer opulenten Auswahl von Architektur- und Designzeitschriften eingerichtet und erstmals den grossen Saal mit den von Peter Märkli beim Umbau neu angebrachten Faltläden ganz geschlossen. Der nun fensterlose Raum hat als Versammlungssaal zum Auftakt des Veranstaltungsreigens überzeugend bestanden.
Globalisierer und Stadtreparierer
Beim Eröffnungsabend «Szene Basel», der zusammen mit «Architektur-Dialoge Basel» bestritten wurde, sprach Carl Fingerhuth über die Situation in Basel zu Beginn seiner Tätigkeit als Stadtbaumeister vor dreissig Jahren. Der heutige Hochschuldozent tat dies mit der Klarheit eines Historikers und skizzierte - wohl unbewusst - gleichsam die gegenwärtigen Zustände. Auf der einen Seite standen damals, laut Fingerhuth, die unbeirrbaren Modernisten, die auf den Trümmern von 1945 das Nachkriegseuropa errichtet hatten. Sie stellten die Zukunft über alles, verachteten die historisch gewachsene Stadt und setzten das Prinzip «Stadt» rücksichtslos gegen das Prinzip «Landschaft». Auf der anderen Seite waren die «Rossianer», die ausgehend von Aldo Rossis Buch «L'architettura della città» (1966) die Geschichte der Stadt ins kollektive Bewusstsein zurückbringen wollten. Zentral sei ihnen der Begriff des Ortes (der Handlung, der Planung, der Konstruktion) gewesen, der eine nahezu magische Aura bekommen habe.
Damit setzte Fingerhut die inhaltlichen Koordinaten, zwischen denen sich «Free Zone» bisher abspielte und weiter abspielen dürfte. Denn im Rausch der Gegenwart haben die Fraktionen nur das verbale Kostüm gewechselt. Aus den Modernisten sind die Globalisierer, aus den Rossianern die Stadtreparierer geworden. Die Internationalität, die vor hundert Jahren mit Begriffen wie Freiheit, Solidarität, Kollektivität und Gesundheit, mit sozialem Wohnungsbau, menschenwürdigem Wohnen, Freizeit und Bildung verbunden war, ersetzt das 21. Jahrhundert durch die Worte Kommunikation, Vernetzung, Lifestyle und Urbanität, durch metropolitanen Drang und das omnipräsente Präfix Mega. Naturgemäss spiegelt der Begriffswandel nur die neue gesellschaftliche Situation der Baukultur. Dabei operieren die Globalisierer wie einst die Modernisierer mit diffusen Zukunfts- und Planbarkeitsbegriffen und streben eine Homogenisierbarkeit menschlicher Gesellschaften an - mit Folgen für das kollektive Gesamtkunstwerk der Stadt.
Dieses Konfliktpotenzial wurde schon am zweiten Abend von «Free Zone» greifbar, der unter dem Titel «08/15 Städtebau - Diskussion zur Stadt der Gegenwart» ein hochkarätiges Podium von Dozenten der ETH-Zürich und der TU-Karlsruhe versammelte. Unter der Leitung des Wirtschafts- und Sozialhistorikers Angelus Eisinger atmete das Statement des Soziologen Christian Schmid (der für die Städtebaustudie des ETH-Studios Basel von 2005 den Text verfasste) zwischen Uno-Statistik und dem proklamierten «Recht auf Stadt» die Unbekümmertheit einer frühmorgendlichen Radiomoderation. Und Alex Wall, Dozent an der Technischen Universität Karlsruhe, unterstrich seine Political Correctness bei der Betrachtung des Phänomens Auto und gab sich dabei als Spezialist für den Bau von Parkhäusern zu erkennen. Marc Angélil und Kees Christiaanse, Architekten und ETH-Dozenten, versuchten sympathisch - und keinesfalls ungeschickt - beiden Positionen gerecht zu werden. Und Vittorio Magnago Lampugnani, der für die «gewöhnliche Stadt» plädierte und das globalisierte Wortgeklimper mit stoischer Ruhe über sich ergehen liess, scheint die Praxis recht zu geben. Denn als wissenschaftlicher Berater der Internationalen Bauausstellung Berlin (1980-84) hatte er sich einst für die kritische Rekonstruktion der Stadt eingesetzt. Ein Konzept, das Hans Stimmann nach dem Fall der Mauer als Senatsbaudirektor vertieft weiterführte.
Ausgesprochen lustvoll wurde dann der «Heimatabend». Roderick Hönig, Redaktor der Zeitschrift «Hochparterre», präsentierte eine Bilderschau mit 80 Dias, die Schweizer Bauwerke aus den letzten zwei Jahrtausenden (vom Amphitheater in Avenches über die Kathedrale in Lausanne, das Goetheanum in Dornach, das Kirchner- Museum in Davos und die Kapelle Sogn Benedetg bei Disentis bis hin zur Bahnhofspasserelle in Basel) zeigten. Daraus mussten die Podiumsteilnehmer ihr Bild der «Heimat» auswählen. Sandra Giraudi (Lugano) und Andrea Bassi (Genf) begründeten daraufhin ihre Wahl des Gotthard-Südportals von Rino Tami, Patrick Gartmann (Chur) jene des Landwasserviadukts im Albulatal von Müller & Zeerleder und Pius Tschumi (Zürich) jene der Autobahntankstelle bei Burgdorf von Heinz Isler vor dem Publikum sachlich und auch ein wenig sentimental, aber bar jeder Provinzialität. Hier wurde der Architekturdiskurs ethisch und im besten Sinne bodenständig.
Bunte Grellheit
Ein inhaltliches Konzept Francesca Fergusons ist bei der bunten Grellheit von «Free Zone» nicht zu erkennen. Aber in den Bereichen Animation, Integration und diskursive Vielfalt kann die zuvor in Berlin als Initiatorin von «Urban Drift» tätige Engländerin in Basel bereits eine erfreuliche Tatkraft vorweisen. Und ihr Bemühen um internationale Zusammenarbeit soll im Spätherbst mit einer Ausstellung über den portugiesischen Architekten Pancho Guedes greifbar werden, die in Zusammenarbeit mit der Fundaçao Serralves in Porto entsteht und dort anschliessend gezeigt wird. Doch zuvor werden die Ausstellungen «Unaufgeräumt / As Found» (17. März bis 17. Mai) und «Instant Urbanism» (10. Juni bis 16. September) über die Bühne gehen. Fergusons unbeschwerter Aufbruchsgeist dürfte aber spätestens dann auf dem Prüfstand stehen, wenn es um die Finanzen geht. Bleibt zu hoffen, dass das immer noch mit privaten, durch Gönner und Mitglieder aufgebrachten Mitteln finanzierte Haus in Zukunft auch auf die öffentliche Hand zählen kann.
[ «Free Zone / Freizone» dauert noch bis zum 24. Februar. Unter www.sam-basel.org findet man das kommentierte Programm. ]
Gegensätzliches in Harmonie
Neubauten von Peter Märkli und Sanaa in Basel
Auf dem Novartis-Campus in Basel realisieren führende Architekten wichtige Neubauten. Nun werden die neusten Gebäude von Sanaa und Peter Märkli in einer Basler Ausstellung präsentiert.
Der Eingangsbereich des Novartis-Campus in Basel ist nahezu fertiggestellt. Im vergangenen Jahr bezog man mit dem «Forum 3» von Diener & Diener das erste Haus der neuen Firmenstadt. Auf derselben Gebäudeachse (mit gleicher Höhe und Tiefe) wird gerade ein Verwaltungshaus des Tokioter Architekturbüros Sanaa von Kazuyo Sejima und Ryue Nishizawa vollendet. Parallel zum Sanaa-Bau und zeitgleich mit diesem entstand an der Fabrikstrasse das «Visitors Center» des Zürcher Architekten Peter Märkli. Die Fabrikstrasse beginnt an der Voltastrasse (und der neuen Stadtautobahn), führt zwischen den Bauten von Sanaa und Diener & Diener, die eine Art Portal bilden, hindurch, quert als wichtigste Erschliessungsachse den gesamten Campus und endet an der Grenze zu Frankreich mit einer grossen Stahlplastik von Richard Serra. Vor der nahezu 170 Meter breiten Glasfront, welche die beiden Häuser von Diener & Diener und Sanaa gemeinsam aufspannen, sollen bis zum kommenden Spätsommer noch ein Eingangspavillon und ein von Vogt Landschaftsarchitekten gestalteter Park über der neuen Tiefgarage entstehen. Dieses halböffentliche Areal verlängert den öffentlichen Grünraum der Voltamatte nach Nordosten und wird, wenn die bisherigen Silobauten am Hafen St. Johann einst abgerissen sind, bis zum Rhein reichen.
Präsentation im Architekturmuseum
So weit ist es noch nicht. Aber mit den Bauten von Märkli und Sanaa beginnt der Masterplan des Zürcher ETH-Professors Vittorio Magnago Lampugnani Gestalt anzunehmen. Das Schweizerische Architekturmuseum (SAM) in Basel nutzt die Fertigstellung der Bauten von Märkli und Sanaa zu einer Ausstellung. Mit grossen Modellen des Masterplans (1:500), der Situation der beiden Neubauten (je 1:250) und der Raumskulptur des Sanaa-Hauses (1:50) werden Volumetrien und Räume anschaulich gemacht. In Vitrinen präsentiert man Märklis Entwurfsskizzen und - mit Stein, Holz oder dem Metallprofil der Fassade - die hauptsächlichen Materialien seines Hauses. Ferner ist ein Aluminium-Sandguss zu sehen. Er veranschaulicht die piranesische Geländerkonstruktion, die in allen Stockwerken von Märklis Neubau skulpturale Akzente setzt. Weiter sind Beispiele der Gebäudebeschriftungen des Trios Natalie Bringolf, Kristin Irion und Irene Vögeli in Aluminium, Palladium und Blattgold ausgestellt. In der Totale wird das Haus mit Fotografien von Paolo Rosseli visualisiert, die man auch in der Begleitpublikation findet.
Vom Neubau des Büros Sanaa, der in diesen Wochen fertiggestellt wird (eine Baumonographie ist in Vorbereitung), werden neben dem Modell auch Pläne sowie erste fotografische Bilder von Walter Niedermayr präsentiert, die das gläserne Bauwerk zwar als Baustelle, aber bereits mit der linearen Transparenz seiner Fassaden und der Lichthaltigkeit seiner Innenräume zeigen.
Kunstvolle Präzision
Das Haus von Peter Märkli ist - je nach Standpunkt - eine Zumutung und ein Brillant. Es ist bald üppig und kostbar, bald opulent, banal oder von verschwenderischem Geiz. Von aussen wirkt es zunächst wie der Dutzendbau eines Verwaltungssitzes. Im Innern wähnt man sich zunächst in einem venezianischen Palazzo, dann in einer Bündner Arvenstube. Dazwischen ahnt man die Kasino-Atmosphäre von Las Vegas. Märkli veranstaltet eine Material-Travestie mit der artistischen Präzision eines Hochseilaktes, die Überraschung und Wohlgefühl auslöst, die virtuos spielt, scheinbar Unvereinbares kombiniert und eine Harmonie des Gegensätzlichen erzeugt. Stadt und Land, Salon und Bauernstube, Barock und Futurismus, Intimität und Weite, Distanz und Nähe scheinen sich in Märklis Raum- und Materialkontinuum zu vereinen. Über dem in makellos weissem Carraramarmor und der kühlen Eleganz eines Palast-Entrées gehaltenen Parterre erheben sich fünf Geschosse um einen Lichthof. Alle Decken sind aus furnierter Eibe, die so geschnitten, geschliffen und kassettiert ist, dass jede Rustikalität verlorengeht und sich die Wirkung von Ebenholz oder Mahagoni einstellt. Gleiches gilt für das Auditorium des Untergeschosses mit seinen 124 Eames-Lobby-Chairs.
In den Obergeschossen kommt zur Holzdecke ein Wandtäfer an den zwei Erschliessungskernen. Auf dem Boden der sonst völlig verglasten Büroebenen liegt ein tiefblauer Teppichboden. Die Brüstungen zum Lichthof und die Marmortreppen sind mit Geländerstützen aus porösem Aluminiumguss und einem Handlauf mit Olivenholzfurnier versehen. Die kleinteilige Maserung der Eibe und das gestische Linienspiel des geschnittenen Olivenholzes geben der sachlich-coolen Ambiance einen expressiven Charakter, dem die grob wirkende Oberfläche des Aluminiumgusses das Flair einer Edelbaustelle hinzufügt.
Hier spürt man auch das Las-Vegas-Feeling des neuen Visitors Center. Märkli schöpft ohne Berührungsängste aus dem Material- und Formenfundus, den Bauindustrie und Architekturgeschichte bieten. Damit pflegt er einen Manierismus, den die Moderne als Todsünde stigmatisierte. Wenn man diesen Material- und Formenmix nach ausschliesslich funktional-ökonomischen Kriterien in die Dreidimensionalität überführt, entsteht Kitsch. Wenn man ihn aber so planerisch exakt und mit virtuoser Handwerklichkeit einsetzt wie Märkli, wird er Kunst. So muss man schliesslich auch die Fassade lesen, die mit 22 Metern Höhe und 5700 Quadratmetern Fläche zunächst einen simplen Verwaltungsbau vermuten lässt. Doch die champagnerfarbene Haut der vorfabrizierten Aluminiumteile ordnet sich präzise dem architektonischen Entwurf unter.
Transparenz
Der Neubau von Sanaa ist nur durch die Lage und die Gemeinsamkeiten in Höhe und Nutzung mit Märklis Gebäude vergleichbar. Hier geht es nicht um die Repräsentation eines weltweit tätigen Unternehmens, sondern um die Transparenz, Helligkeit und Freundlichkeit eines Bürohauses. Die Architekten aus Tokio haben den 80 Meter langen und 20 Meter tiefen Baukörper, der über sechs Geschosse in 22 Meter Höhe führt, mit einem Lichthof ausgehöhlt. Alle Aussenwände sind aus Glas, die Geschossdecken so dünn, dass sie von aussen kaum sichtbar sind und ein durchgehendes Raumkontinuum suggerieren. Treppen und Geländer sind weiss lackierte, einfache Metallkonstruktionen, die an ein Schiffsdeck erinnern. Jeder Gang in den Geschossen ist mit dem Blick zum Aussenraum verbunden. In wenigen Wochen soll der Lichthof des Sanaa-Baues zu einem von Vogt Landschaftsarchitekten konzipierten bepflanzten Wasserbecken werden.
Und am Haupteingang haben Sanaa jene sechs Meter hohe Fussgängerarkade geschaffen, die Lampugnanis Masterplan vorschreibt und die, durch eine Gasse getrennt, nahtlos in jene des Visitors Center von Peter Märkli übergeht. Und Märklis Arkade hat auf der Strassenseite ein monumentales Schrift-Display von Jenny Holzer. Wenn man will, erinnert auch dessen pausenlos laufende Botschaft an Las Vegas.
[ Ausstellung im SAM bis 26. November. Begleitpublikation: Novartis-Campus. Peter Märkli. Hrsg. Ulrike Jehle. Christoph- Merian-Verlag, Basel 2006. 79 S., Fr. 49.-. Zum Neubau von Sanaa ist eine Monographie in Vorbereitung. ]
Künstler und Pädagoge
Christian Kerez im Schweizerischen Architekturmuseum Basel
Spätestens seit der grossen Ausstellung, mit welcher Herzog & de Meuron das von ihnen erbaute Münchensteiner Schaulager im Jahr 2004 eröffneten, scheint die Zunft der Architekten Gefallen an der Inszenierung ihrer Kreativität zu finden. Jedes Styroporklötzchen wird mittlerweile von den Baukünstlern in fast schon beängstigender Vollständigkeit ausgebreitet. Auch der Architekt und Architekturfotograf Christian Kerez versucht in einer Ausstellung des Schweizerischen Architekturmuseums in Basel seine Kreativität zu inszenieren. Er tut dies nicht mit der grossen Geste, sondern mit ruhiger, sachlicher, beharrlicher und erfrischender Präzision. Aber wie Jacques Herzog hat auch er einen Hang zur Pädagogik. Im Eingangssaal wird auf einem Riesentisch das gestalterische Laboratorium von Kerez mittels Modellen ausgebreitet - ähnlich wie unlängst bei seiner Schau in Lausanne.
Der Tisch ist so gross und raumgreifend, dass nur ein schmaler Gang in die weiteren Ausstellungsräume bleibt. Merke: Nur über die Mühsal des Probierens, der Unzufriedenheit, der Wiederholung, der Verdichtung und des handwerklichen Fleisses entsteht die Form. Und da Kerez nicht allein auf das computergestützte Entwerfen vertraut, wird dieser Weg in Plastiken aus Metall, Karton, Styropor, Plexiglas oder Gips auch anschaulich. Die pädagogische Übung zeigt, wie bei Kerez Raumerkundung und Raumfindung deshalb einen skulpturalen Charakter haben, weil jeder Schritt zwischen Miniatur und Grossform in sich vollendet ist. Dies im Gegensatz zu Computer-Entwürfen, wo dieser Prozess auf flache und jederzeit manipulierbare Perspektivansichten reduziert wird.
Christian Kerez, der 1962 geboren und an der ETH zum Architekten ausgebildet wurde, gründete 1994 sein Büro in Zürich, machte sich aber auch als Architekturfotograf einen Namen. Als Mitarbeiter von Rudolf Fontana (Domat/Ems) nahm man ihn bei der Kapelle in Oberrealta (1994) erstmals als Baumeister wahr. Mit zwei Werken in Zürich (Mehrfamilienhaus Forsterstrasse, 2002/03) und im sankt-gallischen Eschenbach (Schulhaus, 1999-2002) wurde er schlagartig bekannt. Die Ausstellung in Basel zeigt - neben den Modellen - das Haus in Zürich in einer (als eine Art Katalog-Ersatz produzierten) Postkartenserie sowie ein 1:10-Styropormodell des mit einem Architekturpreis geehrten und mit Artikeln überhäuften Erstlings. Daneben finden sich grosse Modelle für Architekturen, die gerade im Bau sind: ein Schulhaus in Zürich Leutschenbach und ein Zweifamilienhaus in Witikon.
Das Modell des Hauses Forsterstrasse, auf seine nackte Struktur reduziert, hat etwas ähnlich Profan-Unheimliches wie die Polyurethan-Plastik «Casa metafisica e di speculazione» (1984/85) von Fischli/Weiss, und mit ihrer Leere wirken beide austauschbar. Bei dieser Anlehnung an die Plastik der Gegenwartskunst achtet Kerez streng auf euklidische Geometrien. Das statische Konstruktionsprinzip, welches in der filigranen Metallstruktur des Schulhauses Leutschenbach sichtbar wird, lässt an die konstruktive Plastik der zwanziger Jahre denken. Jedoch weist es über das reine Kunstprodukt hinaus, da das Tragwerk zum Prinzip der Plastik wird. Beim Schulhaus in Leutschenbach mit der originellen Turnhalle im obersten Geschoss finden sich konstruktive Parallelen zum Sportzentrum Pfaffenholz in St. Louis (1995) von Herzog & de Meuron oder zur doppelstöckigen «Brücke der Nordtangente» von Steib & Steib in Basel (2005). Das Modell des neuen Hauses in Witikon ist aus MDF-Platten geschreinert und hat einen Beton-Feinguss als Aufsatz. Allein der Holzsockel unterstreicht Anspruch und Wirkung dieser Raumplastik, die man sich ebenso gut in der angrenzenden Kunsthalle ausgestellt denken könnte.
Kerez hat beide Plastiken auf entgegenlaufenden Achsen des grossen Museumssaales placiert und ihnen statt musealer Ruhe (was durchaus möglich gewesen wäre) eine sanfte Enge aufgezwungen. Ein neues Modell und Pläne eines unrealisierten Wettbewerbsprojektes in Zürich (Berufsschule Salzmagazin, 1997) runden die Ausstellung ab. Von kleinen Fotografien auf den Tischvitrinen abgesehen, hält Kerez seine Werkpräsentation auf konsequent entwerferischem Niveau. Ein paar jener farbigen Postkarten, die man dem Besucher nun zum Kauf im Kartonschuber anbietet, hätten der Ausstellung als grossformatige Bilder gut getan. Als strenger Lehrer verfolgt Christian Kerez die Nüchternheit bis zum Nullpunkt. Dort, wo die Ausstellung pädagogisch wirkt, hat sie einen Zug zur Bevormundung. Dort, wo sie Kunstwerke zeigt, ist sie eindrücklich.
[ Bis 20. August. Zur Ausstellung liegen eine 13-teilige Postkartenserie (Fr. 18.-) sowie die Lausanner Broschüre «Les Echelles de la Réalité. L'Architecture de Christian Kerez» (Fr. 21.-) vor. ]
Bewegung und Tanz
Ausstellung Zaha Hadid im Architekturmuseum Basel
Den geplanten Neubau des Basler Stadtkasinos nach Plänen von Zaha Hadid nimmt das Architekturmuseum Basel zum Anlass für die Präsentation der bisher umfangreichsten Schau der Architektin in der Schweiz. Neben dem Projekt für den Barfüsserplatz werden auch Bauten in Cincinnati, Kopenhagen und Leipzig vorgestellt.
Spätestens seit vor fünf Jahren die von Herzog & de Meuron umgebaute Tate Modern in London mit einem rekordverdächtigen Mediengewitter eröffnet wurde, hat man sich in Basel daran gewöhnt, dass nicht nur der Fussballklub, sondern auch die Spitzenarchitekten der Stadt in der Champions-League mitspielen. Deshalb wohl registrierte man, als im vergangenen Dezember Zaha Hadid den Wettbewerb für ein neues Basler Stadtkasino gewann, den Sieg der Architektin aus London im Sinne eines Fairplay. Da Hadid das überzeugendste Projekt präsentierte, konnte sie als Frau neben der urbanistisch-ästhetisch interessierten Öffentlichkeit auch die lokalpolitisch starke Linke sowie das feministische Lager für sich einnehmen. Dies obwohl sie und ihr Projekt des neuen Basler Stadtkasinos deutlich machen, dass auch motorisierter Verkehr, Extravaganz und Starallüren zu den weiblichen Lebenswelten gehören.
Von Basel bis Guangzhou
Die veranschlagten Kosten für das neue Stadtkasino sind mit 100 Millionen Franken für ein Haus der Kultur beachtlich und wurden in jüngster Zeit nur selten übertroffen: etwa von der Tate Modern in London, von Jean Nouvels KKL in Luzern oder von Rafael Moneos «Kursaal» in San Sebastián. Vierzig Prozent der Baukosten, so der Plan der privatrechtlichen Gruppenbauherrschaft, sollen das Stadtparlament und - nach dem erwarteten Referendum - die Stimmbürger aus der Staatskasse genehmigen. Auf diesen zentralen Punkt der Baugenese im kommenden Spätsommer zielt die Arbeit der bisher sensiblen und professionellen Projektleitung von Cyrill Häring. In diesem Kontext öffnet nun Ulrike Jehle das Architekturmuseum für die Ausstellung «Zaha Hadid Architecture - Projects and Built Work». Es ist die bisher umfangreichste Schau der Architektin in der Schweiz.
Das Projekt des neuen Stadtkasinos Basel bildet mit einem sehenswerten Video aus Dokumentaraufnahmen, die von einer virtuellen Kamerafahrt durch den existierenden Stadtraum und das künftige Haus überlagert werden, wie auch mit Modellen und Plänen nur ein Zentrum der vom Büro in London konzipierten und gestalteten Schau. Das kurz vor der Fertigstellung stehende Science-Center in Wolfsburg, der gerade vollendete Anbau an das Ordrupgaard-Museum bei Kopenhagen, die unlängst eingeweihte neue BMW-Zentrale in Leipzig, das 2003 bezogene Rosenthal Center for Contemporary Art in Cincinnati sind wie das projektierte Opernhaus im chinesischen Guangzhou ein substanzieller Teil des Rundgangs. Der klar und reichhaltig präsentierten Ausstellung hätte etwas weniger Designer-Purismus gut getan. Ein geübtes Auge findet sich zurecht; doch viele Exponate dieser Schau, die Information und Meinungsbildung eines breiteren Publikums anstreben will, sind mit minimalen Bildbeschriftungen nur schwer verständlich. - Aufschlussreich sind insbesondere die dokumentarischen Fotografien, denn die Häuser in Cincinnati, Kopenhagen, Leipzig und Wolfsburg sind Grossarchitekturen, von denen Hadids zeichnerische Visionen schon in den achtziger Jahren kündeten und die sich bei Bauminiaturen wie dem Vitra-Feuerwehrhaus oder dem Länder-Pavillon in Weil am Rhein nur erahnen liessen. Licht, Schatten, Bewegung, räumliche Offenheit und Tanz scheinen begriffliche Koordinaten für Aussen- und Innenform von Hadids Architekturen: bei der Autofabrik in Leipzig ebenso wie bei den Kulturbauten. Immer wieder kann man Bezüge zum Basler Projekt entdecken. So hat das Science-Center in Wolfsburg ein ähnlich auskragendes Dach über dem Haupteingang wie das Kasino.
Verschönerung der Stadt
Vielleicht gibt es sogar einen Zusammenhang zwischen Zaha Hadid und der neuen Vorschrift für die Bestuhlung von Basels Boulevardrestaurants. Der Staat will nämlich zur architektonischen Aufwertung des öffentlichen Raumes ein Verbot von Plasticstühlen durchsetzen und diese durch Sitzmöbel aus Metall ersetzen. Allein vor dem heutigen Stadtkasino (das für den Hadid- Bau abgerissen werden soll) stehen 350 Plasticsessel. Die Innenarchitektur der heutigen Stadtkasino-Lokale prägt eine eklektizistische Erlebniswelt zwischen Skihütte und amerikanischem Middle-West-Charme. Im neuen Basler Stadtkasino, das man im September 2009 beziehen will, werden solche Geschmacklosigkeiten kaum mehr möglich sein. Und eines ist sicher: Zaha Hadid hasst Plasticstühle.
[ Bis 13. November im Architekturmuseum Basel. ]
Die Fassade als Aquarell
Roger Dieners faszinierendes Tor zum Novartis-Campus in Basel
Am westlichen Rheinufer in Basel Nord realisiert der Chemieriese Novartis einen Forschungscampus. Als erster Neubau konnte nun das Verwaltungshaus von Diener & Diener vollendet werden, dessen von Helmut Federle gestaltete Glashülle fast schon sakral wirkt. Diesem Meisterwerk widmet das Architekturmuseum eine sehenswerte Schau.
Das Ende liegt im Dunkeln. Warum die Menschen im Jahr 50 v. Chr. einen Ort verliessen, den die Archäologen als «eine der ersten grossen stadtähnlichen Siedlungen nördlich der Alpen» bezeichnen, bleibt ein Rätsel. Rund 30 Kilometer östlich der namenlosen Keltenstadt am Oberrhein gründeten die Römer 44 v. Chr. Augusta Raurica. Damals begann auch die Geschichte Basels. Mehr als 1800 Jahre später wurde vor den gerade geschliffenen Mauern im Westen der Stadt das Firmengelände des Chemieunternehmens Sandoz bebaut. Als man 1911 neben der Sandoz eine Gasfabrik realisieren wollte, stiess man auf die 2000 Jahre alte Keltenstadt, dank der man die Stadtchronologie um rund 100 Jahre vordatieren konnte.
1996 fusionierte der Sandoz-Konzern auf der linken Rheinseite mit der rechtsrheinischen Ciba zum Chemiegiganten Novartis. Zwei Jahre zuvor hatte man mit dem Bau der Nordtangente begonnen. Diese 3,18 Kilometer lange Stadtautobahn ist die - unterirdisch geführte - Verbindung zwischen den französischen und deutschen Schnellstrassen. Während der Planungszeit wurde das Bauwerk nicht zuletzt deshalb zu einem Politikum, weil viele Basler in ihm ein «urbanistisch- zerstörerisches, typisch kapitalistisches» Unternehmen sahen. Gewiss, das urbanistische Megaprojekt der Basler Nordtangente kann man als «typisch kapitalistisch» bezeichnen. Aber es ist alles andere als «urbanistisch-zerstörerisch». Obwohl die unterirdische Stadtautobahn erst in zwei Jahren ganz vollendet sein wird, ist sie schon jetzt eine Wohltat für die Stadt. Die Quartiere, die wegen des Durchgangsverkehrs zu verkommen drohten, blühen plötzlich auf. Kleine Park- und Grünanlagen werden gerade eingerichtet, Alleen gepflanzt.
Ein Campus am Volta-Boulevard
Der rechtsrheinische Teil der Nordtangente wurde mit der neuen, doppelstöckigen Rheinbrücke im vergangenen Jahr fertiggestellt und beschäftigt gerade die Landschaftsplaner. Auf der linken Seite des Rheins herrscht hingegen noch städtebauliche Gründerzeit. Hier stehen öffentlichrechtliches Projektieren und Bauen mit privatwirtschaftlicher Zukunftsplanung im Dialog. Die Voltastrasse, wie die oberirdische Fahrspur der Nordtangente hier heisst, wird von der kantonalen Strassenplanung bis ins Jahr 2009 in einen repräsentativen Boulevard verwandelt, der im Chaos der heutigen Baustelle nur erahnbar ist. Am Ende der insgesamt 1,7 Kilometer langen Strassenachse liegt der Bahnhof St. Johann. Zwei kreisrunde Plätze (Lothringerplatz und Vogesenplatz) sind in Planung, wobei der Wettbewerb für den Vogesenplatz im September entschieden wird. Für das grosse Novartis-Grundstück nördlich der Voltastrasse am Rhein gab Daniel Vasella 2001 bei Vittorio Lampugnani den Masterplan für eine Life-Sciences-City in Auftrag.
Der Professor für Städtebaugeschichte an der ETH Zürich legte ein Grundrissgitter über die bisherige Firmenstadt, in der die Architektur lange Zeit nach pragmatischem Bedarf und im luftigen Gewand des Zeitgeistes realisiert wurde. Lampugnanis Masterplan beruft sich auf altgriechische Vorbilder in Kleinasien (insbesondere Milet), Sizilien und Kalabrien. Dieses antike Strassenraster mit leicht lesbarem orthogonalem Grundriss, einladenden Strassenräumen und normierten Gebäudehöhen erlebte seine letzte Blüte im Europa des 19. Jahrhunderts, als man die noch mittelalterlich geprägten Städte öffnete und grosszügig erweiterte.
Den Architekten, die nun einzelne Bauten in der neuen, additiven Firmenstadt des Novartis- Campus realisieren werden, wird vom Plan eine Arkade im Parterre (zumindest an den Hauptachsen) zur Vorschrift gemacht - allerdings nicht im Stil der Zähringerstädte Bern und Thun, sondern nach dem Vorbild von Turin und Bologna. Der Mailänder Lampugnani importiert hier eine norditalienische Urbanität an den Oberrhein, wie sie Aldo Rossi mit seinen Wohnbauten in Gallatarese (1969-73) in die jüngere Architekturgeschichte einschrieb. - Den Auftakt des Novartis-Campus macht nun das meisterhafte Forum-3-Gebäude des international tätigen Basler Architekturbüros Diener & Diener - ein schlanker Gebäuderiegel, der eine Art Novartis-Visitenkarte an der Voltastrasse werden könnte. Als dessen Pendant (auf der anderen Seite der Fabrikstrasse) soll bald eine analoge Kubatur des japanischen Architektenduos Sanaa (Kazuyo Sejima und Ryue Nishizawa) entstehen. Roger Diener, so scheint es, wurde bei der Planung von seinem im Herbst in die Realisierungsphase gehenden Projekt eines Anbaus für die Galleria Nazionale d'Arte Moderna in Rom atmosphärisch inspiriert. Der fünfgeschossige Verwaltungs- und Repräsentationsbau des Chemiemultis hat seine Arkade auf der Seite des campusinternen Platzes in Form einer eleganten stützenfreien Auskragung in der ganzen Gebäudelänge von 85 Metern. Wenn die archäologische Bodenforschung beendet ist, soll der Platz mit Wasserbecken und Birkenwäldchen gestaltet werden.
Der schwebende, fast immaterielle Ausdruck, den das neue Haus ausstrahlt, entsteht durch eine hochkomplexe Glasfassade, die der Schweizer Maler Helmut Federle mit dem österreichischen Architekten Gerold Wiederin entwarf und installierte. In der Fernsicht und bei klarem Sommerhimmel ist das Fassadenbild eine strenge, aber sinnliche geometrische Abstraktion. Im diffusen Licht eines spätherbstlichen Tages werden die Farbfelder, die sich häufig überlappen und dann Mischtöne erzeugen, wohl an Aquarelle Paul Klees aus den späten Bauhaus-Jahren erinnern. Die Aussenfassade besteht aus 1200 asymmetrisch an vertikalen Stangen montierten Glastafeln, die in 21 Farben und mit 25 Formaten eine Fläche von 4300 Quadratmetern bedecken. Aufgeklappt würde das Glaswerk zu einem Monumentalformat von 22 Metern Höhe und 214 Metern Breite. Damit dürfte sich nun das grösste Kunstwerk der Schweiz in Basel befinden. - Die insgesamt fünf Geschossebenen des Neubaus haben Diener & Diener wie bei einem Sandwich aufeinander gelegt und an zwei Erschliessungskerne gehängt. Hinter der Gebäudehülle befinden sich balkonartige Laubengänge, die das Fassadenbild für die Angestellten zur begehbaren Plastik machen. An der südlichen Stirnseite haben Vogt Landschaftsarchitekten über vier Geschosse einen urwaldartigen Wintergarten mit grossen Ficus- Bäumen und Blütenpflanzen aus Thailand angeschoben. Eine oval-geschwungene, skulpturale Nussbaumtreppe verbindet die vier Büroebenen des Hauses, die von Sevil Peach aus London als Arbeitslandschaft des «telematischen» Zeitalters gestaltet wurden. Büromöbel von Charles und Ray Eames haben es der Designerin besonders angetan. Auch sonst hat Novartis bei diesem Vorzeigebau in Sachen Materialien und Ausstattung nicht gespart. Schwarzer griechischer Marmor bedeckt den Boden des vier Meter hohen Eingangsbereichs. Die «Pausenkantine» erweist sich als eine Art Lounge mit wenig bekannten Rietveld- Ledersesseln von zeitloser Eleganz. Zur platzseitigen Arkade hin kann das Parterre durch bodenlange Schiebetüren geöffnet und so nach aussen vergrössert werden.
Eine Ausstellung
Das Architekturmuseum Basel nutzt den baulichen Auftakt des Novartis-Campus, der im kommenden Jahr schon wieder mit zwei neuen Häusern (von Peter Märkli aus Zürich und Adolf Krischanitz aus Wien) aufwarten wird, zu einer ebenso sinnlichen wie informativen Ausstellung. In den vier Sälen des spätklassizistischen Hauses am Steinenberg präsentieren Ulrike Jehle und Isabel Halene ein Gesamtmodell des Campus sowie Pläne, Fotos, Modelle und Baumaterialien des Neubaus von Diener & Diener. Ein Computer- Terminal und ein Büchertisch machen mit Bauten des Basler Büros in Berlin, Paris, Amsterdam, Biel und Luzern bekannt. Linearität, Klarheit, Verständlichkeit und Sorgfalt - die abstrakten begrifflichen Koordinaten der Architektur von Diener & Diener - werden hier anschaulich sichtbar. Das Ende der alten Basler Keltenstadt mag im Dunkel liegen. Der stolze Anfang des neuen Campus (www.novartis.ch), der am gleichen Ort entsteht, ist nicht mehr zu übersehen.
[ Bis 14. August im Architekturmuseum Basel. Am 25. Juni findet im Museum die Vernissage zum Ausstellungsbuch «Novartis-Campus - Forum 3. Diener, Federle, Wiederin» statt. An diesem Tag werden auch Gruppenbesuche des Neubaus nach Voranmeldung (am@architekturmuseum.ch) angeboten. ]
Grossstädtisches Ensemble
Das «Elsässertor» von Herzog & de Meuron in Basel
Mit dem «Elsässertor», ihrem neusten Gebäude in der Schweiz, haben Herzog & de Meuron dem Centralbahnhof in Basel eine neue Westflanke verliehen. Dieses Glashaus bildet zusammen mit den Bauten von Richard Meier, Diener & Diener sowie von Cruz & Ortiz und Giraudi & Wettstein ein beeindruckendes städtebauliches Ensemble.
Im Jahre 1929 wurde in Basel durch die Entfernung der letzten Gaslaterne die öffentliche Elektrifizierung abgeschlossen, und man weihte die neue Markthalle am Centralbahnhof von Alfred Goenner und Hans Rhyhiner ein. Mit einem Durchmesser von 60 Metern spannte die elegante Betonkuppel einen stützenfreien Raum auf, der in Europa nur von Konstruktionen in Leipzig und Breslau übertroffen wurde. Baubedarf gab es auch für den Autoverkehr, der so zugenommen hatte, dass die Architekten Emil Baumgartner und Hans Hindermann auf der anderen Strassenseite der Markthalle 1928 die Schlotterbeck-Garage errichteten, die mit einer doppelgängigen Wendelrampe von der zwischen 1922 und 1927 erbauten Fiat-Fabrik «Lingotto» in Turin inspiriert war. Gegenüber der Markthalle lagen die Perrons der Bahnstrecke nach Paris und ein Lagerschuppen.
Städtebauliche Strategie
Als man Ende der achtziger Jahre einen Masterplan für das rund 1,2 Kilometer lange Gelände des schweizerischen und französischen Bahnhofs in Basel vorlegte, präsentierten der Kanton Basel- Stadt und die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) eine städtebauliche Entwicklungsstrategie, die auch die Westflanke des Areals mit Halle und Garage betraf. Die Halle wurde von der Denkmalpflege sorgsam beobachtet und galt als sakrosankt. Die Garage war mit ihrer eigenwilligen Typologie nicht umnutzbar und musste dem ersten Haus des New Yorker Architekten Richard Meier in der Schweiz weichen (1998). Vis-à-vis von Meiers «White Plaza» hatten die Architekten Diener & Diener 1994 ein Schulungs- und Konferenzzentrum einweihen können. Für den unternutzten Teil der französischen Bahnhofsanlage lobten die SBB schon in den achtziger Jahren einen Wettbewerb aus, den Herzog & de Meuron gewannen. Das Projekt blieb lange in der Schublade, doch als man 2001 mit dem Bau der benachbarten Bahnhofspasserelle begann, gab man in Bern auch für die Realisierung des «Elsässertors» grünes Licht. Herzog & de Meuron ergänzen nun mit ihrem soeben vollendeten neusten Schweizer Bau die Westflanke des Bahnhofs mit der kühlen Eleganz eines Glasriegels zu einem imponierenden Architekturquadrat.
Das «Elsässertor» von Herzog & de Meuron ist ein fünfgeschossiger Bau mit dem Grundriss eines langgestreckten, gestauchten und gekappten Pentagons. Die Glasfront im Sockelgeschoss ist zur Strassenseite eingezogen. Die Doppelschichtfassade der Obergeschosse besteht auf der Aussenhaut aus vier parallelen Glasbändern, die im Osten rot, im Westen blau eingefärbt sind und an den Längsseiten im Norden und Süden normales, «weisses» Glas haben: eine gebaute Tricolore als Hommage an die Grande Nation. Das Haus wirkt wie ein eigenwillig geschliffener Kristallspiegel, denn die schlanken, geschosshohen Glastafeln sind in unzähligen Neigungswinkeln montiert. Die Fassade kann variantenreich und vital auf alle Formen des Lichts reagieren. Nachts etwa erscheinen die Leuchtreklamen der Markthalle. Die rund 15 000 Quadratmeter Nutzfläche sind um einen kleinen Innenhof gruppiert. Das Parking in den Untergeschossen umfasst 174 Plätze.
Das Grundstück des «Elsässertors» liegt auf der abgesenkten Ebene der Gleisanlagen und wurde durch die Erschliessung der neuen Kubatur auf das Niveau der Viaduktstrasse angehoben. Das Trottoir hat Boulevardcharakter und wurde vom Zürcher Büro Vogt Landschaftsarchitekten mit einem kleinen Birken- und Robinienwald bepflanzt. Passanten können nun zügig geradeaus oder mäandrierend durch die Baumgruppen gehen. Die Fahrspur zur Markthalle wurde verbreitert, und es entstand ein urbaner Strassenraum. Denn seit 1907, als man den heutigen Bahnhofskomplex bezog, führte der Blick von der Markthalle nach Süden immer auf ein heterogenes Geleisefeld und den Stadtteil Gundeldingen. Dieser wird seit 2003 durch einen grosszügigen Indoor-Flanierweg mit dem Bahnhof, dem Vorplatz und einem direkten Zugang zur Innenstadt verbunden, der in rechtem Winkel vom «Elsässertor» über die Geleise führt. Diese Bahnhofspasserelle des sevillanischen Meisterduos Cruz & Ortiz und des jungen Luganeser Büros Giraudi & Wettstein führt die Glasfront von Herzog & de Meuron in eines der eigenständigsten Stadtviertel weiter. Dieses Quartier ist ein Kind des 19. Jahrhunderts. Es entstand in nur 30 Jahren und hat ein konsequentes, rechtwinkliges Strassennetz, womit es den modernsten Grundriss der Stadt aufweist.
Urbanistisches Patchwork
Am westlichen Ende des Gundeldinger Quartiers stösst die Bahnhofspasserelle in diesen Stadtraum, wo sie mit einer nahezu fensterlosen, sechsgeschossigen Fassade an der Güterstrasse endet. Diese durchzieht als langes Band das ganze Quartier und strukturiert es mit zwei parallelen, gleich langen Strassenachsen. Den Wettbewerb für die beiden Kopfbauten der Passerelle an der Güterstrasse (den «Süd-Park») haben ebenfalls Herzog & de Meuron gewonnen (gegen Bétrix & Consolascio, Burckhardt Partner, Cruz & Ortiz mit Giraudi & Wettstein, Gmür & Vacchini, Ingenhoven Overdiek, Miller & Maranta sowie Morger & Degelo). Sie wollen im Westen der Bahnhofspasserelle einen Büroturm mit 18 Geschossen errichten.
Östlich der Passerelle planen Herzog & de Meuron ein Wohn- und Ladenrechteck mit abgetreppter Geschosszahl zwischen Strassenfront und Geleisefeld. Die projektierte Glasfront dieses Bauwerks, für das bereits die Baueingabe läuft, wird nun von der Stadtbildkommission Basel- Stadt zurückgewiesen, ein Vorgang, der an die städtebauliche Kontroverse im Berlin nach der Wiedervereinigung (1989) erinnert. Die geschlossene Strassenflucht der Güterstrasse weist hier seit 100 Jahren ein rund 300 Meter langes Loch auf, das mit temporären Bahnhofsbauten, Handwerkerateliers und einer Ladenzeile nie über den Status eines zufälligen Patchworks hinauskam. Obwohl es hier um Stadtreparatur geht, gebärdet sich der (im Modell) elegante Baukörper von Herzog & de Meuron als Solitär. Denn er füllt eine Lücke, ohne diese zu schliessen - ein Eindruck, den eine reine Glasfassade logischerweise unterstreicht.
In ein urbanistisches Patchwork franste vor 16 Jahren auch der westliche Zipfel des stadtseitigen Bahnhofareals aus, bevor Diener & Diener hier zu bauen begannen. Ihr Schulungs- und Konferenzzentrum für den Schweizerischen Bankverein (heute UBS) umfasst mit 56 000 Quadratmetern Nutzfläche ein imposantes Volumen, welches die Architekten kammartig mit Längs- und Querriegeln um offene Höfe und einen geschlossenen Innenhof organisierten. Der Betonstruktur wurde ein rotbrauner Klinkerbau aufgemauert, der zur lärmigen Strassenfront nahezu fensterlos ist und sich zu lärmgeschützten Zonen nach Süden und Westen öffnet. Die Hermetik des Gebäudes stiess auf ungewohnt heftige Ablehnung in der Stadt. Dabei darf man es als ein städtebauliches Meisterwerk bezeichnen. Die Ruhe und Souveränität der Architektur von Diener & Diener machte bald darauf den grandiosen Auftritt des New Yorker Architekten Richard Meier auf der anderen Strassenseite und macht nun - auf einer weiteren Strassenseite - die leichte und elegante Architektur des «Elsässertors» von Herzog & de Meuron möglich. Vielleicht ist es im Städtebau wirklich wie beim Eiskunstlauf. Durch die Pflicht von Diener & Diener können Herzog & de Meuron nun eine unbeschwerte Kür laufen. Beides muss man können.
Ästhetik der subversiven Anpassung
Junge Schweizer Baukünstler im Architekturmuseum Basel
An den Schweizer Hochschulen und Fachhochschulen gehörte das Studium der Architektur während der letzten 25 Jahre zu den boomenden Fächern, und die Folgen waren absehbar. Junge Kreativteams, die, kaum selbständig, in diesem Metier wie Shootingstars aus der Masse der Baukünstlerschaft aufleuchteten, wurden entsprechend bewundert. Architektenteams wie Jüngling und Hagmann in Chur, Giraudi und Wettstein in Lugano, Gigon und Guyer in Zürich oder Miller und Maranta in Basel zeigten, dass sie auf frühe Erfolge durchaus die Basis für eine spätere Karriere legen können.
Wenn das Architekturmuseum Basel nun den zweiten Zyklus seiner 1996 gestarteten Reihe «Junge Schweizer Architektur» zeigt, so unternimmt es den verdienstvollen Versuch einer nationalen Blütenlese, auch wenn sich die Verantwortlichen um Ulrike Jehle explizit jeder Wertung enthalten und aus dem Dreieck Lausanne - Zürich - Basel nur drei «Positionen» nebeneinander zeigen wollen. Aber Positionen sind nicht einfach da, sondern ergeben sich aus einem Arbeitskontinuum - und dies heisst Baupraxis. So können sich denn die Häuser, die Bonnard und Woeffray aus Lausanne, Unend aus Zürich und Lost Architekten aus Basel gebaut haben, alle sehen lassen. Das Team aus der Romandie realisierte Schulen in Blonay, Fully und Lausanne, ein Mehrfamilienhaus in St-Maurice, ein Wohn- und Bürohaus in Monthey und ein Einfamilienhaus in Troistorrents. Lost Architekten aus Basel bauten ein Einfamilienhaus in Therwil und Unend aus Zürich eine Werkhalle sowie ein Büro- und Gewerbegebäude in Bülach; Sanierungen, Umbauten, Erweiterungen und Wettbewerbsprojekte runden die Werklisten der drei Architektenteams ab.
Die «Positionen» aller drei Büros scheinen sich in der Haltung zu Grundriss, Fassaden, Erschliessungen, Materialwahl und Raumdisposition zu vereinen. Alle bauen hell mit grossen Fensteröffnungen. Die Struktur der Häuser ist immer linear, der euklidischen Geometrie verpflichtet, sowohl in der Gesamtform als auch in der Organisation. Die Architekten schätzen alle den Sichtbeton und scheuen den kräftigen Einsatz der Farbe nicht. Die Bauaufnahmen (meist Fassaden) zeigen ruhige, selbstbewusste Architekturen von demonstrativer Schlichtheit, die zuweilen elegant wirken. Es fehlen rhetorische Gesten, und es gibt keinen falschen Schein.
Bei Bonnard und Woeffray wird die Arbeit mit Begriffen wie Differenz und Kontrast am augenscheinlichsten. Dies insbesondere bei Konstruktionen, deren Grundstücke nicht freistehend und isoliert von anderen Architekturen sind. In der mehrheitlich bunten Baulandschaft, die um den Genfersee und entlang der Rhone während der letzten 50 Jahre entstand, sind die Häuser integrierte Solitäre, die zwar Morphologien und deren Rhythmen beachten, aber durch eine Verschiebung, durch asynchrone Takte und Noten deren Schwingung beruhigen und so konzentrierter erscheinen lassen. Obwohl die Differenzen minimal wirken, werden die Kontraste im Gesamtblick gross. Es entsteht eine Ästhetik der subversiven Anpassung, die Konfrontation vermeidet und subkutan wirkt.
[ Bis 22. Mai im Architekturmuseum Basel. Zum Schaffen von Bonnard und Woeffray wird gratis ein Leporello abgegeben. ]
Papierindustrielle und Architekten
Die Baugeschichte der St.-Johanns-Vorstadt in Basel
In den letzten 550 Jahren war Basels Stadtbild in stetem Wandel. Ein Blick auf den 1615 von Matthäus Merian d. Ä. publizierten Vogelschauplan verdeutlicht ganz besonders die Veränderungen in der St.-Johanns-Vorstadt. Diese weist heute neben wichtigen klassizistischen Architekturen auch bedeutende zeitgenössische Bauwerke auf.
Als Matthäus Merian d. Ä. im Jahre 1615 seinen Vogelschauplan der Stadt Basel publizierte, stand dort, wo heute in der St.-Johanns-Vorstadt der Hauptgeschäftssitz der Architekten Herzog & de Meuron liegt, eine imposante Kirche. Direkt daneben verlief das linksrheinische Ende der spätmittelalterlichen Stadtmauer. Hier lag an der Ausfallachse nach Mülhausen, Colmar und Strassburg ein Kontrollpunkt der Stadt. Gleichwohl war es hier ruhig, denn der Personen- und Warenverkehr, den das reiche Basel mit dem Sundgau und dem Burgund, mit Besançon, Lyon und Paris pflegte, wurde am Spalentor abgewickelt. Die St.-Johanns-Vorstadt, die sich fast parallel zum sanften Bogen des Rheins erstreckt, hatte beim Erdbeben 1356 Glück gehabt, blieb sie doch zusammen mit dem Hügel des Münsters und wenigen anderen Strassenzügen nahezu unversehrt. Deshalb sind hier Häuser, deren Existenz sich 700 Jahre zurückverfolgen lässt, keine Seltenheit.
Renaissance und Klassizismus
Als Merians Plan erschien, war das ruhige St.- Johanns-Quartier schon länger ein bevorzugtes Wohngebiet mit guter Verkehrsanbindung und direkter Rheinlage. Heinrich Halbysen, den der bürokratische Papierbedarf des Basler Konzils (1431-1449) zum ersten Papierindustriellen der Stadt machte, kaufte sich 1447 das Haus St.- Johanns-Vorstadt 17. Bald sollte hier Johannes Petri eine Druckerei, eine «Officin», eröffnen. Halbysen, ein international denkender Unternehmer, hatte das Know-how für seine Papierproduktion aus der Lombardei importiert. Das weiter rheinaufwärts gelegene Areal hinter dem St.-Alban-Kloster schätzte er als idealen Standort mit optimaler Energieversorgung ein. Hier kaufte oder baute Halbysen an einem Kanalzufluss eine Mühle nach der anderen. Als Gutenberg 1462 in Mainz den Buchdruck mit beweglichen Lettern erfand, waren im Basler St.-Alban-Tal rund zehn Papiermühlen in Betrieb, und das Kloster lag bereits in einem frühneuzeitlichen Industriequartier.
Halbysens Privathaus in der St.-Johanns-Vorstadt erlebte in den folgenden Jahrhunderten eine architekturgeschichtliche Karriere: als Einzelbau, aber auch hinsichtlich seiner Nutzung. 1535 gelangte es in den Besitz von Hans Jacob Loss, der mäzenatisch für die Universität wirkte und einen in Conrad Gessners Buch «Horti Germaniae» erwähnten Garten mit Orangen- und Zitronenbäumen anlegte. Unter Loss erhielt das Haus Fresken, die von Hans Holbein d. J. inspiriert waren. Holbein hatte sich 1528 vis-à-vis ein Haus mit Rheinblick gekauft und es mit Fassadenmalereien dekoriert. Im Jahre 1650 kaufte Margaretha von Erlach das ehemalige Halbysen-Haus, das nun «Erlacher Hof» genannt wurde. Diesem liess sein späterer Besitzer Christian von Mechel 1785 eine klassizistische Fassade vorblenden. Der bauliche Eingriff repräsentierte die Harmonielehre Johann Joachim Winckelmanns, den Mechel in Rom besucht hatte und mit dem er über verlegerische und ästhetische Fragen korrespondierte. Mit diesem Umbau war vier Jahre vor Beginn der Französischen Revolution in Basel ein frühes Beispiel des europäischen Klassizismus entstanden.
Christian Mechel, vom österreichischen Kaiser Joseph II. geadelt, gilt als eine der schillerndsten Figuren der an bedeutenden Personen nicht armen Basler Kulturgeschichte. Dabei war er nicht nur ein Fürstendiener, sondern auch ein erfolgreicher Verleger und druckgraphischer Produzent, der Stiche nach berühmten Gemälden herstellen liess und gut verkaufte. Der Kunsthändler und Sammler nahm auch am Geistesleben seiner Heimatstadt regen Anteil. Zu seinen Briefpartnern gehörte unter anderem Johann Bernoulli, der Astronomie in Berlin lehrte und sich rühmend über die permanente Kunstausstellung äusserte, die von Mechel in der St.-Johanns-Vorstadt eingerichtet hatte. Zu dem Kunstpilgern aus Mittel- und Westeuropa gehörten 1779 auch Herzog Carl August von Weimar und sein Geheimer Rat Johann Wolfgang Goethe.
Moderne zwischen alten Mauern
Parallel zur St.-Johanns-Vorstadt liegt in leichter Hanglage die Hebelstrasse. Hier begann 1705 eine neue Zeit für das Quartier am Rhein. Die Hebelstrasse, in der Herzog & de Meuron 1988 mit ihrem Neubau in einem Hinterhof erstmals international auf sich aufmerksam machten, erhielt vor 300 Jahren ein fürstliches Stadthaus durch Friedrich Magnus, Markgraf von Baden-Durlach. Vom Volumen her musste sich das Palais vor vergleichbaren Häusern in den Residenzstädten Europas nicht verstecken. Aber der dreiflüglige Bau war ornamental bereits so entschlackt, dass er die Bürgerhäuser auf der anderen Strassenseite nicht erdrückte. 1895 wurde zwischen dem «Markgräflerhof» (heute Universitätsklinik) und dem «Erlacher Hof» mit einer Textilfabrik ein dritter Grossbau (von Architekt Rudolf Linder) errichtet. In den dreissiger und vierziger Jahren des 20. Jahrhunderts erhielt das Quartier mit einer neungeschossigen und 180 Meter langen Klinik von Hermann Baur auch noch einen Monumentalbau der modernen Architektur.
Im «Erlacher Hof», dem einstigen Wohnhaus von Heinrich Halbysen und Christian von Mechel, hatte der Architekt Otto Senn 1933 sein Büro eröffnet. Senn, längst ein bedeutender Name der modernen Schweizer Architekturgeschichte, bestimmte seither die Nutzung des Hauses durch Büros und Ateliers. Auf Senns lokale und nationale Bautätigkeit folgten Silvia Gmür und Livio Vacchini, die den beruflichen Fokus auch über die Landesgrenzen lenken und während der letzten 15 Jahre nicht nur Hermann Baurs 1945 bezogenes Kantonsspital äusserst sensibel sanierten, sondern im vergangenen Jahr auch eine neue Frauenklinik an der Spitalstrasse fertigstellten.
Zeitgenössisches Bauen
Zu Beginn des 21. Jahrhunderts nun ist das Gebiet zwischen dem Kantonsspital und dem Rhein zu einer Art personalem Pool für Bauen und Gestaltung geworden. Christian von Mechels frühindustrieller Bildproduktions- und Verlagsbetrieb wurde im frühen 19. Jahrhundert zu einer Seidenfabrik umgenutzt und um ein Fabrikgebäude und einen Verwaltungstrakt erweitert. 1914, kurz vor Beginn des Ersten Weltkrieges, stellte Hans Bernoulli einen schlanken Anbau in den Hof, der den mittelalterlich-barocken «Erlacher Hof» mit einer Eisen-Stahl-Konstruktion an die Moderne anschloss. Im viergeschossigen Fabrikationsgebäude, das jahrelang leer stand und wo hohe und fast stützenfreie Räume wie bei einem Sandwich aufeinander liegen, sind mittlerweile das ETH-Studio Basel und die Architekturausbildung der FHBB (Fachhochschule beider Basel) eingezogen. Der ehemalige Verwaltungsbau des Textilunternehmens wird von Morger & Degelo gerade zum eigenen Firmensitz umgebaut. Und gleich daneben steht das von einer grünen Glasfassade umhüllte Institut für Spitalpharmazie, mit dem Herzog & de Meuron in den späten neunziger Jahren eine innerstädtische Grossplastik realisierten. Im «Erlacher Hof» selbst, der unter dem aufmerksamen Auge der Denkmalpflege in den letzten Jahren von Rainer und Lislott Senn saniert und leicht umgebaut wurde, sind heute sieben Architekturbüros und drei Graphikbetriebe tätig.
Am Ende der St.-Johanns-Vorstadt, wo 1978 Jacques Herzog und Pierre de Meuron als blutjunge Architekten ein Büro eröffneten, plant und koordiniert man derzeit Bauten in Peking und San Francisco, in Japan, Deutschland und Italien. Aber nun wollen Herzog & de Meuron die eigene Haus-Collage, in der sie heute rund 130 Mitarbeiter beschäftigen, mit einem schlanken Glaskubus an der Rheinuferstrasse akzentuieren. Das neue Basler Haus der Architekturstars soll nur ein paar Meter neben der Stadtmauer aus dem 14. und 15. Jahrhundert zu liegen kommen. Als jüngster architektonischer Akzent der St.-Johanns-Vorstadt wird es die bauliche Dynamik der letzten 550 Jahre in diesem Basler Viertel weiter auf Touren halten.
Städtebaulicher Kraftakt im Herzen der Rheinmetropole
Bauen rund um das zentrale Bahnhofareal in Basel
Rund um die Anlage des Zentralbahnhofs wandelt sich Basel rasant. Sind westlich davon repräsentative Neubauten von Diener & Diener sowie von Richard Meier entstanden, so wird im Osten zwischen dem minimalistischen Peter-Merian-Haus von Zwimpfer Partner, dem Lonza-Hochhaus und dem skulpturalen Stellwerk von Herzog & de Meuron das Jacob-Burckhardt-Haus von KBCG und Jakob Steib realisiert.
Im Jahre 1844 wurde die Eisenbahnlinie von Strassburg nach Basel fertiggestellt, und die Schweiz war auf dem Schienenweg erstmals mit dem Ausland verbunden. Die Bauten für die innerschweizerische, neue Verkehrsanbindung (1854) und für die grossherzoglich-badische Bahn (1859), die aus Karlsruhe kam, waren Kopfbahnhöfe. Der Blick auf die Eröffnung des Gotthardtunnels (1882) schuf andere Realitäten. Man schloss die Gleistrassees zusammen, errichtete eine neue Rheinbrücke (1873) und schuf in der Folge architektonische Zeugnisse, die das Bild des Zentralbahnhofs (mit der schweizerischen und der französischen Station) und jenes des Badischen Bahnhofs bis heute prägen. Am Centralbahnplatz entstand ein mächtiger Steinbau von Emil Faesch und Emanuel La Roche (1904-07). An der heutigen Schwarzwaldallee schufen die Architekten Karl Moser und Robert Curjel eine weitläufige Anlage in elegantem Jugendstil (1910-13).
Verdichtung
Um den Zentralbahnhof wuchs die Stadt im 20. Jahrhundert enorm. Im Süden entstanden ausgedehnte Wohngebiete. Entlang der Gleisfelder liessen sich Handwerksbetriebe nieder, und man baute eine grosse Markthalle mit Infrastrukturen für den beginnenden Automobilverkehr. Aber das Gesicht des grossflächigen Areals, das von seiner Randlage immer mehr ins Zentrum des urbanen Gebildes in und um Basel wuchs, war diffus und kleinteilig. Insbesondere die Bautätigkeit der Bahn selbst, die mit unzähligen Remisen, Gleisausbauten und anderen, zeitbedingten Nutzungsänderungen auf dem Gelände agierte, schuf Metastasen ohne Konzentration. Als man 1962 am östlichen Zipfel des Areals das Lonza-Hochhaus bezog, war dies das höchste Gebäude Basels. Zwar hatten sich die Architekten Suter + Suter in der Grundrissdisposition und der Volumetrie der Kubatur so auffällig an Gio Pontis «Grattacielo Pirelli» in Mailand (1956) orientiert, dass man das Haus despektierlich als «Il piccolo Pirelli» bezeichnete. Aber die gestalterische Kraft, die das Haus in Mailand zu einem Meilenstein der Architekturgeschichte werden liess, wirkt auch in der helvetischen Variante eindrücklich.
Seit rund 15 Jahren beginnt sich das ganze Gebiet des Bahnhofs der Schweizerischen Bundesbahnen baulich intensiv zu verdichten. Im Westen Richtung Frankreich errichteten die Architekten Diener & Diener ein grosses Konferenz- und Ausbildungszentrum (1990-94) und Richard Meier ein Geschäftshaus (1995-98). Da sich beide Volumen an einer Strasse gegenüberstehen und die Grundstücke je am Talhang eines linksrheinischen Nebenflusses liegen, sind sie von der Talsohle mit 9 und 11 Geschossen als kleine Hochhäuser lesbar. In Sichtweite dieser beiden Bauten wollen die SBB in diesem Jahr mit dem Bau einer geschlossenen Passerelle über das Gleisfeld nach Plänen von Cruz/Ortiz und Giraudi & Wettstein (Lugano) beginnen.
Im Schatten des Lonza-Hauses
Der östliche Teil des rund 1,2 Kilometer langen Areals verändert sich gegenwärtig städtebaulich stärker als der Westteil. Zunächst bildeten in den achtziger Jahren ein Bürohaus von Diener & Diener und ein neues Fernmeldezentrum von Bürgin & Nissen mit Zwimpfer Partner das unbeachtete - weil nur aus der Luft wahrnehmbare - Dreieck mit dem Lonza-Hochhaus. Durch das SBB-Stellwerk von Herzog & de Meuron (1998/99) wurde dieses zu einem Viereck vergrössert. Es entstand eine urbane Klammer von erstaunlicher Qualität. Für das Areal um das Fernmeldezentrum wurde im Februar 2001 ein städtebaulicher Ideenwettbewerb entschieden, den das junge Büro Miller & Maranta (Basel) gewann. Doch das Herzstück des ganzen Bauplatzes besteht aus zwei Grosskubaturen, von denen die eine gerade fertiggestellt worden ist. Der Baubeginn der anderen soll demnächst erfolgen.
Nach 14-jähriger Planungs- und Bauzeit konnten die Architekten Zwimpfer Partner das Peter-Merian-Haus fertigstellen (1986-2000). Der über 30 Meter hohe, nahezu 60 Meter breite und 180 Meter lange Komplex wird von Firmen als Bürohaus und von einer Fachhochschule als Ausbildungsraum genutzt. In den Innenhöfen, die den Bau präzise gliedern und rhythmisieren, wurde ein umfangreiches «Kunst und Architektur»-Projekt realisiert. Die Fassade springt auf beiden Längsseiten wie ein Kamm leicht zurück. Doch die entstehenden Aussenhöfe wurden so mit einer Glashaut geschlossen, dass sich eine kompakte stereometrische Gesamtform ergibt. Der monumentale Bau wirkt wie eine Plastik der Minimal Art im öffentlichen Raum.
Das Peter-Merian-Haus (benannt nach einer angrenzenden Strasse) macht nun das von Passagierzügen intensiv genutzte Gleisfeld als urbanen Raum erlebbar. Und die Fassade zur Strasse definiert diese Durchgangsachse neu. Durch die Begrünung mit Bäumen wurde dieser Rand der Innenstadt auch ökologisch aufgewertet. Hinter dem im Osten des Peter-Merian-Hauses neu geschaffenen Lindenplatz soll dieses nun auf einer nahezu gleich grossen Fläche mit dem Jacob- Burckhardt-Haus (ebenfalls benannt nach einer angrenzenden Strasse) ergänzt werden. Zwimpfer Partner führte dazu einen Wettbewerb durch, mit dessen Sieger sie den Bau realisieren wollten. Es gewann das Büro von Jakob Steib. Nach einer Firmenumstrukturierung heisst die Arbeitsgemeinschaft nun KBCG (Krarup, Bachelard, Cuendet, Geser; Basel) mit Steib (Zürich).
Das Jacob-Burckhardt-Haus
Das inzwischen eingehend überarbeitete Wettbewerbsprojekt soll eine ähnliche Fassadenmorphologie wie das benachbarte Peter-Merian-Haus erhalten. Es bekommt ein vergleichbares Volumen, hat die gleiche Höhe und rhythmisiert sich ebenfalls durch sechs aneinander gebaute Einheiten, die um Innenhöfe gruppiert werden. Damit der Bau natürlich beleuchtet werden kann, wird es zwischen diesen Elementen wiederum offene Aussenhöfe geben, die man komplett verglast und so die Fassade schliesst. Die neue Grosskubatur unterscheidet sich jedoch vom Nachbarbau auffallend in der inneren Organisation, der Materialsprache der Fassade und einer stärkeren Bezugnahme auf die Topographie. Nach Osten verjüngt sich das Grundstück, und auf der anderen Seite der Strasse befindet sich der parkähnliche Aussenraum des Lonza-Hochhauses. Dieser Grünraum wird in fünf der Baueinheiten in Form eines Bildes einbezogen.
Vom Eingang auf der Bahnseite soll ein Blick durch grosse, durchsichtige Glaspartien in den Wänden der Aussenhöfe in die Tiefe des Gebäudes möglich sein. Die Plaza, die jede Kubatur zentral erschliesst, erhält jetzt keinen vertikalen, hellen Schacht mehr, sondern eine Kaskade, die über sechs der sieben oberirdischen Geschosse ein gebogenes Atrium aufspannt, welches von Süden Licht erhält. Die Haustechnik verlegt man in die Untergeschosse und nicht mehr aufs Dach. Dafür plant man hier Attikageschosse, die Panoramablicke auf die Innenstadt im Norden und die grüne Südstadt möglich machen.
Die Führung neuer Tram- und Bahngeleise machen auch beim Jacob-Burckhardt-Haus eine sanfte Fassadenwelle notwendig. Auf der Strassenseite werden die Wandfelder zwischen den Hofverglasungen die Architektur kompakter wirken lassen. Das letzte Bauelement an der Münchensteinerbrücke muss man klimatisieren, da dieses an der Schnittstelle zweier Verkehrsachsen liegt. Ansonsten sollen wie beim Peter-Merian-Haus alle Räume natürlich belüftet werden können. Im Jahr 2007 wird der Bau vollendet sein und dem diagonal jenseits der Brücke liegenden Stellwerk von Herzog & de Meuron als unmittelbarer Nachbar antworten.
Ein sinnlicher Klassiker
Der Architekt Luis Barragán in Weil am Rhein und Basel
Die Tradition der mexikanischen Kolonialarchitektur mit ihren einfachen, kubischen Formen und die Architektursprache von Le Corbusier und dem Bauhaus prägten Luis Barragán (1902-1988), den bedeutendsten mexikanischen Baukünstler des 20. Jahrhunderts. Seine skulpturalen Häuser zählen heute zu den Glanzlichtern der modernen Architekturgeschichte.
Als der Basler Architekt und ehemalige Direktor des Dessauer Bauhauses, Hannes Meyer, 1939 in Mexiko zu arbeiten begann, hatte Luis Barragán vor drei Jahren eine umfangreiche Bautätigkeit in der Hauptstadt des Landes begonnen. Das Frühwerk des 1902 in Guadalajara geborenen Architekten war zuvor während neun Jahren in seiner Heimatstadt entstanden und lebte ganz aus der Tradition des spanischen Kolonialstils. Barragán baute mit Arkaden und Tonnengewölben, mit Zinnen, Patios, Wasserspielen und unter Einbezug von Natur oder Garten. 1925 war der junge Architekt nach Europa gereist, wo ihn die Exposition des Arts Décoratifs in Paris und die Alhambra in Granada faszinierten. Als er sechs Jahre später erneut Europa besuchte, lernte er Le Corbusier und das Denken des Bauhauses kennen. Beide Einflüsse sollten ihn prägen.
Koloniale und moderne Formen
Seit 1936 realisierte Barragán in wenigen Jahren rund 20 Ein- und Mehrfamilienhäuser in Mexico City und errichtete so dem europäischen Neuen Bauen mit kristallinen Formen und grossen Glaspartien ein Denkmal in Mittelamerika. Dabei musste Barragán im Grunde nur die eigene Tradition weiterentwickeln. Denn die meist flach gedeckte, profane Kolonialarchitektur bestand bereits aus klaren Kuben. Sie kam fast ohne ornamentalen Schmuck aus, verfügte über lineare Erschliessungen und grosse - meist zum Innenhof sich öffnende - Fenster. Es war kein Traditionsbruch notwendig, um auf dieser Basis den Formenfundus des europäischen Funktionalismus anzuwenden. Einen Bruch mit der Geschichte forderte jedoch der Marxist Hannes Meyer. Dies dürfte mit ein Grund dafür gewesen sein, dass Barragán und der Grossmeister der europäischen Moderne keine Kontakte pflegten.
Ab 1940 arbeitete Barragán an Stadtplanungsprojekten und schuf jene Wohnhäuser und Haziendas, die ihn zum wichtigsten Baumeister seines Landes im 20. Jahrhundert und zu einer zentralen Gestalt der internationalen Architekturgeschichte machten. Als er 1980 als zweiter Architekt den damals noch neuen Pritzker Prize erhielt, nahm man dies in Europa kaum zur Kenntnis. Erst seit Barragáns Tod 1988 rückte der Ausnahmekönner in der Alten Welt langsam ins Rampenlicht. Ende 1992 präsentierte das Zürcher Architekturforum einen Einblick in sein Schaffen, und zwei Jahre später gab es eine umfangreiche Retrospektive in Madrid, aus der im folgenden Jahr ein Gesamtverzeichnis der Werke hervorging (das der Birkhäuser-Verlag 1996 auf Deutsch herausbrachte). Nun würdigen das Vitra-Design- Museum in Weil am Rhein und das Basler Architekturmuseum Barragáns Œuvre in einer breit angelegten Doppelausstellung.
Das Design-Museum kann seine Exponate aus der 1996 gegründeten Luis Barragán Foundation in Birsfelden alimentieren, die den Nachlass von Barragán selbst sowie jenen des Photographen Armando Salas Portugal besitzt, der während 40 Jahren mit dem Architekten zusammenarbeitete. Das Architekturmuseum Basel zeigt Bilder des Photographen René Burri, der im Auftrag von «Magnum Press» und namhaften Printmedien Barragáns Werk in den Jahren 1969 bis 1976 umfangreich im Bild dokumentierte.
Wer nicht das Werkverzeichnis Barragáns eingehend konsultiert oder zumindest das filmische Porträt gesehen hat, das parallel zur Ausstellung und als Teil des Gesamtprojektes entstand, wird es mit der Ausstellung im Vitra-Museum schwer haben. Denn die formale Welt Barragáns mit ihren klaren Formen, elementaren Farben und der souveränen Linearität der Konstruktion steht in völligem Gegensatz zur Museumsarchitektur Frank O. Gehrys. Zudem haben die Ausstellungsmacherinnen Federica Zanco und Emilia Tarragni die 740 Quadratmeter des Hauses bis in jeden Winkel genutzt. In grossen, grauen Rahmen aus Holz oder schwarzlackiertem Metall sind die zweidimensionalen Schätze der Stiftung - Pläne, Zeichnungen und Fotos - an den Wänden und auf Podesten opulent ausgebreitet. Dass das Frühwerk und die ersten Jahre in Mexiko City in Weil nicht zur Sprache kommen, mag damit zusammenhängen, dass Barragán dieses Material nicht für archivierungswürdig hielt. Für die Entwicklung des Baukünstlers sind sie dennoch aufschlussreich.
Ausgeblendetes Frühwerk
Die Ausstellung setzt in der Nachkriegszeit mit Barragáns grösstem städtebaulichem Projekt ein: den «Jardines del Pedregal» (1945-50). Auf dem von jahrhundertealten Lavamassen bedeckten Terrain, für das er einen Masterplan, prototypische Häuser und grosse Plätze mit Brunnenanlagen entwarf und realisierte, strebte er eine Symbiose von Architektur und Natur an. Aber obwohl sich der Unternehmersohn Barragán mit beträchtlichen Mitteln an der kommerziellen Erschliessung des Projektes beteiligte, konnte die grosse Mehrheit der Bauherren seiner Ästhetik nicht folgen. Es entstand letztlich ein beliebiger Vorstadtbrei, und von der Vision blieben fast nur historische Photographien übrig.
Mehr Glück hatte Barragán im Norden von Mexico City, wo mit «Las Arboledas» (1958-63) eine Wohnstadt für Pferdebesitzer entstand. Im Zentrum dieser Anlage befindet sich eine gewaltige Tränke in einer Eukalyptusallee, die der Architekt mit euklidischen Mauern, Mauerfragmenten und Farben so einfach und sinnlich rahmte, dass der Ort noch heute ein frühes Beispiel von Land-Art und Minimal Art darstellt. «Las Arboledas» wurde zusammen mit Barragáns Privathaus in Mexico City (1940-48) oder den Stallungen San Cristóbal und der Casa Folke Egerstrom (1967/68) zu den bevorzugten Motiven der Photographen, und diese drei Bauten stehen denn auch im Zentrum der Ausstellung. Aber auch andere wichtige Privathäuser wie die Casa Eduardo Prieto Lopez (1948), die Casa Antonio Gálvez (1955) oder die Casa Francisco Gilardi (1975/76) werden gezeigt, ebenso Kirchen und Plätze, die neben den Villen seine wichtigsten Bautypen waren. - Für die Ausstellung wurde der Gehry-Bau innen und aussen in jenem zarten Mauve, Zitronengelb und Rostrot gestrichen, das Barragán immer wieder verwendete. Wichtiger für die Schau sind allerdings die kleinen Terminals des Ausstellungsdesigners Bruce Mau. Zu sechs Bauten Barragáns kann man hier Fotos abrufen. Der Besucher wird über die Standorte der Kameraobjektive auf dem Grundriss informiert, und so ist eine Art Wanderung durch Aussen- und Innenräume der Häuser möglich. Weit bescheidener, jedoch nicht weniger präzis zeigen die Aufnahmen René Burris im Architekturmuseum Barragáns ästhetische Welt. Sie werden in einer kleinformatigen, äusserst sorgfältigen Publikation dokumentiert. Die Art, wie in seinem eigenen Haus ein Raum in voller Höhe und Breite in Form eines Fensters in den Garten mündet oder wie der Architekt eine Holztreppe ohne Stützen und Geländer ein Stockwerk überwinden lässt, das sind Sternstunden der Baukunst: Barragán schuf hier Typologien, die längst klassisch sind.
[ Die Ausstellung im Vitra-Design-Museum in Weil dauert bis zum 29. Oktober, jene im Architekturmuseum Basel bis zum 13. August. Katalog Fr. 29.-. Im August erscheint zudem eine wissenschaftliche Begleitpublikation zur Ausstellung in Weil. ]
Das Dorf und die Stadt
Zum Tod des Architekten Michael Alder
Er war in seinem Innersten ein Antiurbanist, und dennoch baute er urban: der Baumeister Michael Alder. Ihn interessierte nämlich die gewachsene architektonische Struktur in der kleinen Einheit des Dorfes, ihr sozialer Ausdruck oder ihre topographische und klimatische Richtigkeit. Und Alder blickte auf die kleine Form: auf Türfassungen, auf Fenster und auf Erschliessungen, aber auch auf Praxisnähe und auf die elementaren Bedürfnisse der Benutzer.
Michael Alder, der sich vom Hochbauzeichner zum Architekten weiterbildete, war seit 1972 ein prägender Dozent in der Nordwestschweiz. Der 1940 in Ziefen (Kanton Baselland) geborene Baumeister, der ab 1969 sein eigenes Büro hatte, blieb in der international ausstrahlenden Architektenszene von Basel ein stiller, aber einflussreicher Vordenker. Der regionalistisch verankerte Alder wurde gleichsam zum Antipoden des im Bereich der Theorie internationalistisch ausgerichteten Jacques Herzog. Der Umbau eines im 19. Jahrhundert als Fabrik und Wohnhaus genutzten Gebäudes im St.-Alban-Tal in Basel wurde 1986/87 ein architektonisches Manifest. Denn die sorgfältige Entkernung des Riegelbaus und das präzise Implantat der neuen Wohnungen standen für einen stillen, aber revolutionären Umgang mit der historischen Bausubstanz. Und die Fassade aus Holz rehabilitierte einen Baustoff, der jahrzehntelang als bäurisch abqualifiziert worden war.
Mit seinen Studenten machte Alder zahlreiche Studien über bauliche Strukturen im Bergkanton Graubünden. Doch ob er im dörflichen Kontext baute oder ob er Häuser inmitten der Stadt realisierte, sie passten sich morphologisch an und waren dennoch konsequent zeitgenössisch und modern. Zu Alders wichtigsten Werken zählen der Lehrbauhof in Salzburg (1986-89), die Wohnüberbauungen in Riehen (Siedlung Vogelbach, 1990-92) und Basel (Bungestrasse, 1990-93) sowie das neue Stadion Rankhof in Basel (1993/94). Mit kostengünstigen, detailliert geplanten Betonteilen, mit Holz und Naturstein entstanden sozial ausgerichtete Bauten von ausserordentlicher ästhetischer Qualität. Durch einen Unfall ist nun Michael Alder am 12. Juni jäh aus dieser Arbeit gerissen worden.