Artikel
Erlebnis Einkauf
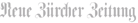
Shop-Design als Aufgabe für Architekten
Global agierende Brands, aber auch Inhaber lokal verankerter Boutiquen beauftragen verstärkt Architekten mit der Gestaltung ihrer Läden. Denn für den Verkauf von Waren ist nicht allein deren Qualität verantwortlich, sondern auch die Inszenierung.
10. Dezember 2004
Das Thema Einkaufen hat in den vergangenen Jahren verstärkt Aufmerksamkeit von verschiedenen Disziplinen erfahren. Shopping ist längst nicht mehr ein simpler Tausch von Geld gegen Ware, sondern vielfach selbst zum Erlebnis geworden. Dieses Phänomen ist nicht grundsätzlich neu: Als im Paris des beginnenden 19. Jahrhunderts die ersten Passagen entstanden, ging es darum, ein attraktives, von der Unbill des täglichen Lebens freies Ambiente zu schaffen; die ersten Warenhäuser lockten knapp hundert Jahre ihre Kunden mit der Verheissung einer verkäuflichen Welt im Kleinen. Doch nach dem Zweiten Weltkrieg verkürzte sich das Kaufen auf Bedürfnisbefriedigung: Warenhäuser in der Fussgängerzone wurden zu gesichtslosen Boxen mit maximierter Verkaufsfläche, und beim Discounter übernahm der Kunde die Rolle des Hilfslageristen, wenn er die Waren aus der Transportverpackung befreien musste.
Konsumstimulierendes Ambiente
Die banalen Warenhäuser der vergangenen Jahrzehnte, die inzwischen wieder zu Glamour- Tempeln umgestylt wurden - aktuellstes Beispiel ist der Umbau von Jelmoli in Zürich durch Tilla Theus - , belegen unmissverständlich den Wandel der jüngeren Zeit, der offenkundig mit zwei Faktoren zu tun hat: Einerseits ist auf der Seite der Käufer die konsumkritische Ära zu Ende gegangen, in der Einkaufen eher als unvermeidliches Übel gewertet und verschämt praktiziert wurde; andererseits müssen sich gerade in Zeiten ökonomischer Krisen oder relativer Marktsättigung die Firmen etwas einfallen lassen, um Kunden anzulocken und an sich zu binden.
Das Ambiente ist für die Verkaufsstimulation von nicht zu unterschätzender Bedeutung, und damit kann Shop-Design gerade für Architekten ein wichtiges Arbeitsfeld werden. Vor allem grosse Fashion-Labels, aber auch kleinere Boutiquen setzen seit einiger Zeit auf Qualität bei der Ladengestaltung. Da die Wahl eines bestimmten Kleidungsstücks vornehmlich durch Lifestyle und Mode und somit durch ästhetische Überlegungen motiviert ist, besteht die Aufgabe darin, einen Wirkungsraum zu schaffen, der die von der Modemarke intendierten «Werte» sinnlich erfahrbar macht und damit die «brand identity» unterstützt. Ladenbau aber ist nicht unbedingt einfach und bedarf spezieller Erfahrungen. Denn primär muss ein Laden funktionieren. Wo sind Herren- und Damenbereich? Wo stehen die Umkleidekabinen, wo die Kassen? Welche Kleidungsstücke verlangen nach welcher Präsentation? Architekten, die erfolgreich sein wollen, müssen nicht nur die Kompetenz des Szenographen, sondern auch die des Ladenbauers besitzen.
Der Siegeszug des neuen Store-Design begann Ende der achtziger Jahre in London, als Architekten wie David Chipperfield oder John Pawson mit weissen, formal reduzierten Interieurs den Minimalismus inthronisierten. Das Display der Waren entsprach Strategien, wie sie für die Präsentation von moderner Kunst entwickelt wurden, und eigentliche Absicht war natürlich die Nobilitierung der in puristischen, leeren Räumen wie Unikate präsentierten Textilien. In Zürich verkörpert der vor zwei Jahren eröffnete Giorgio Armani Store am Paradeplatz das Andauern minimalistischer Tendenzen: Der in London lebende Italiener Claudio Silvestrin entwickelte für weltweit geplante 50 Geschäfte des Modelabels ein Gestaltungskonzept, das eine edle, durch die Verwendung französischen Kalksteins beinahe monumental wirkende Aura schafft. Oszillierend zwischen Kunstgalerie und Pharaonengrab, suggeriert das Interieur Werthaftigkeit, Solidität und einen nachgerade überzeitlichen Geltungsanspruch.
Minimalismus neben neuer Opulenz
Dass Weiss, Clean und Cool heute aber nicht mehr unbedingt die Rahmenbedingungen sind, unter denen Textilien den Weg über den Ladentisch finden, zeigt sich bei einem Rundgang durch die Fashion-Districts der Metropolen Mailand, London, Paris, New York oder Tokio allenthalben - nirgends ist der Wandel der zeitgenössischen Architektur und Formensprache so deutlich wie in der schnelllebigen Modewelt. Neben den Minimalismus tritt eine neue Lust an Opulenz, an einer organischen Formensprache, die sich beispielsweise in den Shops des britischen Architektenteams Future Systems für die Labels Comme des Garçons und Marni manifestiert.
Am weitesten gegangen in der Neudefinition des Fashion-Store ist das Label Prada, das - anders als Armani mit Claudio Silvestrin oder Calvin Klein mit John Pawson - nicht mehr auf Corporate Identity im klassischen Sinne setzt. Ziel der von Rem Koolhaas und Herzog & de Meuron mit immensem Aufwand realisierten Flagship-Stores in New York, Tokio und Los Angeles ist es nicht mehr, ein weltweit identisches Erscheinungsbild zu kreieren, sondern gerade mit aussergewöhnlichen Interieurs Verschiedenartigkeit zu artikulieren. Koolhaas' New Yorker Prada Store ist Showroom, Bühne und Fashion-Labor zugleich.
Kein Privileg der Grossen
Neben den grossen Brands, die vielfach international renommierte Stararchitekten beauftragen, überzeugen aber auch kleinere, regional verankerte Geschäfte mit ebenso durchdachten wie ästhetisch anspruchsvollen Raumkonzepten. Zu den herausragenden Beispielen in Zürich zählen der in Zusammenarbeit mit dem Künstler Ugo Rondinone gestaltete Fabric Frontline Store an der Bärengasse, aber auch die Boutique Fidelio 2 an der Nüschelerstrasse von Jasmin Grego und Joseph Smolenicky. Ein ursprünglich als Autosalon genutztes Geschäftslokal wurde hier zu einem informellen Kleidungsgeschäft umgebaut; Spuren des Alten und subtile, vielgestaltige Hinzufügungen verbinden sich zu einem stimmigen Patchwork.
Konsumstimulierendes Ambiente
Die banalen Warenhäuser der vergangenen Jahrzehnte, die inzwischen wieder zu Glamour- Tempeln umgestylt wurden - aktuellstes Beispiel ist der Umbau von Jelmoli in Zürich durch Tilla Theus - , belegen unmissverständlich den Wandel der jüngeren Zeit, der offenkundig mit zwei Faktoren zu tun hat: Einerseits ist auf der Seite der Käufer die konsumkritische Ära zu Ende gegangen, in der Einkaufen eher als unvermeidliches Übel gewertet und verschämt praktiziert wurde; andererseits müssen sich gerade in Zeiten ökonomischer Krisen oder relativer Marktsättigung die Firmen etwas einfallen lassen, um Kunden anzulocken und an sich zu binden.
Das Ambiente ist für die Verkaufsstimulation von nicht zu unterschätzender Bedeutung, und damit kann Shop-Design gerade für Architekten ein wichtiges Arbeitsfeld werden. Vor allem grosse Fashion-Labels, aber auch kleinere Boutiquen setzen seit einiger Zeit auf Qualität bei der Ladengestaltung. Da die Wahl eines bestimmten Kleidungsstücks vornehmlich durch Lifestyle und Mode und somit durch ästhetische Überlegungen motiviert ist, besteht die Aufgabe darin, einen Wirkungsraum zu schaffen, der die von der Modemarke intendierten «Werte» sinnlich erfahrbar macht und damit die «brand identity» unterstützt. Ladenbau aber ist nicht unbedingt einfach und bedarf spezieller Erfahrungen. Denn primär muss ein Laden funktionieren. Wo sind Herren- und Damenbereich? Wo stehen die Umkleidekabinen, wo die Kassen? Welche Kleidungsstücke verlangen nach welcher Präsentation? Architekten, die erfolgreich sein wollen, müssen nicht nur die Kompetenz des Szenographen, sondern auch die des Ladenbauers besitzen.
Der Siegeszug des neuen Store-Design begann Ende der achtziger Jahre in London, als Architekten wie David Chipperfield oder John Pawson mit weissen, formal reduzierten Interieurs den Minimalismus inthronisierten. Das Display der Waren entsprach Strategien, wie sie für die Präsentation von moderner Kunst entwickelt wurden, und eigentliche Absicht war natürlich die Nobilitierung der in puristischen, leeren Räumen wie Unikate präsentierten Textilien. In Zürich verkörpert der vor zwei Jahren eröffnete Giorgio Armani Store am Paradeplatz das Andauern minimalistischer Tendenzen: Der in London lebende Italiener Claudio Silvestrin entwickelte für weltweit geplante 50 Geschäfte des Modelabels ein Gestaltungskonzept, das eine edle, durch die Verwendung französischen Kalksteins beinahe monumental wirkende Aura schafft. Oszillierend zwischen Kunstgalerie und Pharaonengrab, suggeriert das Interieur Werthaftigkeit, Solidität und einen nachgerade überzeitlichen Geltungsanspruch.
Minimalismus neben neuer Opulenz
Dass Weiss, Clean und Cool heute aber nicht mehr unbedingt die Rahmenbedingungen sind, unter denen Textilien den Weg über den Ladentisch finden, zeigt sich bei einem Rundgang durch die Fashion-Districts der Metropolen Mailand, London, Paris, New York oder Tokio allenthalben - nirgends ist der Wandel der zeitgenössischen Architektur und Formensprache so deutlich wie in der schnelllebigen Modewelt. Neben den Minimalismus tritt eine neue Lust an Opulenz, an einer organischen Formensprache, die sich beispielsweise in den Shops des britischen Architektenteams Future Systems für die Labels Comme des Garçons und Marni manifestiert.
Am weitesten gegangen in der Neudefinition des Fashion-Store ist das Label Prada, das - anders als Armani mit Claudio Silvestrin oder Calvin Klein mit John Pawson - nicht mehr auf Corporate Identity im klassischen Sinne setzt. Ziel der von Rem Koolhaas und Herzog & de Meuron mit immensem Aufwand realisierten Flagship-Stores in New York, Tokio und Los Angeles ist es nicht mehr, ein weltweit identisches Erscheinungsbild zu kreieren, sondern gerade mit aussergewöhnlichen Interieurs Verschiedenartigkeit zu artikulieren. Koolhaas' New Yorker Prada Store ist Showroom, Bühne und Fashion-Labor zugleich.
Kein Privileg der Grossen
Neben den grossen Brands, die vielfach international renommierte Stararchitekten beauftragen, überzeugen aber auch kleinere, regional verankerte Geschäfte mit ebenso durchdachten wie ästhetisch anspruchsvollen Raumkonzepten. Zu den herausragenden Beispielen in Zürich zählen der in Zusammenarbeit mit dem Künstler Ugo Rondinone gestaltete Fabric Frontline Store an der Bärengasse, aber auch die Boutique Fidelio 2 an der Nüschelerstrasse von Jasmin Grego und Joseph Smolenicky. Ein ursprünglich als Autosalon genutztes Geschäftslokal wurde hier zu einem informellen Kleidungsgeschäft umgebaut; Spuren des Alten und subtile, vielgestaltige Hinzufügungen verbinden sich zu einem stimmigen Patchwork.
Für den Beitrag verantwortlich: Neue Zürcher Zeitung
Ansprechpartner:in für diese Seite: nextroom






