Artikel
Blockaden, Mythen und Potenziale
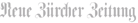
Das «Städtebauliche Porträt» des ETH-Studios Basel
Auf ihren Reisen bewundern Schweizer gerne grossartige städtebauliche Lösungen. Mit der Kleinräumigkeit und Zersiedelung im eigenen Land hat sich aber eine Mehrheit von ihnen abgefunden. Sie hängt Bildern nach, die ihre Bodenhaftung verloren haben. Die besondere Urbanität der Schweiz wurzelt in den Differenzen und Widersprüchen, auf die nun das ETH-Studio Basel in der soeben erschienenen Publikation «Die Schweiz - ein städtebauliches Porträt» seinen akribischen Blick richtet.
5. November 2005 - André Bideau
Die Klage um den Raum, der seine spezifischen, unverwechselbaren, identitätsstiftenden Momente verloren hat, begleitet den Architekturdiskurs seit den 1950er Jahren. Der ursprünglich mit den Attributen des Egalitären und Universellen versehene Raum der Moderne hatte als ideales Konstrukt nach dem Zweiten Weltkrieg die Sprengkraft eingebüsst: Unter dem Einfluss von Technik und Standardisierung waren aus Visionen biedere Normen geworden. Bestimmt vom Tabula-rasa-Städtebau der europäischen Planer oder dem wuchernden Siedlungsbrei der USA, wurde das Territorium forthin durch ein Zusammenspiel technokratischer und marktwirtschaftlicher Kräfte kontrolliert und gestaltet.
Mit dem Flächenwachstum der Agglomerationen begannen in der Nachkriegszeit Raum und Ort auseinander zu fallen. Tony Smith, ein Vertreter der Minimal Art, liess sich damals von Verkehrs- und Industrielandschaften entlang der Autobahn faszinieren und erkannte darin ein wahrhaft zeitgenössisches Raumerlebnis. Architekten reagierten auf die Krise des Territoriums anders: Sie gingen dazu über, das Urbane als ein sich der Zersiedelung gegenüber widerständig verhaltendes Moment neu zu thematisieren. Einflussreich war hier die Suche des Theoretikers Kevin Lynch nach identitätsstiftenden Zeichen und Grossformen in den nordamerikanischen Agglomerationen. In seinem 1960 erschienenen Buch «The Image of the City» erforschte Lynch die Gestaltungsprinzipien für eine urbane Erfahrungsdichte: «Environmental imageability» sollte im hierarchielosen Nebeneinander des modernen Territoriums wieder Spannung erzeugen.
RENAISSANCE DER STADT
Die Rede von «Urbanität» bildet einen integralen Bestandteil des nachmodernen Architekturdiskurses. In den unterschiedlichsten nationalen Kontexten äusserte sich immer wieder die Hoffnung, die verloren gegangene Differenz und Heterogenität des Raumes zurückzugewinnen. Problematisch ist dabei, dass die Stadt oftmals mit Bedeutungen ausgestattet wird, die sich nicht mehr an Räume binden lassen. Die deutschen Soziologen Hartmut Häussermann und Werner Siebel sprechen davon, dass «die soziale Substanz» Urbanität ohnehin geschwunden sei, dass Urbanität, die eine Dialektik von Privatheit und öffentlicher Sphäre sowie eine bestimmte Organisation des Politischen und des Ökonomischen bezeichne, ihre inhaltlichen Voraussetzungen eingebüsst habe. Deshalb stehe Urbanität nur noch für eine Kategorie des Verhaltens, der emotionalen Befindlichkeit der postmodernen Gesellschaft. Und am reinsten realisiere sich solche Urbanität im Konsumerlebnis.
Dieses Lamento lässt sich aber auch auf die in der Postmoderne einsetzende Renaissance der Innenstädte beziehen, die durch die Setzung architektonischer Zeichen zusätzlichen Schwung erhielt. Noch einen Schritt weiter geht der Soziologe Walter Prigge, der «Urbanität» als eine Art heimtückisches Regulativ bezeichnet: Wenn heute eine Stadt ihre Anziehungskraft erhalten will, geht es nicht mehr um die Festlegung verbindlicher Entwicklungsmodelle, sondern nur noch um das richtige «Tuning». Urbanität wird bei Prigge zur Ideologie, mit der sich die realen Lebensbedingungen der Städter verschleiern lassen. So gesehen stellt sich der Erlebnisgehalt des wiedergewonnenen urbanen Raumes als Korrektiv oder gar als postmoderne Verpackung ohne Inhalt dar.
Ungeachtet ihrer urbanen Kultur definiert sich die Schweiz traditionell nicht über ihre städtischen Zentren. Der Gegenstand Stadt scheint im Vergleich zu Deutschland geradezu konzeptionell unterprivilegiert. Dies äussert sich nicht nur in der Städtebaupraxis, die nach 1945 keinen Wiederaufbau zu bewältigen hatte, sondern bereits in der Ausbildungssituation: Als ein eigener Studiengang wird Stadtplanung in der Schweiz «nur» an Fachschulen angeboten; im Hauptstudium erteilt die ETH lediglich Architektendiplome. Mangels wirklich grosser Städte spielt die Schweiz aber auch im Diskurs rund um die Urbanität eine marginale Rolle. So ist hierzulande nicht nur die Tradition der deutschen Stadtsoziologie wissenschaftlich untervertreten. Auch die jüngeren, stark interdisziplinär ausgerichteten Cultural Studies, die sich vor allem im englischen Sprachraum rund um Fragen der Populärkultur und des urbanen Alltags entfaltet haben, konnten in der Schweiz institutionell nicht Fuss fassen.
Das Abseitsstehen in den Debatten zur zeitgenössischen Urbanität - spürbar an der ETH seit der Emeritierung des Städtebautheoretikers André Corboz - ist einer der Hintergründe, vor denen sich die Laborsituation des ETH-Studios Basel seit 1999 diskutieren lässt. Von Soziologen, Geographen und Architekturstudenten unterstützt, ergründen dort Roger Diener, Jacques Herzog, Marcel Meili und Pierre de Meuron die «spezifischen urbanen Verhaltensmuster» der Schweiz. Die vier ETH-Professoren sehen darin ein «Garagenexperiment», das ihnen neben der internationalen Tätigkeit erlaubt, einem gemeinsamen Erkenntnisinteresse nachzugehen. Nun liegt die Studie «Die Schweiz - ein städtebauliches Porträt», die nach verschiedenen Vorankündigungen unter beträchtlichem Erfolgsdruck stand, als Bilanz der Arbeit in Basel vor.
Programm ist bereits der Titel. Das «Städtebauliche Porträt» will ein neues Schweizbild entwerfen, was nicht ohne die Auseinandersetzung mit tradierten Denkstrukturen und Wahrnehmungen zu erreichen ist. Hierin vollziehen die Verfasser bewusst eine Abgrenzung gegenüber den Forschungsansätzen von Stefano Boeri, Rem Koolhaas oder dem Koolhaas-Schüler Winy Maas, die ihre kontroversen Positionen in den vergangenen Jahren medienwirksam zu verbreiten wussten.
Das «Städtebauliche Porträt» reibt sich an der räumlichen Ordnung der Schweiz, die das Städtische immer wieder zugunsten ruraler Mythen benachteiligt hat. Dem wird entgegengehalten, dass ländliche und metropolitane Gegenden der Ausdruck von ein und demselben Konstrukt sind. Dies wird von den Verfassern als spezifische Eigenschaft, zugleich als Hemmung identifiziert; Herzog diagnostiziert gar eine «tiefsitzende Ablehnung des Urbanen». Deshalb plädiert das «Städtebauliche Porträt» für drei Metropolitanregionen - Zürich, Basel und Genf/Lausanne -, deren Potenziale es im Hinblick auf die internationale Konkurrenzfähigkeit zu fördern gälte.
ENZYKLOPÄDISCHER ANSPRUCH
Dabei gerät der Tonfall manchmal in die Nähe einer Rhetorik, die das Standortmarketing der neunziger Jahre kennzeichnete. Das «Städtebauliche Porträt» will jedoch mehr sein als ein Ideenlieferant für Städte, die sich im unerbittlichen Wettkampf um Arbeitsplätze, Investoren und Steuerzahler befinden. Ihm geht es darum, die Genese, den Gebrauch und die Wahrnehmung des schweizerischen Territoriums von der Antike bis heute zu dokumentieren und darüber hinaus die Vorstellung einer zukünftigen Siedlungstopographie für die Schweiz als Ganzes zu entwerfen. Für diesen enzyklopädischen Anspruch stehen 1002 Seiten zur Verfügung. Auf die drei Bände folgt eine Faltkarte, die «urbane Potenziale der Schweiz» dokumentiert und so die Forschungsresultate zur programmatischen These grafisch vereinigt. Sie dient als eigentlicher Anstoss für die Diskussion darüber, wie sich eine «Typologie der urbanen Schweiz» neu denken liesse. Und das Hauptziel der Autoren ist es, diese Diskussion in die Öffentlichkeit zu tragen.
Obschon architektonisch-städtebauliche Projekte fehlen, handelt es sich beim «Städtebaulichen Porträt» um ein Buch, das die Handschrift der als international anerkannte Architekten tätigen Verfasser trägt und von einer akribischen und phänomenologischen Annäherung an die Realität zeugt. Die Lektüre von urbanen Bezügen im territorialen Massstab erinnert an die von Herzog & de Meuron 1991 gemeinsam mit Rémy Zaugg im Grossraum Basel durchführte Studie «Basel - eine Stadt im Werden?». Zugleich muss das «Städtebauliche Porträt» im Bezug auf die kritischen Entwicklungen gesehen werden, die der schweizerische Städtebau seit der Moderne durchlaufen hat. Die folgenschwere Tendenz, das ganze Land als ein zusammenhängendes, annähernd durchgehend urbanisiertes Territorium zu thematisieren, nahm bereits vor der Massenmotorisierung ihren Anfang. Im Jahre 1941 verbreitete der Architekt Armin Meili als Präsident der Schweizerischen Vereinigung für Landesplanung das Bild der «dezentralisierten Grossstadt».
An diesem hielt auch das Institut für Orts-, Regional- und Landesplanung der ETH 1973 mit dem Leitbild der «dezentralisierten Konzentration» fest. Verkehrs-, Agrar- und Landschaftsplanung hatten Vorrang gegenüber einer Stadtplanung, die zu Zeiten des Kalten Krieges ohnehin als eine sozialistisch inspirierte Einmischung des Staates in die Eigentumssphäre beargwöhnt wurde. Dort jedoch, wo das heile Schweizbild auf dem Spiel stand, wurde und wird staatlicher Interventionismus stillschweigend begrüsst: Bis heute lässt sich der Bund die Fördermassnahmen der ländlichen Gebiete viel Geld kosten. Aber erst seit 2001 liegt mit der «Agglomerationspolitik des Bundes» ein Massnahmenkatalog vor, der auch die Probleme der städtischen Zentren mit einer übergeordneten Strategie angeht.
THEORETISCHE FUNDIERUNG
Das «Städtebauliche Porträt» zielt mit seiner Befragung der schweizerischen Identität in Zeiten der Globalisierung in dieselbe Stossrichtung wie «Stadtland Schweiz», eine von Avenir Suisse 2003 ebenfalls im Birkhäuser-Verlag veröffentlichte Publikation. Deren Herausgeber Angelus Eisinger und Michel Schneider führten ihre Bestandesaufnahme vor dem Hintergrund der «veränderten räumlichen Wirklichkeit» der Schweiz durch - ebenfalls in der Hoffnung, eine neue Urbanismusdiskussion freizusetzen. Durch die Beteiligung unterschiedlichster Akteure aus der Praxis fielen in «Stadtland Schweiz» die Fragen nach dem Machbaren konkreter und weniger spekulativ aus. Beide Untersuchungen beschäftigen sich mit den Auswirkungen des kommunalen Föderalismus. Auch bei der Kritik an der Subventionierung der Berggemeinden, welche die Verfasser zur These der «alpinen Brachen» verdichten, bewegt sich das «Städtebauliche Porträt» im Rahmen von Debatten der vergangenen Jahre.
Das Neue am «Städtebaulichen Porträt» ist die Besessenheit, mit der hier eine Realität gelesen wird. Dies resultiert laut Meili aus dem Bedürfnis, «Plattitüden so gegeneinander zu montieren, dass sie zu glühen beginnen». Die visuell suggestive Argumentation, die mit Diagrammen, Fotostrecken und Skizzen das Territorium ins Bild setzt, zeugt vom stark subjektivierenden Architektenblick der Autoren. Doch vermag gerade dieser Blick ein räumliches Bild jener Kräfte zu entwickeln, denen die Schweiz ihre widerborstige politische Körnung verdankt.
Wie ein Herbarium bildet der erste Band die Pläne aller 2768 Gemeinden der Schweiz ab. Aus der Sicht der Autoren avanciert die Gemeinde zum eigentlichen Corpus Delicti - zu einer Ordnung, welche die Verantwortung für die Defizite der schweizerischen Urbanität trägt. Dabei wird der Mythos der kommunalen Souveränität als ein die dysfunktionale Realität kaschierendes Konstrukt dargestellt. In einer überaus detailreichen kulturhistorischen Herleitung führt der zweite Band vor, wie zwischen Stadt und Land schon immer eine konfliktreiche Beziehung bestand, der heute jedoch mit den eingespielten räumlichen Ordnungs- und Denkschemen nicht mehr beizukommen ist. Die «verborgene Zellstruktur» des Landes ist am Ende ihrer Leistungsfähigkeit angelangt: Der Mechanismus, durch den Gemeindeautonomie und föderalistische Austarierung früher balanciert wurden, ist von den seit 1960 auftretenden Prozessen von Strukturwandel und Verstädterung überfordert. Die daraus resultierenden Blockaden, Abschottungen und Schrumpfungen werden dem Leser in allen ihren Ausprägungen drastisch und suggestiv vor Augen geführt.
Ohne eine konkrete Handlungsanleitung zu geben, will das «Städtebauliche Porträt» zu einer anderen Urbanität anstiften - dies vorerst als konzeptionelles Projekt. In diesem Sinn ist die im Buch entworfene «Siedlungstopographie» zu verstehen, welche die Schweiz in fünf Grossräume einteilt: Metropolitanregionen, Städtenetze, stille Zonen, alpine Resorts und alpine Brachen. Nicht austauschbar und universell, sondern ungleich und hierarchisch soll diese Siedlungstopographie sein, mit der die lähmende Zellstruktur überwunden werden soll. Laut Herzog bietet die Schweiz ironischerweise dazu ideale Voraussetzungen, doch steht sie sich selber im Weg: «Das Land der Hyperdifferenz kann Differenz schlechter leben und gestalten als jedes andere Land.» Als Auslegeordnung wird die Siedlungstopographie bereits im ersten der drei Bände vorgestellt, wobei das Kapitel «Theorie» den intellektuellen Überbau des gesamten Forschungsprojekts erschliesst. Als einer der wenigen Texte im «Städtebaulichen Porträt» ist dieses längere Kapitel mit einem Namen gezeichnet: Christian Schmid, der als Stadtgeograph seit 1999 wissenschaftlicher Assistent im ETH-Studio Basel und zugleich der fünfte Buchautor ist. Ausgehend von den Begriffen Netzwerke, Grenzen, Differenzen, erklärt Schmid die methodische Grundlage sämtlicher Analysen und «Bohrungen» (Letztere der eigentliche studentische Tätigkeitsbereich). Schmid beruft sich dabei auf die vom marxistischen Denker Henri Lefebvre nach 1970 entwickelten Ansätze.
Nicht nur wurden diese für den Untersuchungsraster der Raumanalysen verwendet; sie dienen im Weiteren dazu, die für die Schweiz charakteristische Beziehung zwischen dem Urbanen und dem Ruralen als eine ideologische Figur zu ergründen. Wenn auch die Herleitung der Begriffe Netzwerk, Grenze und Differenz nicht ohne eine gewisse Pädagogik auskommt, leuchtet die gründliche theoretische Fundierung des Vorhabens ein. Schmids Fixierung auf Lefebvre hat allerdings den Preis, dass andere Ansätze nicht zur Verfügung stehen, von denen das Forschungsprojekt ebenfalls hätte profitieren können. Sowohl David Harvey als auch John Urry haben sich mit den Themen Urbanität, Identität, Mobilität und Raum befasst. Weniger orthodox als Lefebvre, nähern sich diese Geographen gerade jenen Aspekten, die bei den untersuchten «alpinen Resorts» einen zentralen Platz einnehmen: Konsum, Landschaft, Tourismus.
Mit zeitgenössischem Freizeitverhalten setzt sich das «Städtebauliche Porträt» auch im Fall der drei Metropolitanregionen auseinander. Deren wichtigste Potenziale erkennen die Verfasser in morphologisch überhöhten Natureinlagerungen in den Agglomerationsgürteln. Für Zürich schlagen sie die Stärkung des von der Glatttal- Stadt umgebenen Hardwaldes vor, für Basel die Flutung von Teilen des bewaldeten Naherholungsgebietes am Oberrhein, für Genf schliesslich die Verfestigung eines halbmondförmigen Parkgürtels im Norden und Westen der Kernstadt. An solchen morphologischen Bildern ist das «Städtebauliche Porträt» überaus reich. Doch wollen die Autoren nicht nur die «tektonischen Platten der Kulturräume» ansprechen: Immer wieder thematisieren sie auch die «alltagsweltlichen Erfahrungen», die in Lefebvres Gedanken zur Urbanität so zentral sind. Hier ist die Beziehung zwischen den mentalen Raumbildern und dem gelebten - ökonomisch, rechtlich und politisch verhandelten - zeitgenössischen Raum allerdings kaum nachvollziehbar. Machtfragen weicht das als Bestandesaufnahme verstandene «Städtebauliche Porträt» nicht zu Unrecht aus. Deshalb wird es sich den Fragen stellen müssen, ob sich ein Land wie die Schweiz über territoriale Grossformen neu denken und diskutieren lässt (wie es das ETH-Studio Basel hofft) und ob eine an Raumbilder geknüpfte Urbanität beim Publikum ebenso erstrebenswert sein wird wie ein Leben im Einfamilienhaus in einer steuergünstigen Zürichseegemeinde.
[ Die Schweiz - ein städtebauliches Porträt. Hrsg. ETH-Studio Basel, Institut Stadt der Gegenwart. Birkhäuser-Verlag, Basel 2005. 1020 S. (3 Bände und 1 Faltkarte), Fr. 68.-. ]
Mit dem Flächenwachstum der Agglomerationen begannen in der Nachkriegszeit Raum und Ort auseinander zu fallen. Tony Smith, ein Vertreter der Minimal Art, liess sich damals von Verkehrs- und Industrielandschaften entlang der Autobahn faszinieren und erkannte darin ein wahrhaft zeitgenössisches Raumerlebnis. Architekten reagierten auf die Krise des Territoriums anders: Sie gingen dazu über, das Urbane als ein sich der Zersiedelung gegenüber widerständig verhaltendes Moment neu zu thematisieren. Einflussreich war hier die Suche des Theoretikers Kevin Lynch nach identitätsstiftenden Zeichen und Grossformen in den nordamerikanischen Agglomerationen. In seinem 1960 erschienenen Buch «The Image of the City» erforschte Lynch die Gestaltungsprinzipien für eine urbane Erfahrungsdichte: «Environmental imageability» sollte im hierarchielosen Nebeneinander des modernen Territoriums wieder Spannung erzeugen.
RENAISSANCE DER STADT
Die Rede von «Urbanität» bildet einen integralen Bestandteil des nachmodernen Architekturdiskurses. In den unterschiedlichsten nationalen Kontexten äusserte sich immer wieder die Hoffnung, die verloren gegangene Differenz und Heterogenität des Raumes zurückzugewinnen. Problematisch ist dabei, dass die Stadt oftmals mit Bedeutungen ausgestattet wird, die sich nicht mehr an Räume binden lassen. Die deutschen Soziologen Hartmut Häussermann und Werner Siebel sprechen davon, dass «die soziale Substanz» Urbanität ohnehin geschwunden sei, dass Urbanität, die eine Dialektik von Privatheit und öffentlicher Sphäre sowie eine bestimmte Organisation des Politischen und des Ökonomischen bezeichne, ihre inhaltlichen Voraussetzungen eingebüsst habe. Deshalb stehe Urbanität nur noch für eine Kategorie des Verhaltens, der emotionalen Befindlichkeit der postmodernen Gesellschaft. Und am reinsten realisiere sich solche Urbanität im Konsumerlebnis.
Dieses Lamento lässt sich aber auch auf die in der Postmoderne einsetzende Renaissance der Innenstädte beziehen, die durch die Setzung architektonischer Zeichen zusätzlichen Schwung erhielt. Noch einen Schritt weiter geht der Soziologe Walter Prigge, der «Urbanität» als eine Art heimtückisches Regulativ bezeichnet: Wenn heute eine Stadt ihre Anziehungskraft erhalten will, geht es nicht mehr um die Festlegung verbindlicher Entwicklungsmodelle, sondern nur noch um das richtige «Tuning». Urbanität wird bei Prigge zur Ideologie, mit der sich die realen Lebensbedingungen der Städter verschleiern lassen. So gesehen stellt sich der Erlebnisgehalt des wiedergewonnenen urbanen Raumes als Korrektiv oder gar als postmoderne Verpackung ohne Inhalt dar.
Ungeachtet ihrer urbanen Kultur definiert sich die Schweiz traditionell nicht über ihre städtischen Zentren. Der Gegenstand Stadt scheint im Vergleich zu Deutschland geradezu konzeptionell unterprivilegiert. Dies äussert sich nicht nur in der Städtebaupraxis, die nach 1945 keinen Wiederaufbau zu bewältigen hatte, sondern bereits in der Ausbildungssituation: Als ein eigener Studiengang wird Stadtplanung in der Schweiz «nur» an Fachschulen angeboten; im Hauptstudium erteilt die ETH lediglich Architektendiplome. Mangels wirklich grosser Städte spielt die Schweiz aber auch im Diskurs rund um die Urbanität eine marginale Rolle. So ist hierzulande nicht nur die Tradition der deutschen Stadtsoziologie wissenschaftlich untervertreten. Auch die jüngeren, stark interdisziplinär ausgerichteten Cultural Studies, die sich vor allem im englischen Sprachraum rund um Fragen der Populärkultur und des urbanen Alltags entfaltet haben, konnten in der Schweiz institutionell nicht Fuss fassen.
Das Abseitsstehen in den Debatten zur zeitgenössischen Urbanität - spürbar an der ETH seit der Emeritierung des Städtebautheoretikers André Corboz - ist einer der Hintergründe, vor denen sich die Laborsituation des ETH-Studios Basel seit 1999 diskutieren lässt. Von Soziologen, Geographen und Architekturstudenten unterstützt, ergründen dort Roger Diener, Jacques Herzog, Marcel Meili und Pierre de Meuron die «spezifischen urbanen Verhaltensmuster» der Schweiz. Die vier ETH-Professoren sehen darin ein «Garagenexperiment», das ihnen neben der internationalen Tätigkeit erlaubt, einem gemeinsamen Erkenntnisinteresse nachzugehen. Nun liegt die Studie «Die Schweiz - ein städtebauliches Porträt», die nach verschiedenen Vorankündigungen unter beträchtlichem Erfolgsdruck stand, als Bilanz der Arbeit in Basel vor.
Programm ist bereits der Titel. Das «Städtebauliche Porträt» will ein neues Schweizbild entwerfen, was nicht ohne die Auseinandersetzung mit tradierten Denkstrukturen und Wahrnehmungen zu erreichen ist. Hierin vollziehen die Verfasser bewusst eine Abgrenzung gegenüber den Forschungsansätzen von Stefano Boeri, Rem Koolhaas oder dem Koolhaas-Schüler Winy Maas, die ihre kontroversen Positionen in den vergangenen Jahren medienwirksam zu verbreiten wussten.
Das «Städtebauliche Porträt» reibt sich an der räumlichen Ordnung der Schweiz, die das Städtische immer wieder zugunsten ruraler Mythen benachteiligt hat. Dem wird entgegengehalten, dass ländliche und metropolitane Gegenden der Ausdruck von ein und demselben Konstrukt sind. Dies wird von den Verfassern als spezifische Eigenschaft, zugleich als Hemmung identifiziert; Herzog diagnostiziert gar eine «tiefsitzende Ablehnung des Urbanen». Deshalb plädiert das «Städtebauliche Porträt» für drei Metropolitanregionen - Zürich, Basel und Genf/Lausanne -, deren Potenziale es im Hinblick auf die internationale Konkurrenzfähigkeit zu fördern gälte.
ENZYKLOPÄDISCHER ANSPRUCH
Dabei gerät der Tonfall manchmal in die Nähe einer Rhetorik, die das Standortmarketing der neunziger Jahre kennzeichnete. Das «Städtebauliche Porträt» will jedoch mehr sein als ein Ideenlieferant für Städte, die sich im unerbittlichen Wettkampf um Arbeitsplätze, Investoren und Steuerzahler befinden. Ihm geht es darum, die Genese, den Gebrauch und die Wahrnehmung des schweizerischen Territoriums von der Antike bis heute zu dokumentieren und darüber hinaus die Vorstellung einer zukünftigen Siedlungstopographie für die Schweiz als Ganzes zu entwerfen. Für diesen enzyklopädischen Anspruch stehen 1002 Seiten zur Verfügung. Auf die drei Bände folgt eine Faltkarte, die «urbane Potenziale der Schweiz» dokumentiert und so die Forschungsresultate zur programmatischen These grafisch vereinigt. Sie dient als eigentlicher Anstoss für die Diskussion darüber, wie sich eine «Typologie der urbanen Schweiz» neu denken liesse. Und das Hauptziel der Autoren ist es, diese Diskussion in die Öffentlichkeit zu tragen.
Obschon architektonisch-städtebauliche Projekte fehlen, handelt es sich beim «Städtebaulichen Porträt» um ein Buch, das die Handschrift der als international anerkannte Architekten tätigen Verfasser trägt und von einer akribischen und phänomenologischen Annäherung an die Realität zeugt. Die Lektüre von urbanen Bezügen im territorialen Massstab erinnert an die von Herzog & de Meuron 1991 gemeinsam mit Rémy Zaugg im Grossraum Basel durchführte Studie «Basel - eine Stadt im Werden?». Zugleich muss das «Städtebauliche Porträt» im Bezug auf die kritischen Entwicklungen gesehen werden, die der schweizerische Städtebau seit der Moderne durchlaufen hat. Die folgenschwere Tendenz, das ganze Land als ein zusammenhängendes, annähernd durchgehend urbanisiertes Territorium zu thematisieren, nahm bereits vor der Massenmotorisierung ihren Anfang. Im Jahre 1941 verbreitete der Architekt Armin Meili als Präsident der Schweizerischen Vereinigung für Landesplanung das Bild der «dezentralisierten Grossstadt».
An diesem hielt auch das Institut für Orts-, Regional- und Landesplanung der ETH 1973 mit dem Leitbild der «dezentralisierten Konzentration» fest. Verkehrs-, Agrar- und Landschaftsplanung hatten Vorrang gegenüber einer Stadtplanung, die zu Zeiten des Kalten Krieges ohnehin als eine sozialistisch inspirierte Einmischung des Staates in die Eigentumssphäre beargwöhnt wurde. Dort jedoch, wo das heile Schweizbild auf dem Spiel stand, wurde und wird staatlicher Interventionismus stillschweigend begrüsst: Bis heute lässt sich der Bund die Fördermassnahmen der ländlichen Gebiete viel Geld kosten. Aber erst seit 2001 liegt mit der «Agglomerationspolitik des Bundes» ein Massnahmenkatalog vor, der auch die Probleme der städtischen Zentren mit einer übergeordneten Strategie angeht.
THEORETISCHE FUNDIERUNG
Das «Städtebauliche Porträt» zielt mit seiner Befragung der schweizerischen Identität in Zeiten der Globalisierung in dieselbe Stossrichtung wie «Stadtland Schweiz», eine von Avenir Suisse 2003 ebenfalls im Birkhäuser-Verlag veröffentlichte Publikation. Deren Herausgeber Angelus Eisinger und Michel Schneider führten ihre Bestandesaufnahme vor dem Hintergrund der «veränderten räumlichen Wirklichkeit» der Schweiz durch - ebenfalls in der Hoffnung, eine neue Urbanismusdiskussion freizusetzen. Durch die Beteiligung unterschiedlichster Akteure aus der Praxis fielen in «Stadtland Schweiz» die Fragen nach dem Machbaren konkreter und weniger spekulativ aus. Beide Untersuchungen beschäftigen sich mit den Auswirkungen des kommunalen Föderalismus. Auch bei der Kritik an der Subventionierung der Berggemeinden, welche die Verfasser zur These der «alpinen Brachen» verdichten, bewegt sich das «Städtebauliche Porträt» im Rahmen von Debatten der vergangenen Jahre.
Das Neue am «Städtebaulichen Porträt» ist die Besessenheit, mit der hier eine Realität gelesen wird. Dies resultiert laut Meili aus dem Bedürfnis, «Plattitüden so gegeneinander zu montieren, dass sie zu glühen beginnen». Die visuell suggestive Argumentation, die mit Diagrammen, Fotostrecken und Skizzen das Territorium ins Bild setzt, zeugt vom stark subjektivierenden Architektenblick der Autoren. Doch vermag gerade dieser Blick ein räumliches Bild jener Kräfte zu entwickeln, denen die Schweiz ihre widerborstige politische Körnung verdankt.
Wie ein Herbarium bildet der erste Band die Pläne aller 2768 Gemeinden der Schweiz ab. Aus der Sicht der Autoren avanciert die Gemeinde zum eigentlichen Corpus Delicti - zu einer Ordnung, welche die Verantwortung für die Defizite der schweizerischen Urbanität trägt. Dabei wird der Mythos der kommunalen Souveränität als ein die dysfunktionale Realität kaschierendes Konstrukt dargestellt. In einer überaus detailreichen kulturhistorischen Herleitung führt der zweite Band vor, wie zwischen Stadt und Land schon immer eine konfliktreiche Beziehung bestand, der heute jedoch mit den eingespielten räumlichen Ordnungs- und Denkschemen nicht mehr beizukommen ist. Die «verborgene Zellstruktur» des Landes ist am Ende ihrer Leistungsfähigkeit angelangt: Der Mechanismus, durch den Gemeindeautonomie und föderalistische Austarierung früher balanciert wurden, ist von den seit 1960 auftretenden Prozessen von Strukturwandel und Verstädterung überfordert. Die daraus resultierenden Blockaden, Abschottungen und Schrumpfungen werden dem Leser in allen ihren Ausprägungen drastisch und suggestiv vor Augen geführt.
Ohne eine konkrete Handlungsanleitung zu geben, will das «Städtebauliche Porträt» zu einer anderen Urbanität anstiften - dies vorerst als konzeptionelles Projekt. In diesem Sinn ist die im Buch entworfene «Siedlungstopographie» zu verstehen, welche die Schweiz in fünf Grossräume einteilt: Metropolitanregionen, Städtenetze, stille Zonen, alpine Resorts und alpine Brachen. Nicht austauschbar und universell, sondern ungleich und hierarchisch soll diese Siedlungstopographie sein, mit der die lähmende Zellstruktur überwunden werden soll. Laut Herzog bietet die Schweiz ironischerweise dazu ideale Voraussetzungen, doch steht sie sich selber im Weg: «Das Land der Hyperdifferenz kann Differenz schlechter leben und gestalten als jedes andere Land.» Als Auslegeordnung wird die Siedlungstopographie bereits im ersten der drei Bände vorgestellt, wobei das Kapitel «Theorie» den intellektuellen Überbau des gesamten Forschungsprojekts erschliesst. Als einer der wenigen Texte im «Städtebaulichen Porträt» ist dieses längere Kapitel mit einem Namen gezeichnet: Christian Schmid, der als Stadtgeograph seit 1999 wissenschaftlicher Assistent im ETH-Studio Basel und zugleich der fünfte Buchautor ist. Ausgehend von den Begriffen Netzwerke, Grenzen, Differenzen, erklärt Schmid die methodische Grundlage sämtlicher Analysen und «Bohrungen» (Letztere der eigentliche studentische Tätigkeitsbereich). Schmid beruft sich dabei auf die vom marxistischen Denker Henri Lefebvre nach 1970 entwickelten Ansätze.
Nicht nur wurden diese für den Untersuchungsraster der Raumanalysen verwendet; sie dienen im Weiteren dazu, die für die Schweiz charakteristische Beziehung zwischen dem Urbanen und dem Ruralen als eine ideologische Figur zu ergründen. Wenn auch die Herleitung der Begriffe Netzwerk, Grenze und Differenz nicht ohne eine gewisse Pädagogik auskommt, leuchtet die gründliche theoretische Fundierung des Vorhabens ein. Schmids Fixierung auf Lefebvre hat allerdings den Preis, dass andere Ansätze nicht zur Verfügung stehen, von denen das Forschungsprojekt ebenfalls hätte profitieren können. Sowohl David Harvey als auch John Urry haben sich mit den Themen Urbanität, Identität, Mobilität und Raum befasst. Weniger orthodox als Lefebvre, nähern sich diese Geographen gerade jenen Aspekten, die bei den untersuchten «alpinen Resorts» einen zentralen Platz einnehmen: Konsum, Landschaft, Tourismus.
Mit zeitgenössischem Freizeitverhalten setzt sich das «Städtebauliche Porträt» auch im Fall der drei Metropolitanregionen auseinander. Deren wichtigste Potenziale erkennen die Verfasser in morphologisch überhöhten Natureinlagerungen in den Agglomerationsgürteln. Für Zürich schlagen sie die Stärkung des von der Glatttal- Stadt umgebenen Hardwaldes vor, für Basel die Flutung von Teilen des bewaldeten Naherholungsgebietes am Oberrhein, für Genf schliesslich die Verfestigung eines halbmondförmigen Parkgürtels im Norden und Westen der Kernstadt. An solchen morphologischen Bildern ist das «Städtebauliche Porträt» überaus reich. Doch wollen die Autoren nicht nur die «tektonischen Platten der Kulturräume» ansprechen: Immer wieder thematisieren sie auch die «alltagsweltlichen Erfahrungen», die in Lefebvres Gedanken zur Urbanität so zentral sind. Hier ist die Beziehung zwischen den mentalen Raumbildern und dem gelebten - ökonomisch, rechtlich und politisch verhandelten - zeitgenössischen Raum allerdings kaum nachvollziehbar. Machtfragen weicht das als Bestandesaufnahme verstandene «Städtebauliche Porträt» nicht zu Unrecht aus. Deshalb wird es sich den Fragen stellen müssen, ob sich ein Land wie die Schweiz über territoriale Grossformen neu denken und diskutieren lässt (wie es das ETH-Studio Basel hofft) und ob eine an Raumbilder geknüpfte Urbanität beim Publikum ebenso erstrebenswert sein wird wie ein Leben im Einfamilienhaus in einer steuergünstigen Zürichseegemeinde.
[ Die Schweiz - ein städtebauliches Porträt. Hrsg. ETH-Studio Basel, Institut Stadt der Gegenwart. Birkhäuser-Verlag, Basel 2005. 1020 S. (3 Bände und 1 Faltkarte), Fr. 68.-. ]
Für den Beitrag verantwortlich: Neue Zürcher Zeitung
Ansprechpartner:in für diese Seite: nextroom






