Artikel
Askese und Sinnlichkeit
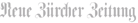
Ein Besuch im Atelier von Frédéric Dedelley
Seine Objekte sind funktional, ohne bloss vernünftig zu sein, seine Interieurs sind eigenständig, ohne den Raum zu dominieren. Dem in Zürich tätigen Westschweizer Designer Frédéric Dedelley gelingt es, Funktionalität mit Sinnlichkeit zu paaren.
3. Februar 2006
Er ist ein Mann der leisen Töne. Der Designer Frédéric Dedelley mag es weder laut noch auffällig. Davon zeugt auch sein Atelier, das versteckt in einem Hinterhof im Zürcher Kreis 4, nur ein paar Schritte von der lärmigen Langstrasse entfernt liegt. Im hellen Büro, das sich Dedelley mit Architekten teilt, herrscht eine ruhige, konzentrierte Atmosphäre. Prototypen, Pläne und Kartonmodelle zeugen davon, dass hier an einer Vielzahl von Projekten gleichzeitig gearbeitet wird. Seit zehn Jahren entwirft Dedelley für Unternehmen wie Dornbracht, Lehni, Driade oder Livit Möbel und Leuchten, inszeniert Ausstellungen, gestaltet Shops und Galerien. Ausserdem hat er seit 2001 eine Professur für Möbeldesign an der Basler Hochschule für Gestaltung inne. Ein Jahr zuvor war ihm als erstem Designer der Anerkennungspreis der Stiftung Max Bill - Georges Vantongerloo verliehen worden; und 2004 erhielt er den Eidgenössischen Designpreis. Nachdem Dedelley 1995 sein eigenes Atelier eröffnet hatte, vermochte er sich als Meister seines Fachs zu etablieren.
Ironie und Liebe zum Detail
Sein Weg führte Dedelley von der Westschweiz über Frankreich und Amerika nach Zürich. 1964 in Freiburg geboren, hatte er früh schon mit der Architektur geliebäugelt, dann davon geträumt, Autodesigner zu werden, sich schliesslich für ein Industriedesign-Studium an der Ecole cantonale d'art (Ecal) in Lausanne eingeschrieben und nach einem Wechsel ans Art Center College of Design von La-Tour-de-Peilz mit Auszeichnung abgeschlossen. Anfang der neunziger Jahre arbeitete er bei der Agentur Anatome in Paris an einem Orientierungssystem für den Louvre. Danach zog es ihn nach San Francisco. «Damit erfüllte ich mir einen Traum», sagt Dedelley. «Aber die wirtschaftliche Lage der dortigen Designbüros war schwierig, und zudem bekam ich schon bald Sehnsucht nach Europa.»
Da ihm Zürich als die «einzige wirkliche Grossstadt in der Schweiz» erschien, liess er sich nach seiner Rückkehr 1993 in der Limmatstadt nieder. Es war ein Kaltstart, denn viele Kontakte zur Deutschschweizer Designerszene hatte er nicht. Als Assistent von Jean-Pierre Dovat bei der Möbelfirma De Sede fand er den Einstieg in die Möbelbranche und das Ausstellungsdesign. Beides blieb für ihn bis heute wichtig. Zunächst finanzierte er seine Selbständigkeit mit Ausstellungsprojekten. Dann entstanden kleine, feine Objekte wie der Bestseller «Fleur». Mit diesem zarten Halter, einer Art überdimensionierter Büroklammer, lassen sich Blumen in jedem beliebigen Trinkglas fixieren. Eines der schönsten Objekte dieser Zeit ist der Stuhl «Playtime», den Dedelley für den Schweizer Beitrag an der Internationalen Gartenausstellung in China 1999 entwickelte. Der fest im Boden montierte Hocker mit den Löchern erweist nicht nur Hans Corays «Landi»-Stuhl seine Reverenz, sondern auch dem Melkschemel und ist darüber hinaus ein Paradebeispiel für die Designhaltung Dedelleys: In seinen Objekten paart sich Funktionalität mit leiser Ironie und viel Sinn fürs Detail. Dabei gelingt ihm scheinbar mühelos die Gratwanderung zwischen Askese und Sinnlichkeit.
Auf einer Ablage im Atelier sind Holzschalen und Trinkgefässe versammelt, in einer der Schalen liegen die leuchtend roten Anstecknadeln, die Dedelley für den Hochzeitspavillon «Oui!» an der Landesausstellung Expo 02 entworfen hat. «2002 war ein sehr wichtiges Jahr für mich», erklärt Dedelley. Es markierte den Durchbruch des Designers: Neben dem Expo-Pavillon richtete er das Zürcher Kleidergeschäft Fidelio ein und stattete die katholische Kirche St. Theresia am Zürcher Friesenberg aus (NZZ 23. 8. 02). Die Kirchgemeinde beauftragte ein Team mit dem Umbaukonzept von Fritz Metzgers klassisch modernem Bau aus dem Jahre 1932. Die Gestaltung der schlichten Möbel und Gegenstände für das Gotteshaus wurde Dedelley übertragen. Eine seltene Aufgabe für einen Designer, meint Dedelley: «Mich reizte es, Rituale und Symbole mit gestalterischen Mitteln zum Ausdruck zu bringen.»
Stimmungsvolle Sakralräume
Dies gelang ihm mit Bravour und brachte ihm einen Folgeauftrag ein: Derzeit arbeitet er an dem liturgischen Mobiliar für das reformierte Zürcher Neumünster, ein Meisterwerk des Klassizisten Leonhard Zeugheer mit einem 1912 von Alfred Friedrich Bluntschli umgestalteten Innenraum. «In dieser Kirche muss sich das Mobiliar behaupten - ohne jedoch zu dominieren», sieht Dedelley die gestalterische Herausforderung. Aus der Architektur leitet er die Kriterien für seine Entwürfe ab: So greifen die Möbel das Rautenmuster des Emporengeländers und der Fenster auf. Ein facettenartiges Minisystem, denn die Möbel sind reversibel konzipiert: Mal dienen sie als Rednerpult, mal als Kerzenständer oder Abendmahlstisch.
Dedelley versteht seine Arbeit immer auch als Experimentierfeld: als Ort der Auseinandersetzung mit dem Raum und der Suche nach dem formalen Ausdruck der Funktion. Er investiert viel Zeit in die Analyse. Für jeden Entwurf recherchiert er in der Designgeschichte ebenso wie auf dem Markt oder im Alltag. «Innovation hat etwas mit dem Versuch zu tun, neue Typologien zu erfinden», erklärt er. Bei der Entwurfsarbeit inspirieren ihn gerade die Einschränkungen. «Gibt es keine, muss man sich welche schaffen.» So stellte er sich beim Tablett «Turco», das 1995 ohne konkreten Auftrag entstand, die Aufgabe, die japanische Tee-Zeremonie in die westliche Kultur zu übersetzen. Heute wird das schlichte Holztablett mit dem klappbaren Drahtgriff von Driade produziert.
Ein klares Pflichtenheft hingegen gab es beim Aluminiumschrank «Haïku», den er 2004 für Lehni konzipierte: Die Grösse stand fest, zudem sollte der Schrank möglichst flexibel ausgestattet sein. «Ich wollte den Charakter des Objekts durch den Umgang mit der Funktion ausdrücken», erklärt Dedelley. Die Schranktüren öffnen sich dank seitlichen Scharnieren übereck. Dabei offenbart sich eine wohlkonzipierte Innenwelt, die Tablare und Schubladen scheinen dem Nutzer entgegenzukommen. Auch in den Details wie dem Krawattenspiegel erweist sich der Schrank als höchst raffiniert.
Einschränkung als Inspiration
Der Name dieses Entwurfs verrät Dedelleys Faszination für Japan. «Ich schätze an der japanischen Gestaltung die Liebe zur Perfektion und zum Detail», verrät der Gestalter. Im vergangenen Herbst war er das zweite Mal in Japan, wo er neue Kontakte knüpfen konnte. Nun hofft er, über seine Projekte dieses Land besser kennen zu lernen. Im Augenblick stehen jedoch Aufträge in der Schweiz an: Derzeit arbeitet Dedelley an neuen Möbelentwürfen für Wogg und Lehni und erarbeitet für das Tiefbauamt der Stadt Zürich einen mobilen Informationsträger. Er inszeniert im kommenden Frühjahr die Ausstellung «Gay chic» im Zürcher Museum für Gestaltung.
Ironie und Liebe zum Detail
Sein Weg führte Dedelley von der Westschweiz über Frankreich und Amerika nach Zürich. 1964 in Freiburg geboren, hatte er früh schon mit der Architektur geliebäugelt, dann davon geträumt, Autodesigner zu werden, sich schliesslich für ein Industriedesign-Studium an der Ecole cantonale d'art (Ecal) in Lausanne eingeschrieben und nach einem Wechsel ans Art Center College of Design von La-Tour-de-Peilz mit Auszeichnung abgeschlossen. Anfang der neunziger Jahre arbeitete er bei der Agentur Anatome in Paris an einem Orientierungssystem für den Louvre. Danach zog es ihn nach San Francisco. «Damit erfüllte ich mir einen Traum», sagt Dedelley. «Aber die wirtschaftliche Lage der dortigen Designbüros war schwierig, und zudem bekam ich schon bald Sehnsucht nach Europa.»
Da ihm Zürich als die «einzige wirkliche Grossstadt in der Schweiz» erschien, liess er sich nach seiner Rückkehr 1993 in der Limmatstadt nieder. Es war ein Kaltstart, denn viele Kontakte zur Deutschschweizer Designerszene hatte er nicht. Als Assistent von Jean-Pierre Dovat bei der Möbelfirma De Sede fand er den Einstieg in die Möbelbranche und das Ausstellungsdesign. Beides blieb für ihn bis heute wichtig. Zunächst finanzierte er seine Selbständigkeit mit Ausstellungsprojekten. Dann entstanden kleine, feine Objekte wie der Bestseller «Fleur». Mit diesem zarten Halter, einer Art überdimensionierter Büroklammer, lassen sich Blumen in jedem beliebigen Trinkglas fixieren. Eines der schönsten Objekte dieser Zeit ist der Stuhl «Playtime», den Dedelley für den Schweizer Beitrag an der Internationalen Gartenausstellung in China 1999 entwickelte. Der fest im Boden montierte Hocker mit den Löchern erweist nicht nur Hans Corays «Landi»-Stuhl seine Reverenz, sondern auch dem Melkschemel und ist darüber hinaus ein Paradebeispiel für die Designhaltung Dedelleys: In seinen Objekten paart sich Funktionalität mit leiser Ironie und viel Sinn fürs Detail. Dabei gelingt ihm scheinbar mühelos die Gratwanderung zwischen Askese und Sinnlichkeit.
Auf einer Ablage im Atelier sind Holzschalen und Trinkgefässe versammelt, in einer der Schalen liegen die leuchtend roten Anstecknadeln, die Dedelley für den Hochzeitspavillon «Oui!» an der Landesausstellung Expo 02 entworfen hat. «2002 war ein sehr wichtiges Jahr für mich», erklärt Dedelley. Es markierte den Durchbruch des Designers: Neben dem Expo-Pavillon richtete er das Zürcher Kleidergeschäft Fidelio ein und stattete die katholische Kirche St. Theresia am Zürcher Friesenberg aus (NZZ 23. 8. 02). Die Kirchgemeinde beauftragte ein Team mit dem Umbaukonzept von Fritz Metzgers klassisch modernem Bau aus dem Jahre 1932. Die Gestaltung der schlichten Möbel und Gegenstände für das Gotteshaus wurde Dedelley übertragen. Eine seltene Aufgabe für einen Designer, meint Dedelley: «Mich reizte es, Rituale und Symbole mit gestalterischen Mitteln zum Ausdruck zu bringen.»
Stimmungsvolle Sakralräume
Dies gelang ihm mit Bravour und brachte ihm einen Folgeauftrag ein: Derzeit arbeitet er an dem liturgischen Mobiliar für das reformierte Zürcher Neumünster, ein Meisterwerk des Klassizisten Leonhard Zeugheer mit einem 1912 von Alfred Friedrich Bluntschli umgestalteten Innenraum. «In dieser Kirche muss sich das Mobiliar behaupten - ohne jedoch zu dominieren», sieht Dedelley die gestalterische Herausforderung. Aus der Architektur leitet er die Kriterien für seine Entwürfe ab: So greifen die Möbel das Rautenmuster des Emporengeländers und der Fenster auf. Ein facettenartiges Minisystem, denn die Möbel sind reversibel konzipiert: Mal dienen sie als Rednerpult, mal als Kerzenständer oder Abendmahlstisch.
Dedelley versteht seine Arbeit immer auch als Experimentierfeld: als Ort der Auseinandersetzung mit dem Raum und der Suche nach dem formalen Ausdruck der Funktion. Er investiert viel Zeit in die Analyse. Für jeden Entwurf recherchiert er in der Designgeschichte ebenso wie auf dem Markt oder im Alltag. «Innovation hat etwas mit dem Versuch zu tun, neue Typologien zu erfinden», erklärt er. Bei der Entwurfsarbeit inspirieren ihn gerade die Einschränkungen. «Gibt es keine, muss man sich welche schaffen.» So stellte er sich beim Tablett «Turco», das 1995 ohne konkreten Auftrag entstand, die Aufgabe, die japanische Tee-Zeremonie in die westliche Kultur zu übersetzen. Heute wird das schlichte Holztablett mit dem klappbaren Drahtgriff von Driade produziert.
Ein klares Pflichtenheft hingegen gab es beim Aluminiumschrank «Haïku», den er 2004 für Lehni konzipierte: Die Grösse stand fest, zudem sollte der Schrank möglichst flexibel ausgestattet sein. «Ich wollte den Charakter des Objekts durch den Umgang mit der Funktion ausdrücken», erklärt Dedelley. Die Schranktüren öffnen sich dank seitlichen Scharnieren übereck. Dabei offenbart sich eine wohlkonzipierte Innenwelt, die Tablare und Schubladen scheinen dem Nutzer entgegenzukommen. Auch in den Details wie dem Krawattenspiegel erweist sich der Schrank als höchst raffiniert.
Einschränkung als Inspiration
Der Name dieses Entwurfs verrät Dedelleys Faszination für Japan. «Ich schätze an der japanischen Gestaltung die Liebe zur Perfektion und zum Detail», verrät der Gestalter. Im vergangenen Herbst war er das zweite Mal in Japan, wo er neue Kontakte knüpfen konnte. Nun hofft er, über seine Projekte dieses Land besser kennen zu lernen. Im Augenblick stehen jedoch Aufträge in der Schweiz an: Derzeit arbeitet Dedelley an neuen Möbelentwürfen für Wogg und Lehni und erarbeitet für das Tiefbauamt der Stadt Zürich einen mobilen Informationsträger. Er inszeniert im kommenden Frühjahr die Ausstellung «Gay chic» im Zürcher Museum für Gestaltung.
Für den Beitrag verantwortlich: Neue Zürcher Zeitung
Ansprechpartner:in für diese Seite: nextroom






