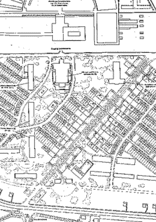Artikel
Nicht nur zur Abwechslung

Das Unprätentiöse hat auf dem Jahrmarkt der Eitelkeiten keinen Platz. Effekthascherei sichert publizistische Aufmerksamkeit. Ganz anders Hermann Czech: Seine Texte zur Architektur sind ein Plädoyer für substantielle Skepsis.
11. Januar 1997 - Walter Zschokke
Die Zeiten, da man sich bei oder mündlichen Äußerungen zur mit aus dem Zusammenhang gerissenen Zitaten von Adolf Loos zu schmücken beliebte, sind längst vorüber. Auch jener Satz von Josef Frank „das Haus als Weg und Platz“ wird nur noch selten für ohnehin meist schlecht passende Gelegenheiten bemüht. Selbst das eindimensionale Mißverstehen von Otto Wagners Theorien zur Stadt ist aus der Mode gekommen. Und was Gottfried Semper eigentlich gemeint hat seiner Bekleidungstheorie, war glücklicherweise schon immer schwer auffindbar festgehalten, sodaß ein detailliertes Zitat sich von selbst erübrigte.
Zum einen ist es ja angenehm, daß nicht mehr für jedes Geschreibsel oder Gefasel ein Satz aus der Feder eines weit größeren Denkers zur dilettantischen Auffettung herhalten muß. Andererseits entfernen sich heutige Architekturtendenzen zunehmend von Geschichtlichkeit und auf das Leben bezogenen Inhalten der eigenen Disziplin.
Unter dem Qualifikationsstrich geschieht dies nicht nur zum Schaden der Produkte, denn die postmoderne Zitiererei historischer Stilmerkmale war so schnell penetrant und platt geworden, daß sie qualitativ nicht für geglückte Versuche in dieser Richtung taugte. Aber ist die Ignoranz gegenüber der Geschichte der eigenen Disziplin nicht ihrerseits ein Historismus? Die Geschichtsfeindlichkeit der frühen Moderne in den zwanziger Jahren ist bekannt. Sie wurde aber getragen von Exponenten, die diese ihre Geschichte sehr wohl noch intus hatten. Erst die zweite Generation, die Nachbeter, die keinen bewußten Emanzipationsprozeß durchgemacht hatten, womit sie ihre Ablehnung hätten begründen können, kannten außer den modernen Mythen keine Vergangenheit mehr.
Auch ein Charles-Edouard Jeanneret alias Le Corbusier hatte, wie wir bei Adolf Max Vogt nachlesen können, noch seine Geschichte gelernt. Am erfolgreichsten war Le Corbusier aber in der Promotion seiner selbst. Ihm gelang es wie nur wenigen, seinen Namen aus dem engen Käfig der Fachkommunikation auf den allgemeinen Markt zu werfen.
Die Frage, ob es bezogen auf die architektonische Qualität ein gutes oder ein schlechtes Zeichen sei, wenn heute die Berichterstattung über ein aktuelles Bauwerk vom Feuilleton in die „vermischten Meldungen“ rutscht, wird im Einzelfall zu klären sein. Jedenfalls lassen sich mehrere Mittel und Wege erkennen, mit denen versucht wird, vergleichbare Bekanntheit zu erlangen. Ein erstes Prinzip, der Personalstil, läßt sich am Beispiel Mario Bottas aufzeigen oder an dem O. M. Ungers oder Richard Meiers. Ihre Bauten sind in Sekundenbruchteilen auf Grund von Stilmerkmalen zu identifizieren, wie fast jede und jeder heutzutage einen griechischen Tempel von einer gotischen Kathedrale zu unterscheiden vermag.
Eine Selbstreferenz dieser Art wird von gut dressierten Ateliers durch jahrelange Selbstwiederholung erreicht, sodaß letztlich auch ein Schweizer Bundesrat seinen Botta auf Anhieb zu erkennen vermag. Bei soviel subjektiv fixiertem Anteil ist natürlich der Spielraum für ein Eingehen auf die besonderen Umstände des Ortes gering, weshalb Vertreter einer derartigen Taktik die Auseinandersetzung mit dem Ort bereits in der Theoriebildung ausschließen. In aller Regel sind sie in ihrer eigenen Optik jene, die den Ort erst schaffen. Ihre Epigonen können dann unbedarft erklären, die Sache mit „dem Ort“ sei schlicht vorbei: „out of time“; wahrscheinlich, weil sie vor lauter Blindheit außer ihrem Eingriff gar keine „Orte“ wahrnehmen können.
Ein zweites Prinzip ist die Zuspitzung des Entwurfs auf einen demonstrativen Effekt, dem alles andere untergeordnet wird. Diese Maßnahme erlaubt den Betrachtern, sich im guten Glauben zu wiegen, sie hätten bereits das abgebildete Bauwerk auf Anhieb verstanden - denn wer wird offensive Augenfälligkeiten übersehen?
Ein längeres Sichbefassen mit dem Gegenstand entfällt; Sachverhalt und Symbol kommen zur Deckung, alles übrige ist Zeitverlust. Als Vertreter dieses Vorgehens darf etwa Philip Johnson angesprochen werden, dessen „Effekte“ ihm immer wieder Publizität sicherten; leider fällt auch Frank O. Gehrys jüngster Bau, „Ginger & Fred“ in Prag, unter diese Masche. Und an der Architectural Association in London scheint das effektbetonte Entwerfen als Königsdisziplin gelehrt zu werden.
Als ein drittes Verfahren, Bekanntheit zu fördern, hat sich die Übernahme bereits erfolgreicher Konzepte aus anderen Disziplinen eingebürgert. Dabei darf man nicht zu bescheiden sein: Relativitätstheorie, Minimal art, Viren, die Umstülpung der Zelle beim Entwicklungsvorgang des Lebens und so weiter sind das mindeste. Nur allgemein popularisiert sollte ein solcher Ansatz sein. Irgendwelche nobelpreiswürdigen Themen aus den siebziger oder achtziger Jahren taugen dazu wenig, weil sich niemand daran erinnern kann. Am besten stammen die Quellen bereits ihrerseits aus dem Segment „Vermischte Meldungen“ auf der letzten Seite großer internationaler Blätter, dann traut sich nämlich niemand danach zu fragen, ob sachliche Gründe für die Wahl gerade dieses Konzepts sprechen, weil man nicht als uninformiert gelten will.
Dieses dritte Vorgehen ist vor allem bei jüngeren Berufsvertretern anzutreffen, deren Startum zwar noch verborgen, deren zur Schau getragenes Selbstbewußtsein aber bereits voll entfaltet ist. Aber im täglichen Hickhack um publizistische Zuwendung darf man nicht zimperlich sein. Es gibt sowieso zu viele Architekten.
Mit den genannten Prinzipien glauben nun manche zu Publizität und entsprechender Bekanntheit gelangen zu können, und die Publizistik spielt mit. Leichte Faßlichkeit ist in; klar im Out sind: komplexes Herangehen an Probleme und vernetzendes Denken, Berücksichtigen der Geschichte (des Ortes, des Bauwerks, der zu beherbergenden Institution, der Stadt, der Gesellschaft und so weiter), Einbeziehen der stadträumlich- städtebaulichen Zusammenhänge, Nachdenken über alltägliche und profane Bedürfnisse und anderes mehr.
Ganz daneben sind heute Zurückhaltung und Bescheidenheit, etwa das Stellen der Frage, ob denn bereits der bauliche Aspekt einer Problematik im Vordergrund steht oder ob nicht zuerst wichtige Programmfragen geklärt werden müßten, bevor es ans Bauen gehen kann. Programmfragen sind jener Bereich, vor dem sich Politiker so gern drücken; den sie nicht selten ganz gern den Architekten zuschieben, um Verantwortliche zu haben, damit sie selber aus dem Schußfeld sind. Weil der Architekt - da es sein Beruf ist - bauen muß, um zu überleben, wird er sich für den Auftrag und den Bau abstrampeln und Probleme einer Lösung zuführen, die gar nicht in sein Ressort fallen, nur damit endlich etwas weitergeht.
Das Unprätentiöse und das Selbstverständliche haben auf dem Jahrmarkt der Eitelkeiten keinen Platz. Als Resultat eines insistierenden kritischen Befragens sind derartige Bauten mit den Erwartungshaltungen einer nach Sensationen dürstenden Öffentlichkeit nicht zur Deckung zu bringen. Aber auch wenn es noch so viele versuchen, halte ich alle Versuche, auf einfachem Weg zu Bekanntheit zu gelangen, für Irrwege, weil sie zu platt sind. Das Bauen und die Architektur sind einfach komplexer, weil mit dem Leben verknüpft.
Als passender, viel umfassenderer Diskussionsbeitrag in der aktuellen Unübersichtlichkeit sind deshalb die bereits 1977 erstmals erschienenen Aufsätze und Kommentare von Hermann Czech wieder verfügbar und um einige seither verfaßte Texte erweitert worden („Zur Abwechslung“, Löcker Verlag, Wien). Die mit scharf gespitzter Feder verfaßten Arbeiten aus den sechziger und siebziger Jahren weisen Czech als damals bereits fundierten Kenner und skeptischen Befrager aus. Er wollte es genau wissen und stellte auch nach gegebenen Antworten weitere Fragen, die treffsicher die unklaren Stellen in den Argumentationen der anderen sichtbar werden ließen.
In den neueren Beiträgen werden unter anderem Czechs städtebauliche Konzeptionen erläutert, die - „möglichst nahe an das Leben heran“ - sich nicht um die modischen „Tapetenmuster“ der Lagepläne kümmern und auch nicht pathetisch brustaufreißerisch daherkommen, wie dies Daniel Libeskind nötig zu haben vermeint, der Czech seinen berechtigten Erfolg im Oranienburger Wettbewerb aus eigensüchtigen Gründen miesgemacht hat.
Hermann Czechs Texte lesen sich mit dauerhaftem Gewinn, sie bleiben nicht in der Polemik stecken, enthalten zündenden Hintersinn und stehen für die positive Tradition des von langem Residenzstadt-Byzantinismus geprägten Wiener Skeptizismus. Czech ist aber kein Schwarzseher; er glaubt an Auswege, allein schon deshalb, weil er das Leben auf seiner Seite weiß.
Ein Ratschlag für 1997 an die befugten und beeideten wie die wilden Mitglieder der Zunft: Bei künftigen Erläuterungen ab und zu ein Czech-Zitat einfließen zu lassen dürfte nicht schaden. Denn die Phase, in der jede schriftliche und mündliche Äußerung zur Architektur irgendwo irgendwie ein Czech-Zitat enthalten muß, kommt bestimmt. Viel besser allerdings wäre es, Czechs Aufsätze „Zur Abwechslung“ und auch jene von Loos, Frank und anderen, des Inhalts, nicht des Zitierens wegen zu lesen. Und sich dann wieder zu melden, wenn man etwas Substantielles zur Diskussion beizutragen weiß.
Analog zu Czechs Diktum, daß Architektur Ruhe geben, ihre Hintergrundrolle tragen und erst reden solle, wenn sie - vom Leben - gefragt wird.
Zum einen ist es ja angenehm, daß nicht mehr für jedes Geschreibsel oder Gefasel ein Satz aus der Feder eines weit größeren Denkers zur dilettantischen Auffettung herhalten muß. Andererseits entfernen sich heutige Architekturtendenzen zunehmend von Geschichtlichkeit und auf das Leben bezogenen Inhalten der eigenen Disziplin.
Unter dem Qualifikationsstrich geschieht dies nicht nur zum Schaden der Produkte, denn die postmoderne Zitiererei historischer Stilmerkmale war so schnell penetrant und platt geworden, daß sie qualitativ nicht für geglückte Versuche in dieser Richtung taugte. Aber ist die Ignoranz gegenüber der Geschichte der eigenen Disziplin nicht ihrerseits ein Historismus? Die Geschichtsfeindlichkeit der frühen Moderne in den zwanziger Jahren ist bekannt. Sie wurde aber getragen von Exponenten, die diese ihre Geschichte sehr wohl noch intus hatten. Erst die zweite Generation, die Nachbeter, die keinen bewußten Emanzipationsprozeß durchgemacht hatten, womit sie ihre Ablehnung hätten begründen können, kannten außer den modernen Mythen keine Vergangenheit mehr.
Auch ein Charles-Edouard Jeanneret alias Le Corbusier hatte, wie wir bei Adolf Max Vogt nachlesen können, noch seine Geschichte gelernt. Am erfolgreichsten war Le Corbusier aber in der Promotion seiner selbst. Ihm gelang es wie nur wenigen, seinen Namen aus dem engen Käfig der Fachkommunikation auf den allgemeinen Markt zu werfen.
Die Frage, ob es bezogen auf die architektonische Qualität ein gutes oder ein schlechtes Zeichen sei, wenn heute die Berichterstattung über ein aktuelles Bauwerk vom Feuilleton in die „vermischten Meldungen“ rutscht, wird im Einzelfall zu klären sein. Jedenfalls lassen sich mehrere Mittel und Wege erkennen, mit denen versucht wird, vergleichbare Bekanntheit zu erlangen. Ein erstes Prinzip, der Personalstil, läßt sich am Beispiel Mario Bottas aufzeigen oder an dem O. M. Ungers oder Richard Meiers. Ihre Bauten sind in Sekundenbruchteilen auf Grund von Stilmerkmalen zu identifizieren, wie fast jede und jeder heutzutage einen griechischen Tempel von einer gotischen Kathedrale zu unterscheiden vermag.
Eine Selbstreferenz dieser Art wird von gut dressierten Ateliers durch jahrelange Selbstwiederholung erreicht, sodaß letztlich auch ein Schweizer Bundesrat seinen Botta auf Anhieb zu erkennen vermag. Bei soviel subjektiv fixiertem Anteil ist natürlich der Spielraum für ein Eingehen auf die besonderen Umstände des Ortes gering, weshalb Vertreter einer derartigen Taktik die Auseinandersetzung mit dem Ort bereits in der Theoriebildung ausschließen. In aller Regel sind sie in ihrer eigenen Optik jene, die den Ort erst schaffen. Ihre Epigonen können dann unbedarft erklären, die Sache mit „dem Ort“ sei schlicht vorbei: „out of time“; wahrscheinlich, weil sie vor lauter Blindheit außer ihrem Eingriff gar keine „Orte“ wahrnehmen können.
Ein zweites Prinzip ist die Zuspitzung des Entwurfs auf einen demonstrativen Effekt, dem alles andere untergeordnet wird. Diese Maßnahme erlaubt den Betrachtern, sich im guten Glauben zu wiegen, sie hätten bereits das abgebildete Bauwerk auf Anhieb verstanden - denn wer wird offensive Augenfälligkeiten übersehen?
Ein längeres Sichbefassen mit dem Gegenstand entfällt; Sachverhalt und Symbol kommen zur Deckung, alles übrige ist Zeitverlust. Als Vertreter dieses Vorgehens darf etwa Philip Johnson angesprochen werden, dessen „Effekte“ ihm immer wieder Publizität sicherten; leider fällt auch Frank O. Gehrys jüngster Bau, „Ginger & Fred“ in Prag, unter diese Masche. Und an der Architectural Association in London scheint das effektbetonte Entwerfen als Königsdisziplin gelehrt zu werden.
Als ein drittes Verfahren, Bekanntheit zu fördern, hat sich die Übernahme bereits erfolgreicher Konzepte aus anderen Disziplinen eingebürgert. Dabei darf man nicht zu bescheiden sein: Relativitätstheorie, Minimal art, Viren, die Umstülpung der Zelle beim Entwicklungsvorgang des Lebens und so weiter sind das mindeste. Nur allgemein popularisiert sollte ein solcher Ansatz sein. Irgendwelche nobelpreiswürdigen Themen aus den siebziger oder achtziger Jahren taugen dazu wenig, weil sich niemand daran erinnern kann. Am besten stammen die Quellen bereits ihrerseits aus dem Segment „Vermischte Meldungen“ auf der letzten Seite großer internationaler Blätter, dann traut sich nämlich niemand danach zu fragen, ob sachliche Gründe für die Wahl gerade dieses Konzepts sprechen, weil man nicht als uninformiert gelten will.
Dieses dritte Vorgehen ist vor allem bei jüngeren Berufsvertretern anzutreffen, deren Startum zwar noch verborgen, deren zur Schau getragenes Selbstbewußtsein aber bereits voll entfaltet ist. Aber im täglichen Hickhack um publizistische Zuwendung darf man nicht zimperlich sein. Es gibt sowieso zu viele Architekten.
Mit den genannten Prinzipien glauben nun manche zu Publizität und entsprechender Bekanntheit gelangen zu können, und die Publizistik spielt mit. Leichte Faßlichkeit ist in; klar im Out sind: komplexes Herangehen an Probleme und vernetzendes Denken, Berücksichtigen der Geschichte (des Ortes, des Bauwerks, der zu beherbergenden Institution, der Stadt, der Gesellschaft und so weiter), Einbeziehen der stadträumlich- städtebaulichen Zusammenhänge, Nachdenken über alltägliche und profane Bedürfnisse und anderes mehr.
Ganz daneben sind heute Zurückhaltung und Bescheidenheit, etwa das Stellen der Frage, ob denn bereits der bauliche Aspekt einer Problematik im Vordergrund steht oder ob nicht zuerst wichtige Programmfragen geklärt werden müßten, bevor es ans Bauen gehen kann. Programmfragen sind jener Bereich, vor dem sich Politiker so gern drücken; den sie nicht selten ganz gern den Architekten zuschieben, um Verantwortliche zu haben, damit sie selber aus dem Schußfeld sind. Weil der Architekt - da es sein Beruf ist - bauen muß, um zu überleben, wird er sich für den Auftrag und den Bau abstrampeln und Probleme einer Lösung zuführen, die gar nicht in sein Ressort fallen, nur damit endlich etwas weitergeht.
Das Unprätentiöse und das Selbstverständliche haben auf dem Jahrmarkt der Eitelkeiten keinen Platz. Als Resultat eines insistierenden kritischen Befragens sind derartige Bauten mit den Erwartungshaltungen einer nach Sensationen dürstenden Öffentlichkeit nicht zur Deckung zu bringen. Aber auch wenn es noch so viele versuchen, halte ich alle Versuche, auf einfachem Weg zu Bekanntheit zu gelangen, für Irrwege, weil sie zu platt sind. Das Bauen und die Architektur sind einfach komplexer, weil mit dem Leben verknüpft.
Als passender, viel umfassenderer Diskussionsbeitrag in der aktuellen Unübersichtlichkeit sind deshalb die bereits 1977 erstmals erschienenen Aufsätze und Kommentare von Hermann Czech wieder verfügbar und um einige seither verfaßte Texte erweitert worden („Zur Abwechslung“, Löcker Verlag, Wien). Die mit scharf gespitzter Feder verfaßten Arbeiten aus den sechziger und siebziger Jahren weisen Czech als damals bereits fundierten Kenner und skeptischen Befrager aus. Er wollte es genau wissen und stellte auch nach gegebenen Antworten weitere Fragen, die treffsicher die unklaren Stellen in den Argumentationen der anderen sichtbar werden ließen.
In den neueren Beiträgen werden unter anderem Czechs städtebauliche Konzeptionen erläutert, die - „möglichst nahe an das Leben heran“ - sich nicht um die modischen „Tapetenmuster“ der Lagepläne kümmern und auch nicht pathetisch brustaufreißerisch daherkommen, wie dies Daniel Libeskind nötig zu haben vermeint, der Czech seinen berechtigten Erfolg im Oranienburger Wettbewerb aus eigensüchtigen Gründen miesgemacht hat.
Hermann Czechs Texte lesen sich mit dauerhaftem Gewinn, sie bleiben nicht in der Polemik stecken, enthalten zündenden Hintersinn und stehen für die positive Tradition des von langem Residenzstadt-Byzantinismus geprägten Wiener Skeptizismus. Czech ist aber kein Schwarzseher; er glaubt an Auswege, allein schon deshalb, weil er das Leben auf seiner Seite weiß.
Ein Ratschlag für 1997 an die befugten und beeideten wie die wilden Mitglieder der Zunft: Bei künftigen Erläuterungen ab und zu ein Czech-Zitat einfließen zu lassen dürfte nicht schaden. Denn die Phase, in der jede schriftliche und mündliche Äußerung zur Architektur irgendwo irgendwie ein Czech-Zitat enthalten muß, kommt bestimmt. Viel besser allerdings wäre es, Czechs Aufsätze „Zur Abwechslung“ und auch jene von Loos, Frank und anderen, des Inhalts, nicht des Zitierens wegen zu lesen. Und sich dann wieder zu melden, wenn man etwas Substantielles zur Diskussion beizutragen weiß.
Analog zu Czechs Diktum, daß Architektur Ruhe geben, ihre Hintergrundrolle tragen und erst reden solle, wenn sie - vom Leben - gefragt wird.
Für den Beitrag verantwortlich: Spectrum
Ansprechpartner:in für diese Seite: nextroom