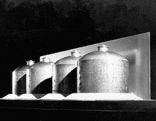Artikel
Was bleibt, wenn nichts bleibt?

Bis zum Rand sollen sie mit Nutzungen gefüllt werden, die Simmeringer Gasometer, Industriedenkmäler der Gründerzeit. Wer kann so blauäugig sein, zu glauben, daß dabei von ihren singulären Qualitäten irgend etwas erhalten bleibt? Eine Erregung.
20. Juli 1996 - Liesbeth Waechter-Böhm
Als Farce hat es begonnen, als Tragödie wird es dereinst enden, wenn all das tatsächlich gemacht werden sollte, was derzeit an Projekten für die Umnutzung der Simmeringer Gasometer auf dem Tisch liegt. Denn über eines kann es keine Unklarheit geben: Dieses „einmalige“ Industriedenkmal, das „Wahrzeichen“ von Simmering, über dessen Erhaltungswürdigkeit sich alle so einig sind und dessen Erhaltung durch die neue Nutzung ja auch finanziert werden soll, dieses Wahrzeichen und Industriedenkmal ist dann ruiniert. Und zwar für alle Zeit.
Worin besteht die besondere Qualität der vier Gasometer? Vor allem in diesem gewaltigen, leeren Raum (er hat einen Außendurchmesser von immerhin 64,9 Metern und an der höchsten Stelle eine Höhe von 72,5 Metern) - und dann auch darin, daß es sich um signifikante, intakte Beispiele für die Industriearchitektur der Gründerzeit handelt.
Genau diese beiden Qualitäten würden durch die Realisierung der jetzt vorliegenden Projekte zerstört: Der Innenraum, der so groß ist, daß das ganze Riesenrad hineinpassen würde - wie es immer wieder heißt -, der würde dann bis an den Rand mit Nutzungen gefüllt sein: mit Geschäften, Büros, Lagerräumen, Gastronomie, einem Kindergarten, einem Veranstaltungssaal für 3000 Besucher, einer „Day-Mall“, einer „Night-Mall“ (was auch immer das bedeuten soll) und mit insgesamt mehr als 900 Wohnungen. Es kann niemand so blauäugig sein, zu glauben, daß unter diesen Umständen von der innenräumlichen Qualität der Gasometer irgend etwas erhalten bleibt.
Aber auch der architektonische Wert der äußeren Erscheinung wird durch diese Art der „Revitalisierung“ nicht erhalten, sondern drangsaliert. Man braucht nämlich zusätzliche Öffnungen im Ziegelmauerwerk, das immerhin zwischen 5,4 und 1,65 Meter dick ist, weil man sonst niemals auch nur annähernd akzeptable Lichtverhältnisse erreicht. Diese Öffnungen wird man dort ins denkmalgeschützte Gemäuer schneiden dürfen, wo es „vorgegebene bauliche Vertiefungen“ gibt, etwa innerhalb der arkadenähnlichen Bogenstellungen unter dem Hauptgesims oder den darunterliegenden Konsolen; sie können aber auch „im Sinne einer architektonischen ,Schattenführung‘ entlang der strebepfeilerartigen Lisenen“ geführt werden. Die Zitate entstammen übrigens der Beschreibung des denkmalpflegerischen Konzepts in der Publikation dieses „Revitalisierungsprojekts“.
Durch diese zusätzlichen Öffnungen wird man aber noch immer bei weitem nicht genug Licht in den Innenraum holen können. Daher darf entweder „eine Öffnung der Dachfläche“ vorgenommen werden - oder es darf diese „Dachfläche in fix montierte Glaslamellen aufgelöst“ werden. Wenn also weder das markante Dach mit seiner Laterne unangetastet bleibt noch das kreisrunde Mauerwerk - was ist dann eigentlich noch übrig vom Bestand? Die Haltung des Bundesdenkmalamtes in dieser Causa wäre einen eigenen Kommentar wert. Vielleicht ist es ja auch wahr, was als Gerücht in Wiener Architektenkreisen die Runde macht: Man brauche ein Projekt nur zu „wehdornisieren“ - und schon sei es auch denkmalpflegerisch „gelaufen“.
Gegen dieses Vorhaben lassen sich allerdings keineswegs nur denkmalschützerische Argumente ins Treffen führen. Es spottet auch in anderer Hinsicht jeglicher Vernunft. Die Frage der Finanzierbarkeit zum Beispiel, die ist durchaus ein paar Überlegungen wert. Wieviel an baulichen Maßnahmen ist denn nötig, wenn man die Gasometer füllen will? Es muß die Außenfassade saniert werden, es muß die Innenfassade saniert werden. Das kuppelförmige Dach mit seiner Spannweite von 63,8 Metern muß weg und durch irgend etwas anderes ersetzt werden.
Jeder Gasometer hat im geböschten Bereich ein Wasserbassin mit einem 1,7 Meter dicken, nach oben bombierten Betonfundament. Das muß natürlich auch weg, denn man wird ein neues Fundament brauchen. Das Mauerwerk des Bestands hatte ja bisher keine wesentlichen statischen Funktionen zu erfüllen, also kann man es auch in Hinkunft nicht belasten. Die neuen Einbauten müssen daher selbsttragend sein.
Und dann das Bauen selbst: Es wird doch wohl niemand ernsthaft behaupten wollen, daß Bauen im umbauten Raum nicht wesentlich aufwendiger ist als das Bauen auf der grünen Wiese. Aber eigenartig, trotzdem soll dieses Bauvorhaben zu den Bedingungen der Wiener Wohnbauförderung realisierbar sein. Wenn das möglich ist, dann kann man daraus nur einen Schluß ziehen: Wir wurden bisher mutwillig getäuscht. Wenn das alles möglich ist, dann haben wir in den letzten zehn Jahren bei jedem einzelnen Wohnbau eine erkleckliche Summe verschwendet. Dann wäre es bei gleichem Standard auch viel billiger gegangen. Und damit kommen wir zu einem dritten Stichwort: dem Standard. Der Wiener Wohnbau hat ein hohes Niveau, und darauf hat sich die Stadt bisher auch etwas zugute gehalten. Aber wie wird das in den Gasometern sein? Bisher zum Beispiel haben Architekten die größten Anstrengungen in die Orientierung ihrer Wohnungen investiert. Eine nach Norden gerichtete Wohnung galt als Sakrileg. In den Gasometern wird es jede Menge nach Norden gerichteter Wohnungen geben. Und auch solche, die einfach nicht gut belichtet sein können, weil sie in den unteren Wohngeschossen liegen. Und sie werden alle keinen freien Ausblick haben, weil ihnen eben doch nur eine Wand mit Löchern oder der Nachbar beziehungsweise das Visavis vor Augen steht. Die jetzt publizierte Lesart dieses Faktums besagt zwar, daß gerade darin eine Qualität liege, weil die Umgebung so beschaffen sei, daß erst der fragmentierte Blick sie wirklich erträglich mache, aber wenn das nicht der schiere Zynismus ist . . .
Man muß sich auch klarmachen: Die schönen Architektenzeichnungen mit den großzügigen Innenhöfen täuschen. Und ob der Grünbereich im Projekt Wilhelm Holzbauers überhaupt machbar ist, das ziehen zumindest fachkundige Landschaftsplaner in Zweifel, weil bei dieser Gebäudekonfiguration in den Hof zuwenig Licht fallen dürfte. Dann die Akustik: In den Gasometern wird einiges an Aufwand nötig sein, damit nicht jedes Türknallen gleich eine explosionsartige Geräuschkatastrophe verursacht. Wobei es ausdrücklich festzuhalten gilt, daß es hier nicht um die Schwächen oder Mängel einzelner Projekte geht - schon der grundlegende Konzeptansatz ist falsch.
Freilich kann man den beteiligten Architekten den Vorwurf nicht ersparen, daß sie sich überhaupt auf das Ansinnen eingelassen haben, die Gasometer mit Wohnungen vollzustopfen. Natürlich ist es möglich, für historische Bauwerke neue Nutzungen zu entwickeln. Aber wenn diese Interventionen substantielle Qualitäten des Bestands zerstören, dann kehrt sich der scheinbar gutwillige und verantwortungsbewußte Akt der Erhaltung zur sinnlosen und verlogenen Alibigeste um. Und das müßten Architekten wie Jean Nouvel, Wilhelm Holzbauer, Manfred Wehdorn und die Coop Himmelb(l)au eigentlich wissen.
Die einzigen, die mit ihren Projekten so etwas wie Haltung demonstriert haben, sind Peichl & Weber und Hermann & Valentiny; sie haben immerhin darauf hingewiesen, daß man die Wohnungen genausogut oder sogar besser „draußen“ realisieren könnte. Besonders im Projekt von Hermann & Valentiny ist eine bestechende Alternative zu den Vorhaben zu erkennen, die tatsächlich gebaut werden sollen. Die beiden setzen mit ihrem „horizontal geschichteten“ Hochhaus, einer unheimlich mächtigen, die Gasometer sogar noch überragenden Gebäudewand, ein architektonischen Zeichen, das den historischen Bauwerken sozusagen die Reverenz erweist.
Die Gasometer selbst bleiben in diesem Projekt weitgehend frei: Sie sind Parkplätzen vorbehalten, die man in jedem Fall braucht, und sie bieten ein konzentriertes Angebot an Infrastruktur - von der Veranstaltungshalle bis zum Kindergarten und zur Schule. Bei einem der Gasometer wird dabei übrigens eine Glasüberdachung vorgeschlagen, die Bausubstanz also ebenfalls angetastet.
Und die Idee dahinter? Man macht drinnen 880 Stellplätze und auf diesen Stellplätzen einen Park, also in einer Höhe, in der - wie Landschaftsplaner meinen - tatsächlich etwas wachsen kann. Schließlich wird es in der Umgebung mit Freiflächen für die hier Wohnenden schwer werden: Der kontaminierte Boden des ehemaligen Gaswerks dürfte wohl kaumein guter Spielplatz sein. Bürgermeister Häupl hat in seinem Vorwort zur Publikation über das „Revitalisierungsprojekt“ Gasometer geschrieben, es gebe in Wien genug Platz für unkonventionelle Ideen. Da muß man ihn - angesichts dieses Vorhabens - korrigieren. Nein, es gibt nicht genug Platz, und es gibt auch nicht genug unkonventionelle Ideen.
Worin besteht die besondere Qualität der vier Gasometer? Vor allem in diesem gewaltigen, leeren Raum (er hat einen Außendurchmesser von immerhin 64,9 Metern und an der höchsten Stelle eine Höhe von 72,5 Metern) - und dann auch darin, daß es sich um signifikante, intakte Beispiele für die Industriearchitektur der Gründerzeit handelt.
Genau diese beiden Qualitäten würden durch die Realisierung der jetzt vorliegenden Projekte zerstört: Der Innenraum, der so groß ist, daß das ganze Riesenrad hineinpassen würde - wie es immer wieder heißt -, der würde dann bis an den Rand mit Nutzungen gefüllt sein: mit Geschäften, Büros, Lagerräumen, Gastronomie, einem Kindergarten, einem Veranstaltungssaal für 3000 Besucher, einer „Day-Mall“, einer „Night-Mall“ (was auch immer das bedeuten soll) und mit insgesamt mehr als 900 Wohnungen. Es kann niemand so blauäugig sein, zu glauben, daß unter diesen Umständen von der innenräumlichen Qualität der Gasometer irgend etwas erhalten bleibt.
Aber auch der architektonische Wert der äußeren Erscheinung wird durch diese Art der „Revitalisierung“ nicht erhalten, sondern drangsaliert. Man braucht nämlich zusätzliche Öffnungen im Ziegelmauerwerk, das immerhin zwischen 5,4 und 1,65 Meter dick ist, weil man sonst niemals auch nur annähernd akzeptable Lichtverhältnisse erreicht. Diese Öffnungen wird man dort ins denkmalgeschützte Gemäuer schneiden dürfen, wo es „vorgegebene bauliche Vertiefungen“ gibt, etwa innerhalb der arkadenähnlichen Bogenstellungen unter dem Hauptgesims oder den darunterliegenden Konsolen; sie können aber auch „im Sinne einer architektonischen ,Schattenführung‘ entlang der strebepfeilerartigen Lisenen“ geführt werden. Die Zitate entstammen übrigens der Beschreibung des denkmalpflegerischen Konzepts in der Publikation dieses „Revitalisierungsprojekts“.
Durch diese zusätzlichen Öffnungen wird man aber noch immer bei weitem nicht genug Licht in den Innenraum holen können. Daher darf entweder „eine Öffnung der Dachfläche“ vorgenommen werden - oder es darf diese „Dachfläche in fix montierte Glaslamellen aufgelöst“ werden. Wenn also weder das markante Dach mit seiner Laterne unangetastet bleibt noch das kreisrunde Mauerwerk - was ist dann eigentlich noch übrig vom Bestand? Die Haltung des Bundesdenkmalamtes in dieser Causa wäre einen eigenen Kommentar wert. Vielleicht ist es ja auch wahr, was als Gerücht in Wiener Architektenkreisen die Runde macht: Man brauche ein Projekt nur zu „wehdornisieren“ - und schon sei es auch denkmalpflegerisch „gelaufen“.
Gegen dieses Vorhaben lassen sich allerdings keineswegs nur denkmalschützerische Argumente ins Treffen führen. Es spottet auch in anderer Hinsicht jeglicher Vernunft. Die Frage der Finanzierbarkeit zum Beispiel, die ist durchaus ein paar Überlegungen wert. Wieviel an baulichen Maßnahmen ist denn nötig, wenn man die Gasometer füllen will? Es muß die Außenfassade saniert werden, es muß die Innenfassade saniert werden. Das kuppelförmige Dach mit seiner Spannweite von 63,8 Metern muß weg und durch irgend etwas anderes ersetzt werden.
Jeder Gasometer hat im geböschten Bereich ein Wasserbassin mit einem 1,7 Meter dicken, nach oben bombierten Betonfundament. Das muß natürlich auch weg, denn man wird ein neues Fundament brauchen. Das Mauerwerk des Bestands hatte ja bisher keine wesentlichen statischen Funktionen zu erfüllen, also kann man es auch in Hinkunft nicht belasten. Die neuen Einbauten müssen daher selbsttragend sein.
Und dann das Bauen selbst: Es wird doch wohl niemand ernsthaft behaupten wollen, daß Bauen im umbauten Raum nicht wesentlich aufwendiger ist als das Bauen auf der grünen Wiese. Aber eigenartig, trotzdem soll dieses Bauvorhaben zu den Bedingungen der Wiener Wohnbauförderung realisierbar sein. Wenn das möglich ist, dann kann man daraus nur einen Schluß ziehen: Wir wurden bisher mutwillig getäuscht. Wenn das alles möglich ist, dann haben wir in den letzten zehn Jahren bei jedem einzelnen Wohnbau eine erkleckliche Summe verschwendet. Dann wäre es bei gleichem Standard auch viel billiger gegangen. Und damit kommen wir zu einem dritten Stichwort: dem Standard. Der Wiener Wohnbau hat ein hohes Niveau, und darauf hat sich die Stadt bisher auch etwas zugute gehalten. Aber wie wird das in den Gasometern sein? Bisher zum Beispiel haben Architekten die größten Anstrengungen in die Orientierung ihrer Wohnungen investiert. Eine nach Norden gerichtete Wohnung galt als Sakrileg. In den Gasometern wird es jede Menge nach Norden gerichteter Wohnungen geben. Und auch solche, die einfach nicht gut belichtet sein können, weil sie in den unteren Wohngeschossen liegen. Und sie werden alle keinen freien Ausblick haben, weil ihnen eben doch nur eine Wand mit Löchern oder der Nachbar beziehungsweise das Visavis vor Augen steht. Die jetzt publizierte Lesart dieses Faktums besagt zwar, daß gerade darin eine Qualität liege, weil die Umgebung so beschaffen sei, daß erst der fragmentierte Blick sie wirklich erträglich mache, aber wenn das nicht der schiere Zynismus ist . . .
Man muß sich auch klarmachen: Die schönen Architektenzeichnungen mit den großzügigen Innenhöfen täuschen. Und ob der Grünbereich im Projekt Wilhelm Holzbauers überhaupt machbar ist, das ziehen zumindest fachkundige Landschaftsplaner in Zweifel, weil bei dieser Gebäudekonfiguration in den Hof zuwenig Licht fallen dürfte. Dann die Akustik: In den Gasometern wird einiges an Aufwand nötig sein, damit nicht jedes Türknallen gleich eine explosionsartige Geräuschkatastrophe verursacht. Wobei es ausdrücklich festzuhalten gilt, daß es hier nicht um die Schwächen oder Mängel einzelner Projekte geht - schon der grundlegende Konzeptansatz ist falsch.
Freilich kann man den beteiligten Architekten den Vorwurf nicht ersparen, daß sie sich überhaupt auf das Ansinnen eingelassen haben, die Gasometer mit Wohnungen vollzustopfen. Natürlich ist es möglich, für historische Bauwerke neue Nutzungen zu entwickeln. Aber wenn diese Interventionen substantielle Qualitäten des Bestands zerstören, dann kehrt sich der scheinbar gutwillige und verantwortungsbewußte Akt der Erhaltung zur sinnlosen und verlogenen Alibigeste um. Und das müßten Architekten wie Jean Nouvel, Wilhelm Holzbauer, Manfred Wehdorn und die Coop Himmelb(l)au eigentlich wissen.
Die einzigen, die mit ihren Projekten so etwas wie Haltung demonstriert haben, sind Peichl & Weber und Hermann & Valentiny; sie haben immerhin darauf hingewiesen, daß man die Wohnungen genausogut oder sogar besser „draußen“ realisieren könnte. Besonders im Projekt von Hermann & Valentiny ist eine bestechende Alternative zu den Vorhaben zu erkennen, die tatsächlich gebaut werden sollen. Die beiden setzen mit ihrem „horizontal geschichteten“ Hochhaus, einer unheimlich mächtigen, die Gasometer sogar noch überragenden Gebäudewand, ein architektonischen Zeichen, das den historischen Bauwerken sozusagen die Reverenz erweist.
Die Gasometer selbst bleiben in diesem Projekt weitgehend frei: Sie sind Parkplätzen vorbehalten, die man in jedem Fall braucht, und sie bieten ein konzentriertes Angebot an Infrastruktur - von der Veranstaltungshalle bis zum Kindergarten und zur Schule. Bei einem der Gasometer wird dabei übrigens eine Glasüberdachung vorgeschlagen, die Bausubstanz also ebenfalls angetastet.
Und die Idee dahinter? Man macht drinnen 880 Stellplätze und auf diesen Stellplätzen einen Park, also in einer Höhe, in der - wie Landschaftsplaner meinen - tatsächlich etwas wachsen kann. Schließlich wird es in der Umgebung mit Freiflächen für die hier Wohnenden schwer werden: Der kontaminierte Boden des ehemaligen Gaswerks dürfte wohl kaumein guter Spielplatz sein. Bürgermeister Häupl hat in seinem Vorwort zur Publikation über das „Revitalisierungsprojekt“ Gasometer geschrieben, es gebe in Wien genug Platz für unkonventionelle Ideen. Da muß man ihn - angesichts dieses Vorhabens - korrigieren. Nein, es gibt nicht genug Platz, und es gibt auch nicht genug unkonventionelle Ideen.
Für den Beitrag verantwortlich: Spectrum
Ansprechpartner:in für diese Seite: nextroom