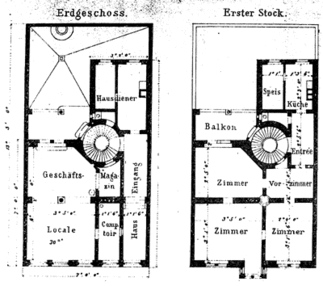Artikel
Häuser für Wien

Über „Das bürgerliche Wohnhaus und das Wiener Zinshaus” von Heinrich Ferstel und Rudolf von Eitelberger (1860)
30. September 1997 - Käthe Protze
Über „Das bürgerliche Wohnhaus und das Wiener Zinshaus” von Heinrich Ferstel und Rudolf von Eitelberger (1860)
Häuser für Wien, das ist eine ungewöhnliche Überlegung, gilt doch gerade Wien als eine der Hochburgen der Mietskaserne und das „schon seit immer”. Heute wie vor 150 Jahren scheint es für eine Großstadt wie Wien keine andere Möglichkeit des Bauens zu geben. Häuser - das ist etwas fürs Land oder, besser noch, für das (womöglich andersgläubige) Ausland, für Städte wie London, Amsterdam, Köln oder Bremen. In Metropolen wie Wien ist erstens der Boden zu teuer und außerdem gibt es „keine geistige Tradition für Häuser”. So einfach ist das.
So einfach wäre es, gäbe es nicht zwei Männer, einen Wiener Professor und einen Wiener Architekten, die im Jahre 1860 gemeinsam eine Streitschrift für das bürgerliche Wohnhaus und gegen das Wiener Zinshaus verfaßten. Gedacht war diese Schrift als ihr Beitrag zur Debatte um die Stadterweiterung von Wien. Worin besteht nun die Diskussion der zwei Herren?
Die Wohnungsspekulation
als Ursache allen Übels
Heinrich Ferstel und Rudolf von Eitelberger stellen eines klar: „Die allgemeine Stimme vereinigt sich darin, daß das Wohnen in den Zinshäusern, insbesondere aber in den neuen, ebenso theuer als unbequem ist.“ (FERSTEL, H./EITELBERGER, R. v. 1860: 17).
Als Ursache für diese Tatsache benennen sie die Wohnungsspekulation: „Man baut nicht, um darin zu wohnen, sondern um die Wohnungen zu vermiethen. Man hat bei der ganzen Anlage eines Gebäudes vor allem den hohen Zins in den Augen, die Procente, welche das Capital abwerfen soll“ (ebd.).
Die Folgen der Wohnungsspekulation
Diese Ausrichtung des Wohnungsbaues auf die größtmöglichen Mieteinnahmen hat natürlich weitreichende Folgen für die Art und Weise des Wohnungsbaues. So wird einerseits unnötiger Aufwand in die Fassade und die Innenausstattung gesteckt, um mit dem schönen Schein die MieterInnen zu locken.
„Der falsche Schmuck, die zerbrechlichen Terracotten, die häßlichen und leicht zerstörbaren Gypsornamente, die fortwährend nöthige Restauration der Facade durch die Tünche, das Alles macht ein solches Haus schon in der Facade theurer, als es nothwendig ist, und ohne daß der Bewohner einen Vortheil davon hat“ (ebd.: 18).
Andererseits wird aller vorhandener Raum im Zinshaus zur Vermietung hergestellt. Notwendige und praktische Nebenräume wie Speise- und Vorratskammern oder Abstellräume werden weggelassen, um den Platz für weitere vermietbare Zimmer bereitzuhalten.
„..., denn dabei ist es vorzugsweise darauf abgesehen, so viel Piecen als möglich herzustellen, weil nach der Zahl der Piecen die Wohnung vermiethet wird. Es werden daher so viel Zimmer als möglich gemacht und Alles vermieden, was in der Raumeintheilung der Anbringung vieler Zimmer hemmend in dem Wege stehen könnte, als Speise- und Vorrathskammern, Kleiderschränke und wie die Räume alle heißen, die eine Wohnung für Familien in der Regel sehr bequem machen; die Zimmer sind klein, haben geringe Tiefe und bieten daher bei den vielen Fenstern und Thüren wenig Wandfläche, um irgend Möbel bequem stellen zu können. (...) Es fallen daher, wie gesagt, eine Reihe von Appartements, die ehemals das Wohnen besonders für die Familien annehmlich machten, gegenwärtig ganz weg, denn der Raum kann ja viel nutzbringender für eine Piece verwendet werden, welche der Hausherr zum Schrecken seines Miethers ein ‘Wohnzimmer‘ nennt. Wie nun die ganze Eintheilung eines solchen Hauses berechnet auf ein hohes Zinserträgnis, für die große Masse der Bewohner möglichst unbequem ist, so ist auch die ganze Art und Weise, wie die Wohnung ausgeschmückt wird, von denselben falschen und verderblichen Gesichtspunkten geleitet, welche wir bei der Facade des Hauses hervortreten gesehen haben. Es verbindet sich da eine schlecht angebrachte falsche Eleganz der Details mit der unbequemen Eintheilung im Ganzen“ (ebd.: 18f).
Außen die schmucke Fassade als Anreiz und Lockmittel für die MieterInnen, innen die maximale Verwertung des Wohnraumes als vermietbare Zimmer. Die Wohnungsspekulation führt zu propagandistischem Aufwand nach außen, der zugleich kurzfristig angelegt und billig gemacht wird. Andererseits werden im Zinshaus die Gebrauchsqualitäten der Wohnungen zugunsten der Abschöpfung des Geldes aufgehoben. Notwendige Nebenräume werden auf diesem Wege „zu teuer”, da sie keinen Profit einbringen. Bezahlen müssen das natürlich die MieterInnen, und zwar sowohl die Fassaden, die ja über die Miete finanziert werden, als auch im täglichen Gebrauch die Kosten, die durch das Fehlen der hauswirtschaftlichen Nebenräume, wie z.B. der Vorratskammern, entstehen.
Unsicherheit in den Lebensbedingungen
Neben diesen Folgen der Wohnungsspekulation, den teuren und unpraktischen Wohnungen, führen Ferstel und von Eitelberger jedoch eine weitere an: die Abhängigkeit vom Willen des Vermieters bzw. der Baugesellschaft und damit die Unsicherheit in den Lebensbedingungen.
„Denn er ist ihnen gegenüber schwach und ohnmächtig, den übermächtigen Capitalien speculierender Bauunternehmer gegenüber ist er auf Gnade und Ungnade preisgegeben. Eine solche Baugesellschaft ist herzlos, sie hat kein Ohr für seine Klagen und keinen Sinn für seine Bedürfnisse; was sie will und was sie kann, ist ausschließlich ihre Sache: möglichst hohe Interessen in einer möglichst schnellen Zeit zu gewinnen“ (ebd.: 23).
Aus dieser üblen Spekulation, so folgern sie, entsteht die Aufspaltung der Bevölkerung in drei verschiedene Klassen:
„Diese civilisierten Wohnhaus-Nomaden, die schlechter daran sind, als die ärmsten Bauern und Landleute, sind nur ein Bruch-theil jener Bewohner, die nicht wandern, aber jeden Augenblick zum Wandern verurtheilt werden können - der Classe der Zinshausbewohner, die zweimal des Jahres fürchten, daß entweder ihr Miethvertrag gekündigt oder ihr Miethzins erhöht wird. Diese Classe von Menschen bildet die immense Majorität besitzloser und heimatloser Menschen, in Wien den Grundstock der Bevölkerung. Dieser Classe gegenüber steht eine andere besitzende, welche in der Regel willens ist, um von dem Hause, in dem sie auch wohnt, die Lebensrente zu beziehen: die Classe der sogenannten Hausherren in Wien. Und aus dieser Classe scheidet sich wieder eine sehr kleine Anzahl von Menschen aus, die wohnen, um zu wohnen, und das Wohnhaus nicht bloß als Zinshaus, sondern als Wohnhaus betrachten“ (ebd.: 5).
So führt die Wohnungsspekulation für die meisten StadtbewohnerInnen zu bedrohten Lebenssituationen. Ein kleiner Teil, die Klasse der sogenannten Hausherren, kann sich daran und zugleich auf Kosten der Mehrheit der MieterInnen bereichern. Nur ein ganz kleiner Teil lebt unter dem eigenen Dach in gesicherten Lebensverhältnissen und ohne andere Leute auszubeuten. Genau diesen Anteil der StadtbewohnerInnen wollen Heinrich Ferstel und Rudolf von Eitelberger stützen und ihre Anzahl erhöhen.
Das bürgerliche Wohnhaus
als Vorbild und Ziel
Aufbauend auf den vorher skizzierten Überlegungen fordern der Professor und der Architekt nun - übrigens mit Verweis auf London, Amsterdam, Bremen, Hamburg und Köln - das bürgerliche Wohnhaus für einen Großteil der Bevölkerung, zumindest aber für den Mittelstand. So stellen sie eine einfache Rechnung auf:
„...denn wo es viele große und relativ wenige Häuser gibt, da gibt es natürlicherweise wenig Hauseigenthümer und viele Miether“ (ebd.: 24).
Um kurz danach diese Rechnung umzukehren und gegen die Wohnungsspekulation zu wenden:
„Denn das ist wohl ohne Zweifel richtig, daß je weniger Menschen in einem Haus wohnen, je mehr Häuser also im Verhältnisse der Bevölkerung vorhanden sind, daß auch desto mehr Hauseigenthümer, d.h. Menschen in einer Stadt wohnen, welche nicht Miether sind, die in ihrer Wohnung nicht von fremdem Willen und all' den Zufälligkeiten abhängig sind, welche das Wohnen im fremden Hause mit sich bringt“ (ebd.: 26).
Die Gebrauchsqualitäten
des bürgerlichen Wohnhauses
Das bürgerliche Wohnhaus, so Ferstel und von Eitelberger, muß allerdings bestimmte Gebrauchsqualitäten mit sich bringen. So schreiben sie:
„Eine bequeme Wohnung fordert ferner Räume von ungleicher Größe und von mäßiger Höhe, welche hinlänglich beleuchtet, die Heizung nicht vertheuern und sich den verschiedenen Entwicklungen des Familienlebens leicht anpassen lassen. Ebenso noth-wendig ist es, daß, soweit es überhaupt möglich ist, in angemessener Weise die Arbeitszimmer mit den Wohnzimmern in Verbindung stehen. (...) Die Natur eines bürgerlichen Wohnhauses verlangt, daß die Arbeitszimmer, ohne die Wohnung der eigentlichen Familie zu geniren, doch in möglichst practischer Weise in Verbindung mit der Familienwohnung zu kommen, (...). Es wird also verlangt werden, daß die Arbeitsräume, Werkstätte, Verkaufslocalitäten, Schaufenster, Magazine und Depots und wie die verschiedenen Theile einer bürgerlichen Wohnung heißen mögen, mit dieser in eine zweckmäßige Verbindung gebracht werden“ (ebd.: 14).
Diese Organisation soll es ermöglichen, daß Arbeit und Wohnen in einem Haus Platz hat. Damit wäre das Wohnhaus an verschiedene ökonomische Situationen anpassungsfähig. Zudem bietet das eigene Haus die Möglichkeit, den vorhandenen Mitteln entsprechend zu wirtschaften. Herstellung und Instandhaltung können dem jeweiligen Einkommensstand angemessen überlegt und langfristig geplant werden.
„Für eine Wohnung, welche man lange besitzt, kann man nach und nach anschaffen und sich so ein bewegliches Eigenthum erwerben, welches einen wirthschaftlichen Werth hat“ (ebd.: 20).
Das Haus kann der Ökonomie, dem Status und dem Bedarf der EigentümerIn entsprechend größer oder kleiner ausfallen. „Es läßt alle Variationen einer architektonischen Aufgabe zu; es kann ein Noth- und Bedürfnisbau im wahren Sinne des Wortes sein und es kann in manchen Fällen ein Prachtbau werden, ...“ (ebd.: 15f).
Mit dem Bau von Häusern, so versprechen H. Ferstel und R. v. Eitelberger, kann die Wohnungsspekulation eingedämmt werden. Denn wenn es viele bezahlbare Häuser gibt, können auch viele Leute Eigentum erwerben und sich damit vom Mietwohnungsmarkt unabhängig machen. Damit wäre den Wohnungsspekulanten die Basis ihrer Geschäfte entzogen. Die StadtbewohnerInnen erhielten die Möglichkeit, unter gesicherten Bedingungen praktisch und sparsam zugleich leben und wirtschaften zu können.
„Unserer Meinung nach muß, um den Grundstock der bürgerlichen Bevölkerung Wiens zu erhalten und zu kräftigen, die hier ganz vernachlässigte Gattung der Familienhäuser wieder in das Leben eingeführt werden. Geschieht dieses, d.h. duldet man nur, daß solche Häuser gebaut werden, und überläßt man nicht die Bauplätze des inneren Wiens ganz und gar der Zinshaus-Speculations-Architektur, so wird das Wohnen von selbst für viele Lebenskreise billiger werden …“ (ebd.: 15).
Die mittelalterliche
Hausökonomie als Leitbild
Nun zeigt sich, daß die Streitschrift von Heinrich Ferstel und Rudolf von Eitelberger zwei Seiten hat. So diskutieren sie das Prinzip und die Folgen der Wohnungsspekulation, die teuren und unbrauchbaren Wohnungen und die ungesicherten Mietverhältnisse. Zudem schlagen sie vor, den Blick anders zu wenden und über Eigentum und das städtische Wohnhaus nachzudenken. Damit bieten sie sowohl eine treffende Kritik als auch ein begründetes und plausibles Angebot. Der Haken liegt in ihrer Vorstellung von Hausökonomie. So versprechen sie einerseits, daß durch den Bau von Wohnhäusern das „Wohnen für viele” automatisch billiger würde. Gleichzeitig sprechen sie nur von einer ganz bestimmten Hausökonomie, die vor allem Handel, Handwerk oder Verlagswesen umfaßt. Beide Männer gehen von einer Hausökonomie aus, in der im Haus selber für den Markt produziert wird. Vorbild hierfür sind im Grunde die mittelalterlichen Hausökonomien der Handels- und Handwerkerhäuser. Für diese werden Räumlichkeiten wie Werkstätten, Lager und Läden vorgesehen. Das allerdings zu einer Zeit, zu der diese Hausökonomien längst ausgewirtschaftet hatten. Die Hauswirtschaft selber, als bleibender Bestandteil, taucht in der Diskussion von Ferstel und von Eitelberger nicht auf. Das heißt, sie ignorieren den Wechsel von einer Hausökonomie, bestehend aus Hauswirtschaft und Produktion für den Markt, zur reinen Hauswirtschaft. Daher geben sie der Produktion für den Markt die größte Aufmerksamkeit. Die Folgen dieser Blickrichtung zeigt der Hausentwurf, den sie dann auch vorstellen.
Im „bürgerlichen Wohnhaus“
steckt die Geschoßwohnung
Im Erdgeschoß des Hauses liegen ein Geschäftslokal mit eigenem Eingang, der Hauseingang mit Flur und die Dienstbotenwohnung. Der Flur führt zum rückwärtigen Stiegenhaus und dem an-schließenden Hof. Über das Stiegenhaus gelangt man in die Obergeschosse. Im ersten Obergeschoß ist natürlich die Wohnung untergebracht. Im zweiten und dritten Obergeschoß sind Werkstätten und Arbeitsstätten vorgesehen. Unter dem Dach liegt der Dachboden. Diese viergeschossigen Häuser stehen gereiht an der Straße, so daß die Vorderseiten mit den Hauseingängen und den Läden einander gegenüberliegen. An den Rückseiten treffen die Höfe aufeinander.
Jedes Haus enthält also einen Laden, Werkstätten und Lagerraum, eine Wohnung und Keller. Die BewohnerInnen erhalten zudem einen Straßenanteil und einen privaten Hof. Arbeiten und Wohnen kann unter einem Dach stattfinden. Der Entwurf zeigt aber auch, daß mit „Arbeit” die marktorientierte (Männer-) Arbeit gemeint ist, die gleich auf drei Geschosse des Hauses verteilt ist. Das „Wohnen” ist bereits auf ein Wohngeschoß reduziert. Die Hauswirtschaft wird auf die kleine Küche beschränkt.
Zudem sind die Häuser sehr groß dimensioniert. Sieben mal sieben Klafter, das macht ungefähr dreizehn mal dreizehn Meter, also ungefähr 170 Quadratmeter im Grundriß, also in etwa 680 Quadratmeter Wohn- und Nutzfläche, auf einer Parzelle von ungefähr 320 Quadratmeter. Diese Größe und die Ausstattung mit soviel Nutzfläche setzt also eine entsprechende Ökonomie voraus, um diese Häuser bewirtschaften zu können. Wer das Haus nicht ausnutzen und erhalten kann, muß einen Teil vermieten. So steht zu erwarten, daß die überschüssigen Geschosse in Mietwohnungen umgewidmet werden, da nur wenige Familien das Geld haben, soviel Raum ungenutzt zu lassen. Das separat geführte Stiegenhaus macht dies auch möglich. Und so ruht in dem Entwurf bereits das Prinzip des Geschoßwohnungsbaues und der Mietwohnung. Nicht zufällig schieben Ferstel und von Eitelberger auch den Einspänner als mögliche Variante hinterher. So klug ihre vorhergehende Kritik und Überlegung ist, so unbedacht ist die Übertragung des ökonomischen Vorbildes, auf das sie sich beziehen.
An dieser Stelle hätten sie anstatt an die Arbeitsstätten für den Markt an die notwendigen Arbeitsorte einer Hauswirtschaft denken und die Häuser darauf reduzieren müssen. Das hätte bedeutet, Häuser zu planen, die von einer Hauswirtschaft alleine gefüllt und erhalten werden können. Damit wären die Häuser kleiner und schmaler ausgefallen und sparsamer und erschwinglicher geworden, eben Häuser für möglichst viele.
Das „bürgerliche Wohnhaus“ ist eine klassizistische Stadtvilla
Und mit dem quadratischen Grundriß und der breiten Straßenfront der Häuser landen Heinrich Ferstel und Rudolf von Eitelberger dann bei der klassizistischen Stadtvilla, gereiht immerhin, aber eben einer Villa mit den entsprechenden Kosten und Einschränkungen in den Gebrauchsqualitäten. So bringt die breite Straßenfront relativ viel Straßenanteil und somit Kosten mit sich. Der quadratische Grundriß mit Seitenflügel und mittiger Erschließung hat Durchgangszimmer und damit Schwierigkeiten in der Nutzung der Zimmer zur Folge. Die Hauswirtschaft kommt, wie es sich für eine Villa gehört, nur mehr am Rande vor (vgl. BEDNAR, B. et al. 1995: 48f). Der Professor und der Architekt haben ihre vielzitierten Vorbilder aus London, Amsterdam, Bremen oder Köln, allesamt Häuser auf schmalen und tiefen Haushufen, wohl nicht sehr genau angesehen.
Ohne Hauswirtschaft klappt
die Übertragung des Vorbildes nicht
Die Kritik von Ferstel und von Eitelberger bricht also an zwei Stellen: Sie nehmen nur die marktorientierte Arbeit, nicht aber die Hauswirtschaft wahr. Daher schaffen sie es nicht, ihr Vorbild, das mittelalterliche Handels- oder Handwerkshaus, auf die aktuelle ökonomische Situation der Leute, die aus der Hauswirtschaft zu Hause und der Lohnarbeit außer Haus besteht, zu übertragen. Ihr Vorbild wird zu einem romantischen Bild aus vergangenen Zeiten und zur Ideologie. So ist dann auch ihr Hausentwurf nicht sparsam überlegt, sondern entspricht der Architektur der Zeit, ist nur vielleicht ein bißchen altmodisch. An diesen Brüchen zeigt sich, daß sie in ihren Überlegungen und ihrem Entwurf trotz ihrer außergewöhnlichen Forderung nach Häusern ihren Kollegen ideologisch und professionell gar nicht so fern standen. Diese vertraten allerdings, weitaus fortschrittlicher orientiert, das industrielle Zeitalter und bewegten sich in ihren Diskussionen zur Stadterweiterung nur zwischen Mietskaserne und Cottage, also Geschoßwohnungsbau und Reihenhauszeile (vgl. z.B. SAX, E. 1869 a + b; D’AVIGDOR, E. H. 1874; WAGNER, O. 1911), arbeiteten also prinzipiell nur dem Mietwohnungsbau und damit auch der Wohnungsspekulation zu.
Erst das Nachdenken über die
Hauswirtschaft führt zum städtischen Einfamilienhaus für möglichst viele
Wenn wir uns Wien heute ansehen, dann ist deutlich, welche Fraktion die Debatte zur Stadterweiterung gewonnen hat. Die Mietskaserne ist und bleibt das Prinzip: egal ob gründerzeitlich, modern oder postmodern. Neuerdings erhält sie sogar anregende Etiketten wie „ökologisch”, „frauengerecht” oder „autofrei”, die es den MieterInnen leichter machen sollen, sich mit den Abhängigkeiten und Kosten zu arrangieren. Im Vergleich dazu wäre Wien als Stadt der gründerzeitlichen Einspänner natürlich weitaus weniger beengt, enthielte größere private und kommunale Spielräume. Und wenn auch nicht im eigenen Haus, so wäre es doch möglich im Einspänner, in einer Wohnung mit Hof, Keller und Dachboden zu leben und zu wirtschaften. Mit maximal vier Parteien im Haus wären dann auch ohne soziale Überforderung persönliche Vereinbarungen möglich. Vor diesem Hintergrund betrachtet sind die Überlegungen von H. Ferstel und R. v. Eitelberger zum „bürgerlichen Wohnhaus“, auch wenn sie letztendlich zum Einspänner führen, weitaus brauchbarer als die ihrer KollegInnen und NachfolgerInnen. Zudem ist ihre Streitschrift historisch wie aktuell eine der wenigen innerhalb der Architektur und des Städtebaus, in denen die Wohnungsspekulation ernsthaft kritisiert und Eigentum und Bau von städtischen Einfamilienhäusern ausführlich diskutiert wird. Sie zeigt aber auch, daß nur die sorgfältige Übertragung des Vorbildes auf die aktuelle ökonomische Situation und das Ernstnehmen der Hauswirtschaft verhindern, daß hinterher wieder Geschoßwohnungsbau herauskommt.
Literatur:
Bednar, B. et al. (1995): Der Stil der Ökonomie. 10. PlanerInnen-Praxis-Seminar in Miltenberg / Main. Studienarbeit am FB 13 der GhK Kassel.
d'Avigdor, E. H. (1874): Das Wohlsein der Menschen in Großstädten. Mit besonderer Rücksicht auf Wien. Wien.
Ferstel, H., Eitelberger, R. v. (1860): Das bürgerliche Wohnhaus und das Wiener Zinshaus. Ein Vorschlag aus Anlaß der Erweiterung der inneren Stadt Wien's. Wien.
Sax, E. (1869a): Die Wohnungszustände der arbeitenden Classen und ihre Reform. Wien.
Sax, E. (1869b): Der Neubau Wiens im Zusammenhang mit der Donau-Regulierung. Ein Vorschlag zur gründlichen Behebung der Wohnungsnoth. Wien.
Wagner, O. (1911): Die Großstadt. Eine Studie über diese. Wien.
Tafel 1 aus: FELLNER, F. (1860): Wie soll Wien bauen? Wien.
Tafel 3 aus: FERSTEL, H., EITELBERGER, R. v. (1860). ebd.
Häuser für Wien, das ist eine ungewöhnliche Überlegung, gilt doch gerade Wien als eine der Hochburgen der Mietskaserne und das „schon seit immer”. Heute wie vor 150 Jahren scheint es für eine Großstadt wie Wien keine andere Möglichkeit des Bauens zu geben. Häuser - das ist etwas fürs Land oder, besser noch, für das (womöglich andersgläubige) Ausland, für Städte wie London, Amsterdam, Köln oder Bremen. In Metropolen wie Wien ist erstens der Boden zu teuer und außerdem gibt es „keine geistige Tradition für Häuser”. So einfach ist das.
So einfach wäre es, gäbe es nicht zwei Männer, einen Wiener Professor und einen Wiener Architekten, die im Jahre 1860 gemeinsam eine Streitschrift für das bürgerliche Wohnhaus und gegen das Wiener Zinshaus verfaßten. Gedacht war diese Schrift als ihr Beitrag zur Debatte um die Stadterweiterung von Wien. Worin besteht nun die Diskussion der zwei Herren?
Die Wohnungsspekulation
als Ursache allen Übels
Heinrich Ferstel und Rudolf von Eitelberger stellen eines klar: „Die allgemeine Stimme vereinigt sich darin, daß das Wohnen in den Zinshäusern, insbesondere aber in den neuen, ebenso theuer als unbequem ist.“ (FERSTEL, H./EITELBERGER, R. v. 1860: 17).
Als Ursache für diese Tatsache benennen sie die Wohnungsspekulation: „Man baut nicht, um darin zu wohnen, sondern um die Wohnungen zu vermiethen. Man hat bei der ganzen Anlage eines Gebäudes vor allem den hohen Zins in den Augen, die Procente, welche das Capital abwerfen soll“ (ebd.).
Die Folgen der Wohnungsspekulation
Diese Ausrichtung des Wohnungsbaues auf die größtmöglichen Mieteinnahmen hat natürlich weitreichende Folgen für die Art und Weise des Wohnungsbaues. So wird einerseits unnötiger Aufwand in die Fassade und die Innenausstattung gesteckt, um mit dem schönen Schein die MieterInnen zu locken.
„Der falsche Schmuck, die zerbrechlichen Terracotten, die häßlichen und leicht zerstörbaren Gypsornamente, die fortwährend nöthige Restauration der Facade durch die Tünche, das Alles macht ein solches Haus schon in der Facade theurer, als es nothwendig ist, und ohne daß der Bewohner einen Vortheil davon hat“ (ebd.: 18).
Andererseits wird aller vorhandener Raum im Zinshaus zur Vermietung hergestellt. Notwendige und praktische Nebenräume wie Speise- und Vorratskammern oder Abstellräume werden weggelassen, um den Platz für weitere vermietbare Zimmer bereitzuhalten.
„..., denn dabei ist es vorzugsweise darauf abgesehen, so viel Piecen als möglich herzustellen, weil nach der Zahl der Piecen die Wohnung vermiethet wird. Es werden daher so viel Zimmer als möglich gemacht und Alles vermieden, was in der Raumeintheilung der Anbringung vieler Zimmer hemmend in dem Wege stehen könnte, als Speise- und Vorrathskammern, Kleiderschränke und wie die Räume alle heißen, die eine Wohnung für Familien in der Regel sehr bequem machen; die Zimmer sind klein, haben geringe Tiefe und bieten daher bei den vielen Fenstern und Thüren wenig Wandfläche, um irgend Möbel bequem stellen zu können. (...) Es fallen daher, wie gesagt, eine Reihe von Appartements, die ehemals das Wohnen besonders für die Familien annehmlich machten, gegenwärtig ganz weg, denn der Raum kann ja viel nutzbringender für eine Piece verwendet werden, welche der Hausherr zum Schrecken seines Miethers ein ‘Wohnzimmer‘ nennt. Wie nun die ganze Eintheilung eines solchen Hauses berechnet auf ein hohes Zinserträgnis, für die große Masse der Bewohner möglichst unbequem ist, so ist auch die ganze Art und Weise, wie die Wohnung ausgeschmückt wird, von denselben falschen und verderblichen Gesichtspunkten geleitet, welche wir bei der Facade des Hauses hervortreten gesehen haben. Es verbindet sich da eine schlecht angebrachte falsche Eleganz der Details mit der unbequemen Eintheilung im Ganzen“ (ebd.: 18f).
Außen die schmucke Fassade als Anreiz und Lockmittel für die MieterInnen, innen die maximale Verwertung des Wohnraumes als vermietbare Zimmer. Die Wohnungsspekulation führt zu propagandistischem Aufwand nach außen, der zugleich kurzfristig angelegt und billig gemacht wird. Andererseits werden im Zinshaus die Gebrauchsqualitäten der Wohnungen zugunsten der Abschöpfung des Geldes aufgehoben. Notwendige Nebenräume werden auf diesem Wege „zu teuer”, da sie keinen Profit einbringen. Bezahlen müssen das natürlich die MieterInnen, und zwar sowohl die Fassaden, die ja über die Miete finanziert werden, als auch im täglichen Gebrauch die Kosten, die durch das Fehlen der hauswirtschaftlichen Nebenräume, wie z.B. der Vorratskammern, entstehen.
Unsicherheit in den Lebensbedingungen
Neben diesen Folgen der Wohnungsspekulation, den teuren und unpraktischen Wohnungen, führen Ferstel und von Eitelberger jedoch eine weitere an: die Abhängigkeit vom Willen des Vermieters bzw. der Baugesellschaft und damit die Unsicherheit in den Lebensbedingungen.
„Denn er ist ihnen gegenüber schwach und ohnmächtig, den übermächtigen Capitalien speculierender Bauunternehmer gegenüber ist er auf Gnade und Ungnade preisgegeben. Eine solche Baugesellschaft ist herzlos, sie hat kein Ohr für seine Klagen und keinen Sinn für seine Bedürfnisse; was sie will und was sie kann, ist ausschließlich ihre Sache: möglichst hohe Interessen in einer möglichst schnellen Zeit zu gewinnen“ (ebd.: 23).
Aus dieser üblen Spekulation, so folgern sie, entsteht die Aufspaltung der Bevölkerung in drei verschiedene Klassen:
„Diese civilisierten Wohnhaus-Nomaden, die schlechter daran sind, als die ärmsten Bauern und Landleute, sind nur ein Bruch-theil jener Bewohner, die nicht wandern, aber jeden Augenblick zum Wandern verurtheilt werden können - der Classe der Zinshausbewohner, die zweimal des Jahres fürchten, daß entweder ihr Miethvertrag gekündigt oder ihr Miethzins erhöht wird. Diese Classe von Menschen bildet die immense Majorität besitzloser und heimatloser Menschen, in Wien den Grundstock der Bevölkerung. Dieser Classe gegenüber steht eine andere besitzende, welche in der Regel willens ist, um von dem Hause, in dem sie auch wohnt, die Lebensrente zu beziehen: die Classe der sogenannten Hausherren in Wien. Und aus dieser Classe scheidet sich wieder eine sehr kleine Anzahl von Menschen aus, die wohnen, um zu wohnen, und das Wohnhaus nicht bloß als Zinshaus, sondern als Wohnhaus betrachten“ (ebd.: 5).
So führt die Wohnungsspekulation für die meisten StadtbewohnerInnen zu bedrohten Lebenssituationen. Ein kleiner Teil, die Klasse der sogenannten Hausherren, kann sich daran und zugleich auf Kosten der Mehrheit der MieterInnen bereichern. Nur ein ganz kleiner Teil lebt unter dem eigenen Dach in gesicherten Lebensverhältnissen und ohne andere Leute auszubeuten. Genau diesen Anteil der StadtbewohnerInnen wollen Heinrich Ferstel und Rudolf von Eitelberger stützen und ihre Anzahl erhöhen.
Das bürgerliche Wohnhaus
als Vorbild und Ziel
Aufbauend auf den vorher skizzierten Überlegungen fordern der Professor und der Architekt nun - übrigens mit Verweis auf London, Amsterdam, Bremen, Hamburg und Köln - das bürgerliche Wohnhaus für einen Großteil der Bevölkerung, zumindest aber für den Mittelstand. So stellen sie eine einfache Rechnung auf:
„...denn wo es viele große und relativ wenige Häuser gibt, da gibt es natürlicherweise wenig Hauseigenthümer und viele Miether“ (ebd.: 24).
Um kurz danach diese Rechnung umzukehren und gegen die Wohnungsspekulation zu wenden:
„Denn das ist wohl ohne Zweifel richtig, daß je weniger Menschen in einem Haus wohnen, je mehr Häuser also im Verhältnisse der Bevölkerung vorhanden sind, daß auch desto mehr Hauseigenthümer, d.h. Menschen in einer Stadt wohnen, welche nicht Miether sind, die in ihrer Wohnung nicht von fremdem Willen und all' den Zufälligkeiten abhängig sind, welche das Wohnen im fremden Hause mit sich bringt“ (ebd.: 26).
Die Gebrauchsqualitäten
des bürgerlichen Wohnhauses
Das bürgerliche Wohnhaus, so Ferstel und von Eitelberger, muß allerdings bestimmte Gebrauchsqualitäten mit sich bringen. So schreiben sie:
„Eine bequeme Wohnung fordert ferner Räume von ungleicher Größe und von mäßiger Höhe, welche hinlänglich beleuchtet, die Heizung nicht vertheuern und sich den verschiedenen Entwicklungen des Familienlebens leicht anpassen lassen. Ebenso noth-wendig ist es, daß, soweit es überhaupt möglich ist, in angemessener Weise die Arbeitszimmer mit den Wohnzimmern in Verbindung stehen. (...) Die Natur eines bürgerlichen Wohnhauses verlangt, daß die Arbeitszimmer, ohne die Wohnung der eigentlichen Familie zu geniren, doch in möglichst practischer Weise in Verbindung mit der Familienwohnung zu kommen, (...). Es wird also verlangt werden, daß die Arbeitsräume, Werkstätte, Verkaufslocalitäten, Schaufenster, Magazine und Depots und wie die verschiedenen Theile einer bürgerlichen Wohnung heißen mögen, mit dieser in eine zweckmäßige Verbindung gebracht werden“ (ebd.: 14).
Diese Organisation soll es ermöglichen, daß Arbeit und Wohnen in einem Haus Platz hat. Damit wäre das Wohnhaus an verschiedene ökonomische Situationen anpassungsfähig. Zudem bietet das eigene Haus die Möglichkeit, den vorhandenen Mitteln entsprechend zu wirtschaften. Herstellung und Instandhaltung können dem jeweiligen Einkommensstand angemessen überlegt und langfristig geplant werden.
„Für eine Wohnung, welche man lange besitzt, kann man nach und nach anschaffen und sich so ein bewegliches Eigenthum erwerben, welches einen wirthschaftlichen Werth hat“ (ebd.: 20).
Das Haus kann der Ökonomie, dem Status und dem Bedarf der EigentümerIn entsprechend größer oder kleiner ausfallen. „Es läßt alle Variationen einer architektonischen Aufgabe zu; es kann ein Noth- und Bedürfnisbau im wahren Sinne des Wortes sein und es kann in manchen Fällen ein Prachtbau werden, ...“ (ebd.: 15f).
Mit dem Bau von Häusern, so versprechen H. Ferstel und R. v. Eitelberger, kann die Wohnungsspekulation eingedämmt werden. Denn wenn es viele bezahlbare Häuser gibt, können auch viele Leute Eigentum erwerben und sich damit vom Mietwohnungsmarkt unabhängig machen. Damit wäre den Wohnungsspekulanten die Basis ihrer Geschäfte entzogen. Die StadtbewohnerInnen erhielten die Möglichkeit, unter gesicherten Bedingungen praktisch und sparsam zugleich leben und wirtschaften zu können.
„Unserer Meinung nach muß, um den Grundstock der bürgerlichen Bevölkerung Wiens zu erhalten und zu kräftigen, die hier ganz vernachlässigte Gattung der Familienhäuser wieder in das Leben eingeführt werden. Geschieht dieses, d.h. duldet man nur, daß solche Häuser gebaut werden, und überläßt man nicht die Bauplätze des inneren Wiens ganz und gar der Zinshaus-Speculations-Architektur, so wird das Wohnen von selbst für viele Lebenskreise billiger werden …“ (ebd.: 15).
Die mittelalterliche
Hausökonomie als Leitbild
Nun zeigt sich, daß die Streitschrift von Heinrich Ferstel und Rudolf von Eitelberger zwei Seiten hat. So diskutieren sie das Prinzip und die Folgen der Wohnungsspekulation, die teuren und unbrauchbaren Wohnungen und die ungesicherten Mietverhältnisse. Zudem schlagen sie vor, den Blick anders zu wenden und über Eigentum und das städtische Wohnhaus nachzudenken. Damit bieten sie sowohl eine treffende Kritik als auch ein begründetes und plausibles Angebot. Der Haken liegt in ihrer Vorstellung von Hausökonomie. So versprechen sie einerseits, daß durch den Bau von Wohnhäusern das „Wohnen für viele” automatisch billiger würde. Gleichzeitig sprechen sie nur von einer ganz bestimmten Hausökonomie, die vor allem Handel, Handwerk oder Verlagswesen umfaßt. Beide Männer gehen von einer Hausökonomie aus, in der im Haus selber für den Markt produziert wird. Vorbild hierfür sind im Grunde die mittelalterlichen Hausökonomien der Handels- und Handwerkerhäuser. Für diese werden Räumlichkeiten wie Werkstätten, Lager und Läden vorgesehen. Das allerdings zu einer Zeit, zu der diese Hausökonomien längst ausgewirtschaftet hatten. Die Hauswirtschaft selber, als bleibender Bestandteil, taucht in der Diskussion von Ferstel und von Eitelberger nicht auf. Das heißt, sie ignorieren den Wechsel von einer Hausökonomie, bestehend aus Hauswirtschaft und Produktion für den Markt, zur reinen Hauswirtschaft. Daher geben sie der Produktion für den Markt die größte Aufmerksamkeit. Die Folgen dieser Blickrichtung zeigt der Hausentwurf, den sie dann auch vorstellen.
Im „bürgerlichen Wohnhaus“
steckt die Geschoßwohnung
Im Erdgeschoß des Hauses liegen ein Geschäftslokal mit eigenem Eingang, der Hauseingang mit Flur und die Dienstbotenwohnung. Der Flur führt zum rückwärtigen Stiegenhaus und dem an-schließenden Hof. Über das Stiegenhaus gelangt man in die Obergeschosse. Im ersten Obergeschoß ist natürlich die Wohnung untergebracht. Im zweiten und dritten Obergeschoß sind Werkstätten und Arbeitsstätten vorgesehen. Unter dem Dach liegt der Dachboden. Diese viergeschossigen Häuser stehen gereiht an der Straße, so daß die Vorderseiten mit den Hauseingängen und den Läden einander gegenüberliegen. An den Rückseiten treffen die Höfe aufeinander.
Jedes Haus enthält also einen Laden, Werkstätten und Lagerraum, eine Wohnung und Keller. Die BewohnerInnen erhalten zudem einen Straßenanteil und einen privaten Hof. Arbeiten und Wohnen kann unter einem Dach stattfinden. Der Entwurf zeigt aber auch, daß mit „Arbeit” die marktorientierte (Männer-) Arbeit gemeint ist, die gleich auf drei Geschosse des Hauses verteilt ist. Das „Wohnen” ist bereits auf ein Wohngeschoß reduziert. Die Hauswirtschaft wird auf die kleine Küche beschränkt.
Zudem sind die Häuser sehr groß dimensioniert. Sieben mal sieben Klafter, das macht ungefähr dreizehn mal dreizehn Meter, also ungefähr 170 Quadratmeter im Grundriß, also in etwa 680 Quadratmeter Wohn- und Nutzfläche, auf einer Parzelle von ungefähr 320 Quadratmeter. Diese Größe und die Ausstattung mit soviel Nutzfläche setzt also eine entsprechende Ökonomie voraus, um diese Häuser bewirtschaften zu können. Wer das Haus nicht ausnutzen und erhalten kann, muß einen Teil vermieten. So steht zu erwarten, daß die überschüssigen Geschosse in Mietwohnungen umgewidmet werden, da nur wenige Familien das Geld haben, soviel Raum ungenutzt zu lassen. Das separat geführte Stiegenhaus macht dies auch möglich. Und so ruht in dem Entwurf bereits das Prinzip des Geschoßwohnungsbaues und der Mietwohnung. Nicht zufällig schieben Ferstel und von Eitelberger auch den Einspänner als mögliche Variante hinterher. So klug ihre vorhergehende Kritik und Überlegung ist, so unbedacht ist die Übertragung des ökonomischen Vorbildes, auf das sie sich beziehen.
An dieser Stelle hätten sie anstatt an die Arbeitsstätten für den Markt an die notwendigen Arbeitsorte einer Hauswirtschaft denken und die Häuser darauf reduzieren müssen. Das hätte bedeutet, Häuser zu planen, die von einer Hauswirtschaft alleine gefüllt und erhalten werden können. Damit wären die Häuser kleiner und schmaler ausgefallen und sparsamer und erschwinglicher geworden, eben Häuser für möglichst viele.
Das „bürgerliche Wohnhaus“ ist eine klassizistische Stadtvilla
Und mit dem quadratischen Grundriß und der breiten Straßenfront der Häuser landen Heinrich Ferstel und Rudolf von Eitelberger dann bei der klassizistischen Stadtvilla, gereiht immerhin, aber eben einer Villa mit den entsprechenden Kosten und Einschränkungen in den Gebrauchsqualitäten. So bringt die breite Straßenfront relativ viel Straßenanteil und somit Kosten mit sich. Der quadratische Grundriß mit Seitenflügel und mittiger Erschließung hat Durchgangszimmer und damit Schwierigkeiten in der Nutzung der Zimmer zur Folge. Die Hauswirtschaft kommt, wie es sich für eine Villa gehört, nur mehr am Rande vor (vgl. BEDNAR, B. et al. 1995: 48f). Der Professor und der Architekt haben ihre vielzitierten Vorbilder aus London, Amsterdam, Bremen oder Köln, allesamt Häuser auf schmalen und tiefen Haushufen, wohl nicht sehr genau angesehen.
Ohne Hauswirtschaft klappt
die Übertragung des Vorbildes nicht
Die Kritik von Ferstel und von Eitelberger bricht also an zwei Stellen: Sie nehmen nur die marktorientierte Arbeit, nicht aber die Hauswirtschaft wahr. Daher schaffen sie es nicht, ihr Vorbild, das mittelalterliche Handels- oder Handwerkshaus, auf die aktuelle ökonomische Situation der Leute, die aus der Hauswirtschaft zu Hause und der Lohnarbeit außer Haus besteht, zu übertragen. Ihr Vorbild wird zu einem romantischen Bild aus vergangenen Zeiten und zur Ideologie. So ist dann auch ihr Hausentwurf nicht sparsam überlegt, sondern entspricht der Architektur der Zeit, ist nur vielleicht ein bißchen altmodisch. An diesen Brüchen zeigt sich, daß sie in ihren Überlegungen und ihrem Entwurf trotz ihrer außergewöhnlichen Forderung nach Häusern ihren Kollegen ideologisch und professionell gar nicht so fern standen. Diese vertraten allerdings, weitaus fortschrittlicher orientiert, das industrielle Zeitalter und bewegten sich in ihren Diskussionen zur Stadterweiterung nur zwischen Mietskaserne und Cottage, also Geschoßwohnungsbau und Reihenhauszeile (vgl. z.B. SAX, E. 1869 a + b; D’AVIGDOR, E. H. 1874; WAGNER, O. 1911), arbeiteten also prinzipiell nur dem Mietwohnungsbau und damit auch der Wohnungsspekulation zu.
Erst das Nachdenken über die
Hauswirtschaft führt zum städtischen Einfamilienhaus für möglichst viele
Wenn wir uns Wien heute ansehen, dann ist deutlich, welche Fraktion die Debatte zur Stadterweiterung gewonnen hat. Die Mietskaserne ist und bleibt das Prinzip: egal ob gründerzeitlich, modern oder postmodern. Neuerdings erhält sie sogar anregende Etiketten wie „ökologisch”, „frauengerecht” oder „autofrei”, die es den MieterInnen leichter machen sollen, sich mit den Abhängigkeiten und Kosten zu arrangieren. Im Vergleich dazu wäre Wien als Stadt der gründerzeitlichen Einspänner natürlich weitaus weniger beengt, enthielte größere private und kommunale Spielräume. Und wenn auch nicht im eigenen Haus, so wäre es doch möglich im Einspänner, in einer Wohnung mit Hof, Keller und Dachboden zu leben und zu wirtschaften. Mit maximal vier Parteien im Haus wären dann auch ohne soziale Überforderung persönliche Vereinbarungen möglich. Vor diesem Hintergrund betrachtet sind die Überlegungen von H. Ferstel und R. v. Eitelberger zum „bürgerlichen Wohnhaus“, auch wenn sie letztendlich zum Einspänner führen, weitaus brauchbarer als die ihrer KollegInnen und NachfolgerInnen. Zudem ist ihre Streitschrift historisch wie aktuell eine der wenigen innerhalb der Architektur und des Städtebaus, in denen die Wohnungsspekulation ernsthaft kritisiert und Eigentum und Bau von städtischen Einfamilienhäusern ausführlich diskutiert wird. Sie zeigt aber auch, daß nur die sorgfältige Übertragung des Vorbildes auf die aktuelle ökonomische Situation und das Ernstnehmen der Hauswirtschaft verhindern, daß hinterher wieder Geschoßwohnungsbau herauskommt.
Literatur:
Bednar, B. et al. (1995): Der Stil der Ökonomie. 10. PlanerInnen-Praxis-Seminar in Miltenberg / Main. Studienarbeit am FB 13 der GhK Kassel.
d'Avigdor, E. H. (1874): Das Wohlsein der Menschen in Großstädten. Mit besonderer Rücksicht auf Wien. Wien.
Ferstel, H., Eitelberger, R. v. (1860): Das bürgerliche Wohnhaus und das Wiener Zinshaus. Ein Vorschlag aus Anlaß der Erweiterung der inneren Stadt Wien's. Wien.
Sax, E. (1869a): Die Wohnungszustände der arbeitenden Classen und ihre Reform. Wien.
Sax, E. (1869b): Der Neubau Wiens im Zusammenhang mit der Donau-Regulierung. Ein Vorschlag zur gründlichen Behebung der Wohnungsnoth. Wien.
Wagner, O. (1911): Die Großstadt. Eine Studie über diese. Wien.
Tafel 1 aus: FELLNER, F. (1860): Wie soll Wien bauen? Wien.
Tafel 3 aus: FERSTEL, H., EITELBERGER, R. v. (1860). ebd.
Für den Beitrag verantwortlich: zolltexte
Ansprechpartner:in für diese Seite: nextroom