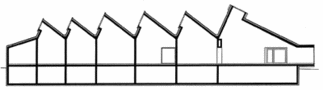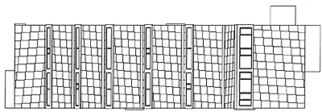Artikel
Orte der geistigen Konzentration

Die Museumsbauten von Gigon & Guyer im Überblick
Wie kaum ein anderes jüngeres Architektenteam konnten sich die Zürcher Annette Gigon und Mike Guyer auf dem Gebiet des Museumsbaus verwirklichen. Ein Vergleich der von ihnen erbauten Museen in Davos, Winterthur und Appenzell veranschaulicht eine Entwicklung von der klassischen Reduktion hin zu einer geradezu expressiven Formgestaltung.
6. November 1998 - Margit Ulama
Im Zusammenhang mit der forcierten Architekturentwicklung der neunziger Jahre bemerkt man eine Dichotomie, die die Gegenwart in ihrem Antagonismus widerspiegelt. Auf der einen Seite werden traditionelle Kategorien auf dynamische oder auch dekonstruktive Weise hinter sich gelassen, auf der anderen zeigt sich das einfache, abstrakte Volumen in seiner ganzen Virulenz. Es werden sowohl vertraute Grenzen provokant überschritten als auch die vielfältigen Möglichkeiten innerhalb eines definierten Rahmens ausgelotet. Die Zürcher Architekten Annette Gigon und Mike Guyer positionieren sich klar und nehmen die letztere Haltung ein. Als gerade Dreissigjährige reüssierten sie Anfang der neunziger Jahre mit dem Kirchner-Museum in Davos, knapp danach folgte der Erweiterungsbau des Kunstmuseums Winterthur. Nun stehen zwei weitere Projekte dieses Bautyps zur Diskussion: der Umbau der Sammlung Oskar Reinhart «Am Römerholz» in Winterthur und das Museum Liner in Appenzell (NZZ 26. 9. 98). Insgesamt dokumentieren diese Bauten die beeindruckende Entwicklung eines jungen Teams innerhalb eines Jahrzehnts, und sie verdeutlichen gleichzeitig die Spanne architektonischer Gestaltung in einem allgemeinen Sinn. Denn während die beiden ersten Beispiele in ihrer Reduktion klassisch wirken, führen die neuen Bauten die früheren Themen auf verdichtete und sogar expressive Weise fort.
Expressive Steigerung
Die Grundlage bildet bei allen Museumsbauten von Gigon & Guyer der orthogonale, von oben belichtete Ausstellungssaal. Das Kirchner-Museum als erster Bau war in doppelter Hinsicht programmatisch. Der traditionelle Ausstellungsraum wurde in der gewohnten Materialität, jedoch ohne die üblichen Details umgesetzt. Dieser purifizierte Raum wurde zum selbständigen, vierfach gesetzten Baukörper mit dazwischenliegender Erschliessungszone. So unregelmässig die Kontur im Grundriss auch ist, aussen präsentiert sich das Museum mit seinen gleich hohen Kuben dennoch regelmässig, und die durchlaufenden horizontalen Kanten bilden die Grundlage für eine klassische Dreiteilung der gläsernen Bauhülle. Bei der Erweiterung des Kunstmuseums in Winterthur variierten Gigon & Guyer die Themen. Sie griffen auf das geschlossene Volumen über einem rechteckigen Grundriss zurück und wiederholten gleichzeitig in der äusseren Glashaut das Thema von Sockel, Mittelteil und Dachzone. Doch bereits hier kam es zu einer Steigerung des Ausdrucks auf Grund des gezackten Dachabschlusses. Das Sheddach führte auch im Inneren eine expressive Dimension ein, und grosse, bis zum Boden reichende Öffnungen bezogen die Aussenwelt in den Kunstraum mit ein.
Konzeptuell führte dieser Bau schliesslich zum Museum Liner, das Kirchner-Museum hingegen zur Erweiterung der Sammlung Reinhart. Wenn es sich in Davos also noch um eine ruhige Komposition aus einzelnen grossen Boxen handelte, so beobachtet man bei der «Römerholz»-Erweiterung ein verdichtetes Auftürmen kleinerer Volumen, eine Art gestaffelten «Volumberg»; und wenn der Annex an das Winterthurer Kunstmuseum mit seinem auffälligen Dachabschluss noch immer klassisch wirkt, so entstand nun mit dem Liner-Museum ein betont skulpturales Volumen, bei dem die Zackenform der Sheds einen integralen Teil der Gesamtkomposition bildet. Mit der spezifischen Behandlung dieses Baukörpers führen Gigon & Guyer gänzlich neue Themen in ihr Œuvre ein. Angemerkt sei in diesem Zusammenhang, dass das Volumen im Sinne eines monolithischen Ganzen erst jüngst von Herzog & de Meuron beim Haus Rudin (NZZ 12. 9. 98) prototypisch interpretiert wurde.
Die international bedeutende Kunstsammlung von Oskar Reinhart ist in einer Villa untergebracht, die 1913-15 vom Genfer Architekten Maurice Turrettini im Stile eines französischen Landhauses gebaut und von diesem 1924 um einen Galerieanbau erweitert wurde. So entstand ein romantischer, sowohl im Grundriss als auch in den Höhen vielfältig differenzierter Komplex, den man jetzt renovierte. Neu gebaut wurden nur drei relative kleine Ausstellungsräume zwischen dem ehemaligen Wohnhaus und dem zurückgesetzten Galerieteil. Mit dieser geringen Kubatur gelang den Architekten aber nicht nur das Transponieren eigener Themen, sondern auch eine adäquate Interpretation des Bestandes. Im Grundriss schliessen die drei neuen Räume den Galerieteil im Sinne eines einfachen Rechteckes ab, wodurch der Hof an der Rückseite des Haupthauses klar gefasst wird. Unterschiedliche Höhen definieren die einzelnen Räume als eigene Kuben, unterstützt durch die Fugen der Betonfertigteile, die die kleinen Baukörper jeweils auch in sich teilen. Im Inneren taucht das quaderförmige Volumen in der Form eines flachen Glaskörpers an der Decke auf. Dadurch soll das Oberlicht in den Raum geholt und besser verteilt werden. Das Thema unterschiedlicher Gebäudehöhen wird schliesslich auch bei den Dachvolumen aufgenommen. Diese überlappen die Ausstellungsräume ausserdem in der Horizontalen und führen damit die Komposition zur letzten Konsequenz. Funktionelle Überlegungen münden in einer eigenständigen gestalterischen Geste.
Die abstrakte Interpretation der Villa, die der erwähnten Baukörperstaffelung zugrunde liegt, wiederholen Gigon & Guyer auch auf der Ebene der Materialität. Die Architekten sprechen dabei von dem «‹alchimistischen› Versuch einer Adaption des Neubaus an den Genius loci». Dem Beton wurden deshalb zwei Materialien, die auch bei der alten Villa verwendet wurden, nämlich Jurakalkstein und Kupfer, in zerkleinerter Form beigefügt. Durch diese Kombination entwickelte sich eine rasche Patinierung, die bereits jetzt in der grünlichen Färbung des Betons erkennbar ist und die sich durch das mit Kupferionen angereicherte Dachwasser noch weiter verstärken wird. Die Farbe als ursprünglich immateriellstes Bekleidungsmittel der Architektur durchzieht die gesamte Wand. Die subtile Material- und Oberflächendifferenzierung ist typisch für eine aktuelle Architekturtendenz, sie präsentiert sich in diesem Zusammenhang aber konsistent und zugleich sinnlich. Während bei der Sammlung Reinhart das solcherart differenzierte einfache Volumen in der verdichteten Form noch immer erkennbar ist, gehen Gigon & Guyer beim Museum Liner in Appenzell einen entschiedenen Schritt weiter.
Innenraum und Aussenwelt
Das am Ortsrand gelegene Gebäude, das dem Maler Carl August Liner (1871-1946) und dessen Sohn Carl Walter Liner (1914-97) gewidmet ist, spielt auf Grund seiner Lage und Form mit dem Thema Industriebau. In diesem Sinn fehlt die repräsentative Geste. Statt dessen konstituiert sich - wie bei den anderen Beispielen - ein Ort der konzentrierten Wahrnehmung. Bei ihrem Entwurf für Davos wurden Gigon & Guyer unter anderem von den Reflexionen Rémy Zauggs zum Thema Kunstmuseum angeregt. Beim Museum Liner handelt es sich immer noch um einen Ort der Konzentration, auch wenn das Expressive mit der gezackten, skulpturalen Form in den Vordergrund rückt. Der Rhythmus der einzelnen Sheds wird dabei zusehends, enger und ihre Höhe nimmt ab. Gleichzeitig ändert sich die Grösse der Schindeln aus Chromstahlblech und verstärkt so die perspektivische Wirkung. An den Enden stülpt sich der längliche Baukörper nach aussen, und die verglasten Stirnflächen formen an dem sonst eher hermetischen Bau eigene Körper. Das Innere wird den Passanten in einer kleinen Box sichtbar gemacht, umgekehrt wird die Aussenwelt zu einer hervorgehobenen Szenerie im Inneren.
Die Fenster fungieren gleichsam als «Sehinstrumente» - ein Begriff, den Annette Gigon im Zusammenhang mit ihrem jüngsten Wettbewerb für den «Archäologischen Museumspark Kalkriese» in der Nähe von Osnabrück im Teutoburger Wald (NZZ 7. 8. 98) verwendet. Die Shedöffnung über der Eingangshalle sowie die übrigen Fenster fallen schliesslich auf Grund des äusseren breiten Rahmens auf, den man auch von anderen Bauten der Architekten kennt. Die Realität wird also bewusst in die Kunstwelt hereingeholt und lenkt natürlich auch ab, so wie dies die Räume in ihrer expressiven Form tun. Doch letzteres beschränkt sich auf den Deckenbereich, denn im Grundriss reihen sich kleine Rechtecke aneinander. Die offenen Fugen in den Raumkanten betonen die Konfiguration und lassen die Wände leicht und kartonartig erscheinen.
Auf gänzlich unterschiedliche Weise interpretieren die beiden jüngsten Bauten von Gigon & Guyer den jeweiligen Kontext. Trotz ihrer engen Verbundenheit mit der Deutschschweizer Architekturentwicklung finden Gigon & Guyer zu neuen, spezifischen Formen des Ausdrucks. Beim Wettbewerb für den Museumspark bei Osnabrück kehren sie zum klaren Gebäudekubus zurück. Die Herausforderung liegt hier in der Interpretation einer Landschaftszone, die im Jahr 9 n. Chr. Schauplatz der Varus-Schlacht war. So einfach die auf dem Gebiet verteilten Ausstellungspavillons erscheinen, so komplex präsentiert sich die Gestaltung des Freiraums. Auf abstrakt-sinnliche Weise sollen hier unterschiedliche Zeitschichten erfahrbar gemacht werden, und wieder bedienen sich Annette Gigon und Mike Guyer der Hervorhebung mittels gerahmter Ausschnitte. In einem abgegrenzten rechteckigen Feld wird die ehemalige Landschaft rekonstruiert - im Sinne eines «historischen Biotops», eines «Fensters in die Zeit». Die Darstellung von Distanz als reflektierter Form der Betrachtung wird bei diesem ebenso ungewöhnlichen wie interessanten Museumsprojekt zu einem konstitutiven Faktor des Entwurfs.
Expressive Steigerung
Die Grundlage bildet bei allen Museumsbauten von Gigon & Guyer der orthogonale, von oben belichtete Ausstellungssaal. Das Kirchner-Museum als erster Bau war in doppelter Hinsicht programmatisch. Der traditionelle Ausstellungsraum wurde in der gewohnten Materialität, jedoch ohne die üblichen Details umgesetzt. Dieser purifizierte Raum wurde zum selbständigen, vierfach gesetzten Baukörper mit dazwischenliegender Erschliessungszone. So unregelmässig die Kontur im Grundriss auch ist, aussen präsentiert sich das Museum mit seinen gleich hohen Kuben dennoch regelmässig, und die durchlaufenden horizontalen Kanten bilden die Grundlage für eine klassische Dreiteilung der gläsernen Bauhülle. Bei der Erweiterung des Kunstmuseums in Winterthur variierten Gigon & Guyer die Themen. Sie griffen auf das geschlossene Volumen über einem rechteckigen Grundriss zurück und wiederholten gleichzeitig in der äusseren Glashaut das Thema von Sockel, Mittelteil und Dachzone. Doch bereits hier kam es zu einer Steigerung des Ausdrucks auf Grund des gezackten Dachabschlusses. Das Sheddach führte auch im Inneren eine expressive Dimension ein, und grosse, bis zum Boden reichende Öffnungen bezogen die Aussenwelt in den Kunstraum mit ein.
Konzeptuell führte dieser Bau schliesslich zum Museum Liner, das Kirchner-Museum hingegen zur Erweiterung der Sammlung Reinhart. Wenn es sich in Davos also noch um eine ruhige Komposition aus einzelnen grossen Boxen handelte, so beobachtet man bei der «Römerholz»-Erweiterung ein verdichtetes Auftürmen kleinerer Volumen, eine Art gestaffelten «Volumberg»; und wenn der Annex an das Winterthurer Kunstmuseum mit seinem auffälligen Dachabschluss noch immer klassisch wirkt, so entstand nun mit dem Liner-Museum ein betont skulpturales Volumen, bei dem die Zackenform der Sheds einen integralen Teil der Gesamtkomposition bildet. Mit der spezifischen Behandlung dieses Baukörpers führen Gigon & Guyer gänzlich neue Themen in ihr Œuvre ein. Angemerkt sei in diesem Zusammenhang, dass das Volumen im Sinne eines monolithischen Ganzen erst jüngst von Herzog & de Meuron beim Haus Rudin (NZZ 12. 9. 98) prototypisch interpretiert wurde.
Die international bedeutende Kunstsammlung von Oskar Reinhart ist in einer Villa untergebracht, die 1913-15 vom Genfer Architekten Maurice Turrettini im Stile eines französischen Landhauses gebaut und von diesem 1924 um einen Galerieanbau erweitert wurde. So entstand ein romantischer, sowohl im Grundriss als auch in den Höhen vielfältig differenzierter Komplex, den man jetzt renovierte. Neu gebaut wurden nur drei relative kleine Ausstellungsräume zwischen dem ehemaligen Wohnhaus und dem zurückgesetzten Galerieteil. Mit dieser geringen Kubatur gelang den Architekten aber nicht nur das Transponieren eigener Themen, sondern auch eine adäquate Interpretation des Bestandes. Im Grundriss schliessen die drei neuen Räume den Galerieteil im Sinne eines einfachen Rechteckes ab, wodurch der Hof an der Rückseite des Haupthauses klar gefasst wird. Unterschiedliche Höhen definieren die einzelnen Räume als eigene Kuben, unterstützt durch die Fugen der Betonfertigteile, die die kleinen Baukörper jeweils auch in sich teilen. Im Inneren taucht das quaderförmige Volumen in der Form eines flachen Glaskörpers an der Decke auf. Dadurch soll das Oberlicht in den Raum geholt und besser verteilt werden. Das Thema unterschiedlicher Gebäudehöhen wird schliesslich auch bei den Dachvolumen aufgenommen. Diese überlappen die Ausstellungsräume ausserdem in der Horizontalen und führen damit die Komposition zur letzten Konsequenz. Funktionelle Überlegungen münden in einer eigenständigen gestalterischen Geste.
Die abstrakte Interpretation der Villa, die der erwähnten Baukörperstaffelung zugrunde liegt, wiederholen Gigon & Guyer auch auf der Ebene der Materialität. Die Architekten sprechen dabei von dem «‹alchimistischen› Versuch einer Adaption des Neubaus an den Genius loci». Dem Beton wurden deshalb zwei Materialien, die auch bei der alten Villa verwendet wurden, nämlich Jurakalkstein und Kupfer, in zerkleinerter Form beigefügt. Durch diese Kombination entwickelte sich eine rasche Patinierung, die bereits jetzt in der grünlichen Färbung des Betons erkennbar ist und die sich durch das mit Kupferionen angereicherte Dachwasser noch weiter verstärken wird. Die Farbe als ursprünglich immateriellstes Bekleidungsmittel der Architektur durchzieht die gesamte Wand. Die subtile Material- und Oberflächendifferenzierung ist typisch für eine aktuelle Architekturtendenz, sie präsentiert sich in diesem Zusammenhang aber konsistent und zugleich sinnlich. Während bei der Sammlung Reinhart das solcherart differenzierte einfache Volumen in der verdichteten Form noch immer erkennbar ist, gehen Gigon & Guyer beim Museum Liner in Appenzell einen entschiedenen Schritt weiter.
Innenraum und Aussenwelt
Das am Ortsrand gelegene Gebäude, das dem Maler Carl August Liner (1871-1946) und dessen Sohn Carl Walter Liner (1914-97) gewidmet ist, spielt auf Grund seiner Lage und Form mit dem Thema Industriebau. In diesem Sinn fehlt die repräsentative Geste. Statt dessen konstituiert sich - wie bei den anderen Beispielen - ein Ort der konzentrierten Wahrnehmung. Bei ihrem Entwurf für Davos wurden Gigon & Guyer unter anderem von den Reflexionen Rémy Zauggs zum Thema Kunstmuseum angeregt. Beim Museum Liner handelt es sich immer noch um einen Ort der Konzentration, auch wenn das Expressive mit der gezackten, skulpturalen Form in den Vordergrund rückt. Der Rhythmus der einzelnen Sheds wird dabei zusehends, enger und ihre Höhe nimmt ab. Gleichzeitig ändert sich die Grösse der Schindeln aus Chromstahlblech und verstärkt so die perspektivische Wirkung. An den Enden stülpt sich der längliche Baukörper nach aussen, und die verglasten Stirnflächen formen an dem sonst eher hermetischen Bau eigene Körper. Das Innere wird den Passanten in einer kleinen Box sichtbar gemacht, umgekehrt wird die Aussenwelt zu einer hervorgehobenen Szenerie im Inneren.
Die Fenster fungieren gleichsam als «Sehinstrumente» - ein Begriff, den Annette Gigon im Zusammenhang mit ihrem jüngsten Wettbewerb für den «Archäologischen Museumspark Kalkriese» in der Nähe von Osnabrück im Teutoburger Wald (NZZ 7. 8. 98) verwendet. Die Shedöffnung über der Eingangshalle sowie die übrigen Fenster fallen schliesslich auf Grund des äusseren breiten Rahmens auf, den man auch von anderen Bauten der Architekten kennt. Die Realität wird also bewusst in die Kunstwelt hereingeholt und lenkt natürlich auch ab, so wie dies die Räume in ihrer expressiven Form tun. Doch letzteres beschränkt sich auf den Deckenbereich, denn im Grundriss reihen sich kleine Rechtecke aneinander. Die offenen Fugen in den Raumkanten betonen die Konfiguration und lassen die Wände leicht und kartonartig erscheinen.
Auf gänzlich unterschiedliche Weise interpretieren die beiden jüngsten Bauten von Gigon & Guyer den jeweiligen Kontext. Trotz ihrer engen Verbundenheit mit der Deutschschweizer Architekturentwicklung finden Gigon & Guyer zu neuen, spezifischen Formen des Ausdrucks. Beim Wettbewerb für den Museumspark bei Osnabrück kehren sie zum klaren Gebäudekubus zurück. Die Herausforderung liegt hier in der Interpretation einer Landschaftszone, die im Jahr 9 n. Chr. Schauplatz der Varus-Schlacht war. So einfach die auf dem Gebiet verteilten Ausstellungspavillons erscheinen, so komplex präsentiert sich die Gestaltung des Freiraums. Auf abstrakt-sinnliche Weise sollen hier unterschiedliche Zeitschichten erfahrbar gemacht werden, und wieder bedienen sich Annette Gigon und Mike Guyer der Hervorhebung mittels gerahmter Ausschnitte. In einem abgegrenzten rechteckigen Feld wird die ehemalige Landschaft rekonstruiert - im Sinne eines «historischen Biotops», eines «Fensters in die Zeit». Die Darstellung von Distanz als reflektierter Form der Betrachtung wird bei diesem ebenso ungewöhnlichen wie interessanten Museumsprojekt zu einem konstitutiven Faktor des Entwurfs.
Für den Beitrag verantwortlich: Neue Zürcher Zeitung
Ansprechpartner:in für diese Seite: nextroom