
WienerBerg Dojo
Wien (A) - 2003
mit Michael Loudon, Walter Hans Michl
Architekturzentrum Wien
Studium der Architektur an der ETH; Baupraxis. 1977-85 Assistent bei Prof. A.M.Vogt und Doktorat in Architekturgeschichte an der ETH Zürich. Lebte seit 1985 in Wien und arbeitete auf dem Gebiet der Architektur als Entwerfer, Historiker, Kritiker, Kurator und Austellungsmacher.
Seit 1989 gemeinsames Atelier mit Architekt Walter Hans Michl in Wien: Möbeldesign, Bau- und Wettbewerbsprojekte, Wettbewerbsorganisationen, Juryteilnahmen, städtebauliche Konzepte.
Bauten: Stadthaus in Wien-Neubau, Kirchenzentrum St.Benedikt in Wien-Simmering. Konzept und wissenschaftliche Leitung für die Steirische Landesausstellung 1995, „Holzzeit“ und Initiierung der „Murauer Werkstätten“ (mit Franziska Ullmann, Wien).
Buchpublikationen u.a. über Adolf Krischanitz, Gustav Peichl, Boris Podrecca. Regelmäßige Architekturkritik im Spectrum (Die Presse, Wien) sowie Beiträge in Fachzeitschriften und Ausstellungskatalogen.
Die Auszeichnung von Bauherrschaften durch die Zentralvereinigung der Architekten hat eine mehr als 30jährige Tradition. Sie erinnert daran, daß Qualität eben auch von dieser Seite her angestrebt werden muß, damit Architektur zumTragen kommt.
Wenn der Gastkommentator Alf Gerd Fantur beklagt, daß Wien wieder häßlicher werde (in der „Presse“ vom 16. November, Seite 2), reiht er sich ein in den depressiven Chor jener, die nur immer das Schlechte sehen und von diesem solcherart überwältigt werden, daß sie jede Hoffnung auf Besserung fahren lassen. Natürlich überwiegt in der Masse des Gebauten seit undenklichen Zeiten das Belanglose, eklektisch Zusammengegrapschte, gestalterisch Unbeholfene oder gewinnsüchtig Hingeklotzte. Warum sollen ausgerechnet beim Bauen, wo soviel Kapital auf dem Spiel steht, andere Regeln menschlichen Verhaltens vorherrschen?
Es gibt jedoch eine kleine radikale Minderheit, die, weil sie qualifiziert ist, sich nicht einfach majorisieren läßt, die Architektur will und dies auch im Verein mit Fachleuten anstrebt. Das sind Bauherren und ihre Architekten und/oder Architektinnen, die sich Kultiviertheit leisten und dies in Architektur ausdrücken.
Wer die 92 Einreichungen für den diesjährigen „Bauherrenpreis“ durchgeht, wird vielleicht überrascht sein von der Breite und Qualität des Angebots. Das österreichische Bauschaffen erweist sich an den im vergangenen Jahr fertiggestellten Bauwerken als engagiert und auf hohem Niveau angesiedelt.
Die Endauswahl gab den Juroren, Marta Schreieck, Bart Lootsma und Dietmar Steiner, einiges zu beißen. Was vor zehn Jahren noch locker in die Preisränge hätte aufschließen können, hebt nun im Verein mit anderen den Durchschnitt der eingereichten, aber nicht ausgezeichneten Bauwerke.
Es ist nämlich nicht wahr, daß es mit der Architektur bergab geht. Das Gegenteil ist der Fall: Es gibt mehr qualifizierte Architekten pro Kopf der Bevölkerung als je zuvor. Und wenn eine wachsende Zahl Bauherrschaften, wie dies zur Zeit feststellbar ist, sich für das Zustandekommen von Architektur einsetzt, wird die Zahl qualifizierter Bauwerke pro Jahr weiter wachsen.
Wie bei jeder kulturellen Entwicklung in die Breite kann nicht jedes Werk ein avantgardistisches Manifest sein, das widerspräche der Natur dieser Charakterisierung. Aber es kann an dem Ort, wo es steht, gut dastehen und einstehen, wofür es dasteht. Damit ist so ein Bauwerk natürlich auch immer eine Kritik an jenen Bauten, deren Gestalter sich in ihrem Tun verhaspelt haben. Das ist in anderen künstlerischen und Hochleistungsdisziplinen nicht viel anders. Das müssen beide Seiten aushalten.
Ein Blick auf die acht mit einem Preis ausgezeichneten Bauherrschaften zeigt drei Gruppen: private Persönlichkeiten (drei Bauten), öffentliche Hände (drei Bauten) und Körperschaften öffentlichen Rechts (zwei Bauten). Das Wahrnehmen von architekturkultureller Verantwortung ist auf der zivilgesellschaftlichen Seite nicht schwach vertreten, was zu hoffen Anlaß gibt. Dasselbe gilt für jene der Gemeinwesen, obwohl sie dort noch verbreiteter zu Hause sein müßte, weil die kulturelle Verantwortung eine institutionelle ist. Jede Auswahl ist zudem Ausdruck der spezifischen Jury-Atmosphäre und -Diskussion, wofür die Mitglieder des Gremiums die Verantwortung übernehmen. Und das Ausscheiden fiel in diesem Jahr gewiß nicht leicht.
Nicht die Größe des Bauwerks ist für seine Qualität maßgebend. Das beweisen das Feuerwehr- und Kulturhaus in Hittisau im Bregenzer Wald, die Schlosserhalle in Trumau im südlichen Niederösterreich und der Kinder- und Jugendhort in Taxam bei Salzburg. Bürgermeister Konrad Schwarz hatte es nicht immer leicht, seinen Bregenzerwäldern den klaren Entwurf der noch nicht 40jährigen Architekten Andreas Cukrowicz und Anton Nachbaur-Sturm nahezubringen, denen der erfahrene Baukünstler Siegfried Wäger zur Seite stand. Die Verknüpfung von Zweckbau als Rüst- und kultureller Nutzung als Veranstaltungshaus einte jedoch die Bürger. Heute bestreiten sie ein engagiertes Kulturprogramm in der räumlich ansprechenden Struktur, die im Hauptgeschoß mit viel Holz und differenzierter Licht- und Blickführung Stimmung schafft. Im Sockelgeschoß gelang es, für das Feuerwehrmagazin eine zwar technische, aber dennoch angenehme Atmosphäre zu erzielen.
Hinreißend ist die von Ursula und Ernst Holzmann gewagte Kombination von Schlosserei und Bar am Dorfrand von Trumau, deren rostende Fassadenbleche mit den bündig sitzenden Glasflächen kontrastieren. „Pool Architektur“ - das sind Christoph Lammerhuber, Axel Linemayr, Florian Wallnöfer und Evelyn Wurster (alle unter 40) - haben an die Werkhalle eine schräge Bar komponiert, die nach außen wirkt und deren vielversprechendes Inneres - natürlich mit viel Stahl - tagsüber als Sozialraum dient und abends zu einem gut frequentierten regionalen Treffpunkt zu werden verspricht. Der Blick durch hohe Glasscheiben in die Werkstatt ist im Bierpreis inbegriffen.
Salzburgs Baudirektor Walter Hebsacker scheute sich nicht, das anspruchsvolle Projekt eines hölzernen Aufbaus für den einer Schule angefügten Hort auf eine bestehende Schwimm- und Turnhalle von den ebenfalls noch nicht 40jährigen Architekten Maria Flöckner und Hermann Schnöll ausführen zu lassen. Einfühlsam gestaltete Räume und Raumzonen sowie ein Nullenergiekonzept für den Neubauteil bilden den Ertrag dieses Verfahrens, von dem vor allem die Kinder und Jugendlichen profitieren werden.
Daß die einzigartige Initiative von Agnes und Karl-Heinz Essl für den privat finanzierten Museumsbau in Klosterneuburg einen Bauherren-Preis verdienen würde, war wohl am leichtesten zu erraten. Die für Wien typischen anfänglichen Unkenrufe sind längst verstummt, die Architektur von Heinz Tesar wurde von berufener Seite gewürdigt, und der lebendig gestaltete Betrieb sichert dem gewichtigen kulturellen Ort vor den Toren Wiens eine florierende Zukunft.
Die Generali-Gruppe kann bereits auf eine Reihe engagierter Bauwerke verweisen, darunter die damals überraschende Skulpturenhalle im Inneren eines Baublocks in Karlsplatznähe. An dem ungleichen Turmpaar über dem Donaukanal konnte Hans Hollein wesentlich ungestörter arbeiten als an dem populistisch angefeindeten Haus am Stock-im-Eisen-Platz. Auch wird sein Bestreben nachvollziehbar, antagonistische Volumen und plastische Bewegungen vom Groß- ins Kleinmaßstäbliche gleichsam auspendeln zu lassen und auf diese Weise Gegensätze sichtbar zu machen und doch zu versuchen, sie zugleich aufzulösen.
Rationalität in der strukturierten Durcharbeitung, gepaart mit ökonomischer Konsequenz, zeichnet die Wohnanlage für die Neue Heimat Tirol am Lohbach in Innsbruck aus. Über mehrere verschiedenerorts gebaute Etappen haben Carlo Baumschlager und Dietmar Eberle mit ihrem bekannt effizienten Büro einen Typus präzisiert und weiterentwickelt, dessen Reife sich darin zeigt, daß er nicht schematisch reproduziert, sondern jedes Mal durch neuerliche Überlegungen verbessert wurde.
Eine besondere Rolle spielt der Umgang mit alter Bausubstanz, weil sich darin sowohl Sensibilität der Analyse als auch gestalterische Kraft erkennen lassen. Dem Grazer Kaufmann Albin Sorger wird es 1993, bei Planungsbeginn, noch nicht bewußt gewesen sein, worauf er sich mit dem denkmalgeschützten Bestand der ehemaligen Stadtmühle eingelassen hatte. Dem heute 41jährigen Burgenländer Hans Gangoly gelang es, mit seinem komplexen Entwurf und seiner Fähigkeit zum Gespräch sowohl das Denkmalamt zu begeistern als auch den Bauherrn von der Notwendigkeit zu überzeugen, der beeindruckenden, alten Tragstruktur aus Holz eine räumlich spannende, neue Funktionsstruktur mit verschieden großen Wohnungen zu überlagern. Das Resultat ist feinsinnig, vermeidet allerdings harte Gegensätze von aufgesetzter Radikalität. Nichtsdestotrotz ist es eindeutig ein Stück Architektur, das am Ende des Jahrhunderts ins nächste weist.
Mit der Bewahrung der in den fünfziger Jahren von den Architekten Ramersdorfer & Meusburger unbekümmert und locker hingebauten Alten Textilschule hat der Stadtplaner von Dornbirn, Markus Aberer, wichtige Pionierarbeit geleistet, ist doch das Verständnis für Bauwerke aus dieser Zeit noch keineswegs selbstverständlich, denn gerade in jüngster Zeit mehren sich die Verluste in unverzeihlicher Weise. Unterstützt von Bürgermeister Wolfgang Rümmele, Stadt Dornbirn, und vom Land Vorarlberg, gelang es, dieses Bauwerk nicht bloß zu erhalten, sondern in der Fachhochschule Vorarlberg auch eine passende und vitale, die Anlage aufwertende Nutzung zu finden.
Die bereits mehrfach bewährten Vorarlberger Fachleute Helmut Dietrich, Hermann Kaufmann, Christian Lenz und Wolfgang Ritsch erneuerten teils sanft und flexibel abgestuft, bewältigten aber auch schwierige bautechnische und bauphysikalische Probleme unter Wahrung des spezifischen architektonischen Ausdrucks der Bauzeit. Mit Präzision und Sparsamkeit bewiesen sie den architektonischen Wert des Bauwerks, indem sie ihm neuen Glanz verliehen, ohne den Widerschein der dynamischen, heute bereits verklärten fünfziger Jahre zu überstrahlen.
Die acht prämierten Beispiele bilden die Spitze eines Bergs von Beispielen, die seit vorigem Jahr in Österreich neu dazugekommen sind. Sie beweisen, daß es um die Architektur in Österreich so schlecht nicht stehen kann. Die geographische Verteilung über die Bundesländer sollte aber nicht zuletzt der alten Metropole Wien zu denken geben.
Der Spielraum bei der Errichtung eines Bürohauses in der Brünner Innenstadt war denkbar knapp. Doch Sapák, Skrabal und Grym verschafften sich Luft genug für eine städtebaulich angemessene und handwerklich souveräne Lösung in der Tradition der tschechischen Moderne.
...folgt.
Oftmals überanstrengt zeitgenössisch, nicht selten volkstümelnd: Schulhausbau auf dem Land. Anders in Dobl bei Graz: Dort haben Klaus Leitner, Peter Pretterhofer und Sonja Simbeni eine Volksschule mit Mehrzwecksaal intelligent in die Landschaft hinzugefügt.
Wenige Autominuten süd- westlich von Graz liegt das Dorf Dobl am Fuß eines niedrigen Hügelzugs, dessen flache Kuppe ein kleines Schloß, die Kirche, das alte Schulhaus sowie einige Nebengebäude und mehrere Wohnhäuser trägt. Ostseitig, an der Geländeschulter, schließen zwei neu errichtete Baukörper für Volksschule und Mehrzwecksaal den Kirchenbezirk räumlich ab.
Keine 200 Meter weiter nördlich ragt ein konstruktiv interessanter Sendemast in den Himmel, dem umfangreiche Baulichkeiten zugeordnet sind, die erkennbar aus den frühen vierziger Jahren stammen. Es handelt sich um die ehemalige Station „Alpen“ des Senders „Donau und Alpen“ mit einer Reichweite von Norwegen bis Nordafrika. Später sendete von hier der ORF; heute dienen die Räume einem Privatradio. Im Ausgedinge trägt der Mast eine Batterie Mobilfunkantennen.
Die Anlage steht unter Denkmalschutz. Friedrich Achleitner, der die monumentale Baukörperfolge entlang der Hangkante vor Jahren registrierte, attestiert ihr insofern Bedeutung, als es sich „um ein selten gut erhaltenes Beispiel eines technischen Baus handelt, der unter rigorosen ideologischen Bedingungen entstand“.
Nun, dieselbe Hangkante trägt auch die uns interessierenden Schulgebäude. Der Entwurf lehnt sich gestalterisch nicht an die nördliche Nachbarschaft an. Siedlungsbaulicher Bezug ist die Gebäudegruppe um die Kirche. Die Architekten verdrängen nicht, sondern analysieren nüchtern den prinzipiellen Charakter der ordensburghaft dräuenden Anlage. Und stoßen dabei auf die Art, wie Architekt Walther Schmidt, Berlin, sich auf die Topographie bezog. Das übrige an gestalterischem Ausdruck sei Fachleuten Mahnung, sogar Warnung, eine Identifikation mit demonstrativ totalitärer Machtpolitik vorher zu bedenken, nicht nachher zu vermelden, man hätte nicht anders gekonnt. Achleitner „erscheint die Anlage als eine Art Psychogramm einer Ideologie und als Akt der symbolischen Verklammerung gespaltener, ja konträrer Interessen“.
Jedenfalls vermieden die Entwerfenden - Klaus Leitner, Peter Pretterhofer und Sonja Simbeni - eine Überreaktion. Sie plazierten ihre breitgelagerten Baukörper solcherart an die Hangkante, daß die beiden Teile in der Ansicht von Osten, von wo auch die neue Zufahrt erfolgt, den spitzbehelmten Kirchturm flankieren. Im südlichen Trakt (im Bild rechts) befindet sich die Volksschule, im nördlichen Trakt der Mehrzwecksaal. Von der hofartigen Plattform dazwischen bietet sich ein Ausblick über den sanften Abhang, Straße und Wald. Talseitig wird erkennbar, daß die beiden von oben getrennt scheinenden Teile im unteren Geschoß verbunden sind. Längs über beide Baukörper ziehen sich hohe Dachaufsätze, die über der Mehrzweckhalle den Lüftungsaggregaten, über der Schule jedoch einer durchdachten Innenbelichtung dienen.
Ein erdig dunkles Rot verleiht dem Äußeren der Anlage elementare Kraft, deutet aber zugleich nach Skandinavien: zu Gunnar Asplund und anderen. Nein, hier stand nicht die „Grazer Schule“ Pate, sondern eine in der Steiermark vorhandene schmale Architekturströmung, die auf das Wirken von Franz Riepl zurückzuführen ist. Klaus Leitner und Peter Pretterhofer, ehemalige Assistenten des Grazer Professors, sowie Sonja Simbeni haben als Team den 1998 ausgeschriebenen Wettbewerb gewonnen. Anton Weber, der durchsetzungskräftige junge Bürgermeister von Dobl gab als Bauherr Tempo vor, und zum heurigen Schulbeginn wurde eröffnet.
Was heute von außen betrachtet zurückhaltend selbstbewußt dasteht, birgt im Inneren eine räumlich interessante und von der Lichtführung her wirkungsstarke Konstellation versetzter Ebenen und räumlicher Durchdringungen. Der an seiner Längsseite nach Osten geöffnete Dachaufsatz läßt das Licht auf die gegenüberliegende gebäudelange Wandscheibe fallen. Von hier wird es diffus hinunter in die Ganghalle reflektiert, die längs mittig das Bauwerk durchzieht. Ohne Blendung gelangt damit eine große Lichtfülle in den die gesamte Anlage erschließenden Raum.
Die obere Zugangsebene greift ins Bauwerk hinein, wo ein geräumiges Foyer bei Regenwetter als Pausenbereich dient. Von hier führen zwei Stiegenanlagen zu den beiden halbgeschoßig versetzten Ebenen der ostorientierten Klassenzimmer. Einmal quer zur Längsachse, die vom vertikalen Lichtraum verkörpert wird, und einmal parallel dazu, was erlaubt, beim Wechsel der Niveaus den hohen Längsraum auf zwei Arten zu erfahren.
Derzeit modische Glasbrüstungen sucht man hier vergebens, weil die Entwerfenden massive Brüstungen zur räumlichen Definition sowie als lichtstreuende Flächen einsetzen. Daß sich unter der Spachtelung und einem dematerialisierend weißen Anstrich meist scheibenförmige, strukturell tragende Glieder aus Stahlbeton verbergen, wird nur fachkundigen Beobachtern auffallen. Sie ermöglichen jedoch langgezogene, stützenfreie Öffnungen, die vor allem räumlich wirken, ohne ihre statisch-konstruktive Funktion in den Vordergrund zu stellen.
Die Lichtfülle läßt einen attraktiven Binnenraum entstehen: nicht Lichthof, nicht Korridor, eher ein räumliches Herz des Schulgebäudes, von dem alle angrenzenden Zimmer und Räume profitieren. Vom Foyer blickt man diagonal durch gangseitige Oberlichter über die Köpfe der somit ungestört lernenden Schüler hinweg, aus den ostseitigen Fenstern auf die Wiese. Auch in dieser Außenmauer wird das Prinzip einer - in diesem Fall gelochten - Scheibe angewendet.
Um dies anzudeuten, sind die Fenster versetzt angeordnet. Im Grundriß ist die aus dem Versatz resultierende halbe Klasse als Gruppenraum vermerkt. Scheinbar formale Aspekte erweisen sich damit als mit dem Kontext des architektonisch sorgfältig durchkomponierten Gesamtkonzepts vernetzt.
Der Mehrzwecksaal öffnet sich nach Osten auf einen Vorplatz, den ein halbes Dutzend Linden in wenigen Jahren beschatten werden. Im Inneren verschwinden die Sportgeräte hinter Wandverkleidungen, weil man für die zahlreichen Anlässe der Dorfgemeinschaft den Turnhallencharakter hintan halten wollte. Eine einfache Bar im unteren Foyer, von einer schwenkbaren Wand verdeckt, verspricht heiteres Festefeiern. Damit ist für Schule und Dorfgemeinschaft doppelt vorgesorgt: architektonisch auf überregional herzeigbarem Niveau, ist das Bauwerk zugleich einfühlsam gegenüber Ansprüchen des lokalen Dorflebens.
Ein Stahl-Tragsystem, OSB-Spanplatten, Welleternit: Petr Hrusa und Petr Pelcák setzten bei ihrer Tennishalle in Litomisl, Tschechien, billigste Materialien ein. In deren Gestaltung erweisen sie sich allerdings als souveräne Fortsetzer der tschechischen Moderne.
Das tschechische Städtchen Litomisl verfügt über einen beachtlichen historischen Stadtkern mit einem weiträumigen Hauptplatz. Kulturbeflissenen ist der Name vielleicht bekannt als Geburtsort des Komponisten Bedrich Smetana, dessen Denkmal das Zentrum ziert. Oder man kennt Litomisl einfach als eine der zahlreichen liebenswürdigen Kleinstädte, die zu besuchen sich immer lohnt, weil sich dort manches erhalten hat und somit nachvollziehbar bleibt, was in größeren Städten vom Zeitenlauf überfahren oder weggefegt wurde. Im Guten wie im Schlechten atmen sie Geschichtlichkeit des Alltags, von Handwerkern und Kaufleuten, von Bürgerstolz und -sturheit, Aufstieg und Niedergang.
Nun hat Litomisl heute das Glück, von initiativen und kulturbewußten Leuten regiert zu werden, die um den Wert des Stadtbildes wissen, für die aber die Geschichte nicht im 19. Jahrhundert stehengeblieben ist. Was heute neu entsteht, soll daher zeitgenössische Züge tragen, was an Hand einer 1999 fertiggestellten Tennishalle eindrücklich bewiesen wird.
Die Sportanlagen befinden sich etwas außerhalb der Stadt im Zuge eines flachen Bachtälchens, das von Birken und verschiedenerlei Pappeln gesäumt wird. Kleingärten verleihen der südexponierten Talflanke ein spezifisches Flair, an der gegenüberliegenden Seite zieht sich ein beliebter Spazierweg an der Geländeschulter hin, und im Talgrund reiht sich ein halbes Dutzend Tennisplätze dem Bachlauf entlang, die vom Weg her gut einsehbar sind.
Ein Mehrzweckgebäude mit einer Übungshalle für Tennis, drei Squash-Courts, ausreichend Garderoben, der Platzwartwohnung und einem kleinen Restaurant sollte dazukommen. Kosten durfte es nicht viel, da die Einbauelemente der Squash-Anlage komplett aus den USA importiert werden mußten, was in einem ostmitteleuropäischen Reformland eine extrem hohe ökonomische Barriere bedeutet.
Die beiden Brünner Architekten Petr Hrusa und Petr Pelcák gewannen das Auswahlverfahren mit dem Entwurf für einen einzigen Baukörper, den sie in Talrichtung auf die Geländekante setzten, die Niveaudifferenz mit zwei Zugängen nützend. Gut drei Fünftel des Baukörpers beansprucht die Tennishalle, den Rest teilen sich im Untergeschoß Garderoben und Clubräume, im Hauptgeschoß Squash-Courts und Restaurant sowie - im Obergeschoß über dem Restaurant - die Wohnung für den Platzwart mit Familie.
Ein flaches Satteldach aus Welleternit deckt den langen Baukörper, dessen Nordfassade über das Tal hinweg die Aufteilung vermittelt: ein langes, tiefliegendes Bandfenster vor der Tennishalle und, etwas kürzer, eines vor dem Restaurant, mit großen Schiebeelementen, sommers zu öffnen, sodaß der Schankraum zur Loggia wird und Aussicht auf die Tennisfelder bietet.
Kostengünstig bauen heißt, beim in großen Flächen erforderlichen Material das billigste in einfachster Verarbeitung zu wählen. Die Außenhaut besteht aus zementgebundenen Spanplatten ohne Anstrich. Innen wurden OSB- Spanplatten verwendet, deren große Späne ein typisches Muster erzeugen. Für das Tragsystem wurde eine Standard-Stahlkonstruktion aus dem Industriehallenbau gewählt. Damit war die Stimmung bereits weitgehend vorgegeben. Das eher ärmlich wirkende Material drohte jeden gestalterischen Anspruch zu unterlaufen.
Die Strategie der Architekten zielte auf Sorgfalt: Sorgfalt in den Proportionen, Sorgfalt in den Details und Sorgfalt bei der Gestaltung der Öffnungen. Mit großen, längsrechteckigen Tafeln wird die Fassade strukturiert. In die horizontalen Fugen eingesetzte Eichenholzleisten betonen die lagerhafte Ruhe der Fassade, die Tafelgröße liegt zwischen kleinteilig und großflächig, das heißt zwischen texturiell und atektonisch. Mit der Zwischengröße gelingt es, im Verhältnis vom Teil „Platte“ zum Ganzen „Hallenbau“ eine Proportion zu finden, die Monumentalität anklingen läßt. Dies reicht aus der Distanz prinzipiell aus, das Bauwerk als „Architektur“ anzukündigen.
Die Öffnungen sind der Plattenordnung unterworfen. Damit erhält letztere, trotz des extrem preiswerten Materials, mehr formales Gewicht. Die differenzierte Behandlung der Öffnungen - fassadenbündig in Metallkonstruktion für die großen Fenster, tiefliegend in Holzkonstruktion für die kleinen sowie leicht vorstehend in Metallbau für den Haupteingang - ergibt ein weiteres qualitatives Gegengewicht zum Material.
S orgfältig durchdachte Details bis hin zur Wahl der Schrift beim Eingang verleihen dem Bauwerk auch aus der Nähe betrachtet jene Qualität, die im Gesamtkontext zu angemessenem kulturellem Gewicht verhilft. Denn man soll nicht vergessen, es ist eine Sporthalle, keine Kirche, aber auch keine Industriehalle.
Im Inneren setzt sich das Prinzip Aufwertung mit einfachsten Mitteln fort. Sei dies die gelungene Kunst am Bau durch einen Maler, der im Gang die Wände mit einem fröhlich-frischen Muster versah. Oder seien dies die Möbel im Restaurant, wo speziell entworfene, gewichtige Tische mit klug ausgewähltem Standardmobiliar jene Mischung bilden, die sich klar von einem Kantinenklima unterscheidet. Die große Halle ist bestimmt von der Wirkung der OSB-Platten, deren gelbbrauner Holzton die Alterung vorwegzunehmen scheint. Das Gefüge der sichtbaren, rot gestrichenen Stahlkonstruktion und die akustisch wirksamen, einfachen Lat- tenroste an den Stirnseiten relativieren die Gefahr nostalgischer Fünfziger-Jahre-Verklärung.
Mit ihrer Tennishalle in Litomisl gelang Petr Hrusa und Petr Pelcák ein Bauwerk, das sich von jenen Investorenkubaturen unterscheidet, die in vielen Fällen das Bild neuer Bauten in den tschechischen Städten prägt. Sie demonstrieren die Souveränität bewußten Architektenhandwerks über die materiellen Bedingungen und setzen die Tradition der entwickelten Moderne fort, die sich in der Tschechoslowakei bis 1938 auszubreiten vermochte. Nach der jahrzehntelangen, für die Architektur lähmenden Phase kollektivistischen Ungeists finden sich mittlerweile nicht nur vereinzelte Bauwerke von ansprechender Qualität, wie ein Blick in die aktuelle Prager Architekturzeitschrift „Architekt“ bestätigt.
Auch wenn es vorerst eher kleinere Umbauten und Einfamilienhäuser sein mögen - so hat es andernorts mit der Wiedererweckung der Architekturkultur auch angefangen.
Zwischen Reihenhaus, verdichtetem Flachbau und Geschoßwohnungsbau: Walter Stelzhammers Atriumhäuser sind eine eigene, zukunftsträchtige Kategorie dichten urbanen Wohnbaus, weil sie für vielfältigste Bedürfnisse Räume und Zonen bereitstellen.
Der lange, gedrungene Baukörper füllt fast das gesamte Grundstück. Gerade daß man mit dem Automobil außen herum fahren kann und noch ein schmaler Streifen Grün bleibt. Die Stirnseite zur Ziedlergasse nahe dem Kirchenplatz ist fast blind zu nennen. Zwei niedrige Fenster und ein hinter Betonbrüstungen gut geschützter Balkon verstärken die abschirmend geschlossene Wirkung der weißen Mauer. Auch die langen Seitenfassaden, die das eingezogene Kellergeschoß überragen, sind wenig geöffnet, aber dennoch nicht unfreundlich. Ein kleiner Balkon zum Hinaustreten mag dem Gespräch mit Kindern, Besuchern oder Nachbarn zu ebener Erde dienen.
Erst die Vogelschau bietet Einblick in die Struktur, die das differenzierte Innenleben verständlich werden läßt. Denn die dicht aneinandergefügten Wohn- einheiten sind nach oben, zum Lebensraum der Mauersegler und zu den Wolken geöffnet. Zwei Zeilen quadratischer Atrien sind zwei Geschoße tief in den Baukörper eingeschnitten. Daran fügen sich U-förmig die Wohneinheiten, einen Schenkel zur Fassade, den anderen zur Mittelmauer, die sich längs durch den gesamten Baukörper zieht. Zweimal neun Atrien zu zwei Wohneinheiten ergibt 36 Häuser zu 130 Quadratmeter Wohnfläche in einer Großform. Die Erbauer nennen es „Wohnarche“. Ein kleiner, zweiter Block daneben enthält weitere sechs Einheiten.
Walter Stelzhammer, Plischke-Schüler mit einem Naheverhältnis zum osmanischen Kulturraum, ist ein zäher Forscher und Tüftler, der sich seit Jahren mit Fragen verdichteten Wohnens auseinandersetzt. Sein Entwurf für ein doppelt breites Handtuchgrundstück in Atzgersdorf, unter extrem kostenkritischen Bedingungen entstanden, ist seit der Wohnanlage Schmidgunstgasse in Simmering von Franz E. Kneissl das interessanteste Wohnbauwerk dieser Art. Zwischen Reihenhaus und verdichtetem Flachbau einerseits und dem Geschoßwohnungsbau andererseits beansprucht diese Strukturform eine dritte Kategorie, die als intelligente Alternative eines dichten, urbanen Wohnens längerfristig Zukunft hat.
Als erstes trennt Walter Stelzhammer das Atrium mit einer schalldämmenden Milchglaswand in zwei Teilräume, sodaß die Nachbarn sich akustisch nicht stören, der Charakter des Hofes aber dennoch nicht beengend wird. Sodann stapelt er zwei Wohngeschoße auf das Sockelgeschoß, deren Licht- und Luftbezug vornehmlich durch das Atrium erfolgt. Eine baurechtlich gefinkelte, teilweise öffenbare Glasüberdachung ermöglicht unterschiedliche, auf die Witterung abgestimmte Formen der Nutzung. Am Dach bietet der Architekt ein großzügig verglastes Dachzimmer, eine blick- und windgeschützte sowie eine offenere Terrasse an, die sich die Bewohner unter Zuhilfenahme der Produkte aus Baumärkten umgehend in lauschige Dachgärten verwandelt haben.
In den Schenkeln des Grundriß-U befinden sich Wohnräume, die nicht oder wenig spezifiziert sind. Es lassen sich mehrere Varianten, bis zur Teilung in zwei Kinderzimmer, durchspielen. Das Verbindungsstück enthält die Treppe, Sanitärräume und den zum Atrium verglasten Gang. In den großzügigen Vorraum im Sockelgeschoß kann eine komplette Familie inklusive Hund eintreten, um begrüßt zu werden. Hinter der Stiege schließt der Kellerraum an. Das Auto läßt sich vor dem Hauseingang parkieren, wo man regengeschützt aussteigen kann.
Das Atriumhaus kennen wir aus dem Mittelmeerraum schon seit Jahrtausenden. Seit die Bautechnologie die Feuchteabdichtung beherrscht, ist es auch in unseren Breiten möglich geworden, Hof und angrenzende Räume für den Aufenthalt angenehmer zu machen. Dank der Lage im ersten Obergeschoß und des glasklaren Schiebedachs entsteht ein angenehm intimer Wohnbereich, weder drin noch draußen. Walter Stelzhammer erweist sich als vorausschauender Wohnbauarchitekt, der weder Ideologien vorgibt noch zwanghaft modische Auslenkungen inszeniert, sondern für die vielfältigsten menschlichen Tätigkeiten, Bedürfnisse und Befindlichkeiten Räume, Zonen und Bereiche bereitstellt.
Denn die Menschen sind nicht bloß verschieden, sie verhalten sich sowohl zu Tages-, Nacht- und Jahreszeiten anders als auch in den Lebensaltern. Der Vielfalt an Ansprüchen begegnet Stelzhammer mit einem trotz aller ökonomischen Einschränkungen offenen Prinzip. Dabei ist es nicht unerheblich, daß die Stiege durch das Haus hinaufführt, auf das flache Dach. Auch wenn von dort kein Weg weiter führt, bieten die räumliche Entspannung und die Öffnung zum Himmel wesentlich mehr als etwa der Dachraum eines konventionellen Hauses.
Wohnen heißt in unserem Kulturraum vor allem auch, sich individuell zurückziehen zu können, sich zu sammeln, frei gewählte Intimität und die Abschirmung vom Gewühl der Agglomeration zu genießen. Da bietet der Zugang zu einer privaten Dachterrasse einen kaum zu überschätzenden Wert: individuelles Außenwohnen unterm Himmelsgewölbe oder unterm Sternenzelt. Das sind konzeptionelle Qualitäten, die einen sparsamen Ausbaugrad im übrigen Bereich mehr als kompensieren.
Im Vergleich mit den etwa zehn Jahre älteren Atriumhäusern der Wohnanlage Traviatagasse, wo die Organisation der privaten Außenräume auf halbem Weg stehengeblieben ist, bietet die Wohnanlage in Atzgersdorf mehr und sorgfältiger durchdachte Antworten zur Wohnungsfrage.
Nun wird sich manch einer denken, daß dies in den Außenbezirken noch angehen möge, aber in den dicht verbauten Quartieren innerhalb des Gürtels zu eng empfunden würde. Dem ist nicht so, entgegnet der unermüdliche Planer und legt ein Projekt vor, das er an der Kaiserstraße, im Baublock zwischen Bernardgasse und Neustiftgasse bearbeitet. Das schmallange Grundstück wird im Süden von einer hohen Feuermauer beschattet. An diese lehnt sich nun eine Zeile gestapelter Atriumtypen an, deren Binnenräume zum langgezogenen Hof hin loggienartig offen oder verglast sind.
Der fünfgeschoßige Aufbau enthält im Erdgeschoß Ateliers, denen im Mezzanin Galerieräume zugeordnet sind. Darüber, im ersten Stock, ist eine Einliegerwohnung eingeschoben, die aber auch mit dem Atelier verbunden werden kann. Ihr Hauptzugang erfolgt über einen deutlich abgerückten Steg entlang der gegenüberliegenden Grundstücksgrenze.
Ein weiterer, dem klassischen Wohnen dienender Atriumtyp wird nun darüber gestapelt. Die Besonnung ist angemessen, für Ateliers wäre sie schon fast wieder unangenehm. Das Prinzip folgt dem Wohnungstyp in Atzgersdorf; nur die Glaswand zum großen Hof ist selbstverständlich durchsichtig. Natürlich verfügt das Haus über eine Dachterrasse.
Die kompakte Wohnform paßt in den dicht verbauten siebten Wiener Gemeindebezirk, weil sie vom Nutzungsmix her Ansprüchen entspricht, wie sie hier von Bewohnern gern gestellt werden. Es zeigt sich auch, wie anpassungsfähig der Atriumtyp ist, da seine Addierbarkeit nahezu beliebig ist.
Indem er Licht und Luft über das Atrium hereinholt, sind keine weiteren Fenster erforderlich, können aber dort, wo sinnvoll und möglich, gesetzt werden. Der Straßenlärm wird nebensächlich, und die Einsichtproblematik stellt sich kaum, weil das Gegenüber zur selben Wohneinheit gehört. Unterschiedliche Größen sind kein Problem, weil jeweils ein Schenkel des „U“ weggelassen werden kann, was die Wohnfläche fast halbiert.
Ein hoher Vorfertigungsgrad wurde bereits in Atzgersdorf realisiert, wobei hier die junge Generation in der Leitung der Generalunternehmung ihr Verdienst am Zustandekommen der Innovation hatte. Denn selbst wenn heute die Bauträger bereit sind, innovative Konzepte durchzudenken und anzubieten, muß dieser Schritt auch bautechnisch und in der Ausführung erfolgen, weil sonst die Kosten nicht gesenkt werden können.
Vorfertigung steht bis heute unter dem Verdacht, der Grund für schematische Fassaden und unflexible Grundrisse zu sein. Das trifft jedoch so nicht zu. Vielmehr existieren noch ideologische Rudimente aus den zwanziger und dreißiger Jahren, als parallel zu Industrialisierung und Fordismus totalitäre, gleichschalterische Ideologien um sich griffen. Sie flossen und fließen nicht selten unbewußt in die Entwürfe und Ausführungen ein.
Im Gegensatz zu funktionalisierten, prästabilierten Zimmerteilungen schaffen daher offe-ne, nutzungsneutrale Grundrisse entscheidende Voraussetzungen zur Entwicklung individueller Ausdrucksformen, die dann jene gelebte kulturelle Vielfalt zuläßt, die beispielsweise an den Dachgärten, in der Draufschau von gar nicht so weit oben, ablesbar wird.
Ob Weltausstellungspavillon, Espresso-Bar oder Zigarettenpackung: Oswald Haerdtl, 1899 bis 1959, nahm sich auch scheinbar nebensächlicher Dinge der visuellen Kultur an. Adolph Stiller präsentiert in einer Wiener Ausstellung die Breite von Haerdtls Werk.
Dem Wiener Architekten und Designer Oswald Haerdtl, 1899 bis 1959, ist im Vergleich zu Josef Hoffmann, Adolf Loos oder selbst Josef Frank nicht dieselbe internationale Beachtung zuteil geworden. Fast drei Jahrzehnte jünger als sein mittlerweile weltbekannter Lehrmeister Josef Hoffmann, war er in den zwanziger Jahren als Nachfolger von Max Fellerer zum Büroleiter aufgerückt und wurde in den dreißiger Jahren Atelierpartner Hoffmanns, von dem er sich aber 1939 trennte.
Studiert hatte Haerdtl bei Oskar Strnad. Zur Architektur war er über die Graphische Lehranstalt, eine Tischlerlehre und das Studium der Malerei gekommen. Seine Begabung für visuelle Wahrnehmung war somit mehrfach geschult, und von einem feinsinnigen Tastgefühl zeugen die zahlreichen, angenehm zu besitzenden Möbel aus seiner Hand.
Diese Kultiviertheit versuchte er unablässig auf seine Umgebung zu übertragen. Tatmensch und manischer Arbeiter, der er war, hielt er tief in die Nächte hinein zeichnend seine Gedanken fest und bereitete den Mitarbeitern die Arbeit für den nächsten Tag vor. Während seiner beruflichen Entfaltung geriet Oswald Haerdtl in die kulturellen Umbrüche der zwanziger und dreißiger Jahre, hielt aber Distanz zur totalitären Entwicklung und lavierte, wohl auch mit Glück, durch Naziherrschaft und Weltkrieg, um danach mit Energie und größtem Einsatz zur kulturellen Wiederbelebung beizutragen.
Während Josef Hoffmann - auch - edle Zigarettenetuis entworfen hatte, befaßte sich Kettenraucher Haerdtl - auch - mit dem graphischen Design von Zigarettenpackungen. Daran zeigt sich nicht zuletzt die Breite seiner Begabung und sein Anliegen, auch scheinbar nebensächlichen Dingen der visuellen Kultur Interesse zu schenken.
Zählen in den dreißiger Jahren die Pavillons auf den Weltausstellungen in Brüssel 1935 und Paris 1937 zu seinen herausragenden Werken, so sind es in den fünfziger Jahren der Messepavillon für Felten & Guilleaume, eine Schule am Czerninplatz, ein Druckereigebäude in Wien-Margareten und das Historische Museum der Stadt Wien sowie unzählige Ladenlokale, Kaffeehaus-Einrichtungen und Espresso-Bars, die sein Schaffen vergegenwärtigen.
Besonders für letztere wirkte er als Kenner der norditalienischen Cafékultur positiv erneuernd, Plüsch und kalten Mief durch Italianitá und mediterrane Leichtigkeit ersetzend. Als wahrscheinlich einziges verbliebenes Beispiel gilt die Milchbar im Volksgarten.
Haerdtls Architektur zeichnet sich durch proportionale Klarheit und disziplinierte Sachlichkeit aus. Mit exakt gesetzten Maßnahmen erreicht er architektonische Wirkung. So gelingt ihm mit dem Pavillon für Felten & Guilleaume auf dem Wiener Messegelände eine perfekte Inszenierung von Luftigkeit und Transparenz, eine nahezu sakrale Interpretation des Vierstützentypus mit abgesetzter klimatischer Trennebene, die räumlich kaum zu existieren scheint.
Natürlich half ihm dabei die Einfachverglasung, die weniger spiegelt als heute die doppelten Scheiben, aber architektonisch-konstruktiv und von den Proportionen her war er souverän. Die ruhige, ausgewogene Fassade der Schule am Czerninplatz zeigt, wie er mit geringster Instrumentierung sensibel umgehen konnte. Seine „Einfachheit“ war nicht dominant plakativ, sondern nobel.
Daß das Historische Museum in mancher Beziehung etwas verkrampft wirkt, hängt wohl eher mit der Einmischung des Juryvorsitzenden und damals in Wien sehr mächtigen, in politisch-moralischer Hinsicht fragwürdigen Professorenkollegen an der Akademie für angewandte Kunst, Franz Schuster, zusammen als mit einem etwaigen Knick in Haerdtls Gestaltungsvermögen. Daß Haerdtl edel wirkende Formen beherrschte, bewies er mit einer Inneneinrichtung für das kriegsbeschädigte Bundeskanzleramt. Eindrücklich ist auch seine Fähigkeit zu perfekter Integration von Schrift in Architektur, was nur wenige außer ihm beherrschten.
Dem universalen Architekten und Kulturbürger Haerdtl wurde nun die verdiente Würdigung zuteil. Leider für viele seiner Werke zu spät, wie aus dem kommentierten Werkverzeichnis hervorgeht. Der Wiener Architekturwissenschaftler Adolph Stiller hat in jahrelangen Forschungen den Nachlaß Haerdtls aufgearbeitet, der von den Erben sorgsam bewahrt und äußerst verantwortungsbewußt an das „Architektur Zentrum Wien“ übergeben wurde.
Es gab nämlich ein lukratives Angebot aus Übersee . . . In einer von Stiller gestalteten Ausstellung ist ein kleiner, aber eindrücklicher Teil aus Haerdtls Schaffen im Ausstellungszentrum der Wiener Städtischen Versicherung am Ringturm zu sehen.
Zahlreiche sorgfältige Architekturphotographien in Schwarz- weiß; Originalpläne in Bleistift, oft mit Aquarellfarben farblich und atmosphärisch verstärkt, sowie einige Modelle, die vor Jahren für eine von Johannes Spalt angeregte und gestaltete erste Ausstellung gebaut worden waren, geben einen gehaltvollen Überblick.
Der wissenschaftliche Katalog in Buchform von Adolph Stiller enthält zusätzliche Beiträge von kompetenter Seite. Es handelt sich um einen Glücksfall, daß Stiller, der an der HTL Mödling Matura und Tischlermeisterdiplom erwarb und an der Akademie der bildenden Künste und in Paris Architektur studierte, gerade diesen Nachlaß bearbeitet hat, denn versehen mit längerer Auslandserfahrung in universitären Forschungszirkeln in Paris, Genf, Mailand und Zürich, erweist er sich als kompetenter und kongenialer Analytiker und Interpret von Oswald Haerdtls Schaffen.
Mit seiner Arbeit setzt er die Kultur des Erinnerns auf hohem Qualitätsniveau fort, die etwa Friedrich Achleitner und Otto Kapfinger seit Jahrzehnten pflegen. Diese spät und quasi privat, mit Unterstützung der Kunstsektion des Bundeskanzleramts, erfolgte wissenschaftliche Aufbereitung der wichtigen Wiener Architektenfigur Oswald Haerdtl läßt allerdings ein gravierendes Defizit in der heutigen universitären Forschung aufklaffen, das durch nichts entschuldbar ist.
Noch bis 15. September ist die Ausstellung „Oswald Haerdtl - Architekt und Designer 1899 bis 1959“ im Ausstellungszentrum im Ringturm (Wien I, Schottenring 30; Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr) zu sehen.
Ob sie nun an eine Visitenkarte gemahnen oder eher an eine Sinnestäuschung - Wiens Stadteinfahrten passiert niemand, ohne das eine oder andere städtebauliche Merkzeichen wahrzunehmen. Allerlei automobile Perspektiven.
Wo endet eine Großstadt im Zeitalter der Globalisierung? Trotz World Wide Web darf wohl als greifbare Stadtgrenze der Rand des Siedlungsgebiets angenommen werden. Da dieser sich in Etappen weiter hinausschiebt, stehen auch qualitätvolle Setzungen immer unt er der Drohung, ihre Stellung als „Stadttor“ oderarchitektonische Grenzmarkierung zu verlieren. Peinlich wird dies nur dann, wenn die Gestaltung diese Nebenfunktion gleichsam gackernd und flügelschlagend überhöht hatte. In allen anderen Fällen verweist das Bauwerk auf Entwicklung und erinnert Geschichte.
Die Wiener Westeinfahrt auf der Autobahn läßt sich nur unter Berücksichtigung der fahrdynamischen Komponenten angemessen würdigen: Nach einer längeren Fahrt durch Forste, Fluren und Hügel des Wienerwaldes folgt ein letzter längerer Anstieg, der flach kulminiert, wo die Fahrbahn sich in eine Linkswendung schmiegt und im Einschnitt unter einer Brücke durchtaucht. Danach sinkt sie gleichsam ab. Zur Rechten erscheint die gemauerte Einfriedung des Lainzer Tiergartens wie ein zivilisatorischer Vorposten. Nachts sind es die ins Blickfeld tretenden Straßenleuchten, die dicht gereiht am Mittelstreifen ihr Licht verstreuen. Viel stärker in der Erinnerung haftet jedoch das drucklose Rollen im obersten Gang, wie bei Sinkflug, ins Wiental hinunter.
Eigentlich ein sympathisches Heimkommen. Es begrüßt uns in der Perspektive das Kreuz aus Straßenleuchtenpunkten am Ab- hang des Wolfsbergs. Und am Tag sind es die imposanten Rückhaltebecken der Wienflußverbauung. Man wird erinnert an Kraft und Verheerungsgewalt entfesselter Wassermassen und an die Ingenieurkunst, die diesen Kräften Einhalt gebot. All dies ist eindrucksvoll umgesetzt in ein einzigartiges landschaftsgestalterisches Ensemble. Nun zur Rechten noch eine Kastanienallee; ein, zwei den Verkehrsfluß portionierende Lichtsignale und dann der Hackinger Steg, dessen Glaskörper ankündigt: Jetzt beginnt die Stadt.
Man kann aber auch von Nordwesten einfahren, durch Klosterneuburg - das ist Niederösterreich, zählt noch nicht. Auf der äußersten Heiligenstädter Straße, am Absatz des Leopoldsbergs vorbei - ist fad. Da hätte man zwecks Fahrspaß besser die Höhenstraße genommen. Aber über die sickert man so unmerklich ins Stadtgebiet ein, das wollen wir nicht. Wir möchten empfangen werden. Fahren wir daher weiter, Kahlenberger Dörfl: Ist schon recht, aber nicht das, was wir jetzt möchten.
Da, die Fahrbahn hebt ab, wird aufgestelzt: Stadtautobahn! Und linkerhand Otto Wagner: Nußdorfer Wehr, mit Verwaltungsgebäude und Kettenmagazin, sowie anschließend die Stahlbogen der Uferbahnbrücke. Dieses dichte Ensemble am Brigittenauer Spitz mit seiner spezifischen Identität einander an die Tragglieder rückender Ingenieurbauwerke verschiedener Epochen verfügt über Kraft und Qualität. Damit auch der letzte Tourist seiner Ankunft in Wien gewiß wird, folgt noch die Quittung: das Fernheizwerk Spittelau mit Hundertwasser-Inkrustation. Soll sein.
Wenn man von Nordnordosten, über die Brünner Straße, einfährt, macht diese kurz nach der Stadtgrenze einen präzisierenden Schwenker zur Südrichtung. An dieser Stelle konnte man ehedem vom Wagram aus den ersten Fernblick auf die Residenzstadt werfen. Ab hier visiert die Brünner Straße exakt den Stephansturm an. Heute steht in dieser Achse der Millenniums-Tower, nachts mit rot blinkendem Aufsatz.
Wer vom Flughafen, oder von Bratislava, herkommt, muß mit städtebaulichen Superzeichen in mittlerer Entfernung vorliebnehmen. Nachts beeindruckt der Lichtfilter über der Raffinerie Schwechat, am Tag sind es die Getreidespeicher beim Alberner Hafen und die vier Gasometer in Simmering. Dann zieht es sich. Die Stadt hat offensichtlich schon angefangen, doch richtig angezeigt wurde sie uns nicht. Tief vordringend in gemächlicher Fahrt (50 Stundenkilometer), üben wir uns in Geduld. Dann aber, bei Max Fabianis Urania mit der Sternwarte, biegen wir ein und sind auf dem Ring: Das ist ein ordentlicher Empfang. Eine gepflegte Regie ließe beim Passieren der Aspernbrücke den Donauwalzer einsetzen, um mitfahrenden Gästen ans Gemüt zu rühren. Jetzt nicht hudeln, sondern genießen. Wir sind da!
Es ist natürlich jedem unbenommen, auch von Süden nach Wien hinein zu fahren. Aus dem dichten Kolonnenverkehr oder beim Stop-and-go fällt der Blick notwendigerweise auf die Silhouette, welche die Gebäude auf dem Hügelrücken des Wienerbergs erzeugen.
Links hinten ein Längsriegel, der wie ein leergepumpter Tanker aus dem Häusermeer heraussteht: das Krankenkassengebäude. Dann die in Bau befindlichen Twin Towers, deren Ausmaße das wenige Jahre alte Wienerberg-Hochhaus marginalisieren. Nur Karl Schwanzers Philips-Haus steht wie eine Eins, breitbrüstig und nachts leuchtend seit seiner Errichtung, obwohl mittlerweile am niedrigsten. Weiter rechts ragt noch wie ein i-Punkt der alte Wasserturm aus den Wohnbauten.
Natürlich wurde auch diese Einfahrt nicht als Ensemble geplant. Die absolutistischen Zeiten sind vorbei. Der Silhouettenwirkung kommt jedoch an dieser Stelle wesentliches Gewicht zu. Von Stadtkrone kann man nicht schreiben, da gehört mehr dazu, und der Anblick ist zu heterogen. Doch läßt sich hier das eingangs erwähnte Kriterium für Grenzmarkierungen illustrieren: daß diese ihre Würde zu wahren vermögen, auch wenn sie längst vom Stadtkörper umschlossen sind.
Was dem Denkmal der Spinnerin am Kreuz nicht bloß altersbedingt oder dem Schwanzer-Bau noch lange gelingt, vermag das Wienerberg-Hochhaus mit seinen Fassadenapplikationen nicht zu leisten: daß es nämlich von den Twin Towers, deren Fernwirkung allerding jede Zwillingshaftigkeit abgeht, in den Schatten gestellt wird. Höhe allein genügt nicht; hoch wirken lautete die Kunst.
Daß der Ensemblewirkung so wenig Gewicht beigemessen wurde, stellt den Verantwortlichen hinsichtlich ihrer Voraussicht kein besonders glänzendes Zeugnis aus. Doch man wird sich auch an diesen Anblick gewöhnen - und Gewöhnung nivelliert (fast) alle städtebaulichen Brüche und Widersprüchlichkeiten.
Ambitionierte Exemplare eigenständiger baukultureller Entwicklung auf der einen Seite; konservierende Pflege ländlicher Kulissen auf der anderen: Südtirol architektonisch. Ein Lokalaugenschein.
Ende April. Noch liegt ein rosener Hauch über den ausgedehnten Apfelplantagen des Vinschgaus, doch im breiten Tal der Etsch unterhalb Merans ist die Blütezeit bereits vorüber. Dennoch bestimmen die Baumgärten mit den langen Reihen niederstämmiger Obstsorten das Landschaftsbild. Dazwischen hat die mehrtausendjährige Besiedelungsgeschichte zahlreiche bauliche Zeugnisse abgelagert: Kaum ein Hügel oder eine größere felsige Erhebung, die nicht von einer mittelalterlichen Burg, einer Kirche oder einem Kloster besetzt wäre.
An den Talflanken finden sich zahlreiche kleinere Landsitze. Die Dörfer sind dank einer konsequenten Raumplanung kompakt geblieben. Den landwirtschaftlichen Bauten und jenen der früheren Handelstätigkeit wurde neu die touristische Infrastruktur überlagert. Waren es zu Beginn historistische Hotelpaläste, wechselte der Stil in den 1930er Jahren zu vergrößerten Typen landwirtschaftlicher Bauten. Seit einigen Jahren ist nun der mittelalterliche Burgenbau wieder en vogue. Ein Turm, eckig oder rund, gehört einfach dazu. Außerdem erlaubt das Burgprinzip die zufällige Agglomeration von Erweiterungsetappen, wie dies bei den mittelalterlichen Vorbildern schon geübt wurde. Denn wer fragt bei einer Burg schon nach der Qualität der Architektur?
Neben einer nicht geringen Zahl von Gewerbebauten fallen Einrichtungen der Stromindustrie aus den 1920er Jahren auf, die sich nicht verstecken. In den landwirtschaftlich genutzten Zo- nen sind es dagegen die temporären Strukturen Tausender gestapelter Großkisten für die Obsternte, die das Auge auf sich ziehen. Oft sind sie, zu riesigen flachen Quadern gefügt, unter freiem Himmel oder aber unter Dächern gelagert. Denn wie überall auf der Alpensüdseite sind die Regenfälle weniger häufig, dafür ergiebiger. Eine intensive Vegetation wird noch optimiert durch Bewässerung.
Die Entwicklung der Architektur erfolgte langsam und wurde meist von außen an das Land herangetragen. Zu den starken, bodenständigen Typen ländlichen Bauens kontrastieren attraktive mittelalterliche Stadtkerne mit interessanten Haustypologien. Südlich der Alpen ist die Urbanität seit Jahrhunderten ausgeprägter als im Norden. Was Generationen von Architekten beeindruckte und bis heute beeindruckt.
Sigrid Hauser, in Meran aufgewachsene, in Wien arbeitende Architekturtheoretikerin, konstatierte in einem längeren, vor zehn Jahren erschienenen Aufsatz - neben weiterhin wirkenden Einflüssen aus den großen Zentren im Süden und Norden - eine zaghafte eigenständige Entwicklung. Seither hat sich diese verstärkt, und es finden sich da und dort engagierte Bauten, die dennoch einfühlsam auf Landschaft und nähere Umgebung bezogen sind.
Da steht aus jüngster Zeit etwa ein Bauernhof in Burgstall, einem Dorf wenige Kilometer unterhalb von Meran. Thomas Höller und Georg Klotzner vergrößerten ein Wohn- und Wirtschaftsgebäude aus den fünfziger Jahren. Der würfelförmige Wohnteil ist dreigeschoßig. Ebenerdig sind Einstellräume und die Werkstatt angeordnet, darüber liegen Küche und Wohnen, zuoberst befinden sich die Schlafzimmer. Südseitig öffnen sich die Räume mit Fenstertüren auf eine Terrasse und zwei Balkone, im Norden ist ein Treppenturm angekoppelt, der auch die Sanitärräume enthält. Ein verglaster Gang führt in
beiden Obergeschoßen zum Hauptbaukörper.
Für die landwirtschaftlichen Maschinen wurde eine Garage errichtet, die nordseitig an den Treppenturm anschließt. Ihr Dach ist zu einer Terrasse ausgebaut. Als wesentlichstes Element ist nun über die Reihe der drei unterschiedlichen Baukörper ein langes Satteldach gezogen, das als Großform die Identität des Bauwerks bestimmt. Seinem Schatten, der zugleich einen riesigen Luftraum definiert, ordnen sich die drei Teilvolumen unter. Großzügigkeit und auch ein wenig Stolz sprechen aus der Anlage. Mit den schlanken Stahlstützen wird Pathos vermieden, das Dach wird fast schwebend gehalten über dem Meer graugrüner Apfelbäume. Eine schöne Anlage, die dem südalpinen Klima Rechnung trägt: umspült von milden Lüften, doch ausreichend beschattet und beschirmt.
Andererseits ist sie dem praktischen Prinzip lockerer Anordnung verpflichtet, das Zwischen- und Reserveräume läßt, die beim landwirtschaftlichen Betrieb gern genutzt werden. Und ein Sommernachtfest auf der Terrasse über der Garage wird nicht zu verschmähen sein. Alltag und Arbeit, Festtag und Lebensfreude vereinen sich unter diesem Dach.
Höller und Klotzner, beide Ende der fünfziger Jahre geboren, stammen aus der Gegend, haben in Innsbruck studiert und führen seit 1988 ein gemeinsames Atelier in Meran. Bauten von weiteren Architekten sind ebenso herzeigenswert, aber ganz zufrieden ist man in Südtirol dennoch nicht.
Der renommierte Preis für alpines Bauen, der von Sexten aus initiiert und bereits dreimal an jeweils acht Bauten verliehen wurde, hat noch nie einen Bau aus Südtirol in den Kreis der Ausgezeichneten einbezogen. Und bei größeren Wettbewerben haben fast immer Architekten aus Großstädten im Norden oder Süden gewonnen. Also eher ein Weiterschreiben der Praxis nach 1900 und der dreißiger Jahre, als eingesessene Fachleute bestenfalls in Partnerschaft mit den Großstädtern für die örtliche Abwicklung sorgen durften?
Aktuellstes Beispiel ist der Wettbewerb zur Neugestaltung des Sparkassengebäudes am Bozner Waltherplatz. Das Bauwerk aus den fünfziger Jahren sollte umgebaut und in seiner städtebaulichen Wirkung verstärkt werden. Zehn Architekturbüros wurden eingeladen, vier aus Südtirol, sechs aus dem benachbarten Ausland; österreichische Architekten waren darunter nicht vertreten.
Der Bestand stellt einen damals als nicht besonders glücklich beurteilten Kompromiß zwischen Tradition und Moderne dar. Das Konzept wirkt eher verkrampft, während der Ausbau auf hohem handwerklichem Niveau und mit wertvollen Materialien erfolgte. Das - zweitgereihte - Projekt von Höller & Klotzner strebte daher eine völlige Neugestaltung an, wobei ihr Entwurf als aktuell und in dieser Hinsicht auch als qualifiziert einzustufen ist. Gewonnen hat jedoch ein renommiertes Berliner Büro, das eine sanfte, pflegliche Erneuerung vorschlug. Beide Vorschläge haben etwas für sich. Befremdend ist jedoch, daß bei der Ungleichzeitigkeit zwischen Metropole und Provinz eigentlich wieder letztere das Nachsehen hat.
Das Bestreben, kräftig zu erneuern und in dieser Hinsicht internationales Niveau anzustreben - wobei dies heute mit einheimischen Kräften auf dem Niveau der Zeit erfolgen könnte -, wird unterlaufen vom sentimentalen Wünschen aus einer Metropole, daß die Provinz doch so bleiben möge, wie sie ist, nur halt etwas gepflegter und etwas aufgeräumter.
Und wieder einmal dient das vermeintlich Unberührte, vermeintlich Ländlich-Naive abseits der Metropolen den Bürgern aus ebendiesen Metropolen als Projektionsfläche unerfüllter romantischer Gefühle: „Eure Zurückgebliebenheit, liebe Provinzler, rührt uns, und wir möchten uns bei euch von den Härten der Großstadt erholen können. Also laßt bitte die Finger von allzu ambitionierten Veränderungen, die uns womöglich im Herzen weh tun könnten.“ So klingt das Wehklagen der Großstädter im Klartext.
Hier stellt sich daher die Frage, ob die handwerklichen Leistungen und die wertvollen Materialien nicht in einer anderen Form gewürdigt werden könnten als mit dem damit verbundenen Festhalten an einem biederen und letztendlich mittelmäßigen Gesamtkonzept. Auf diese Frage hat der gutgemeinte Vorschlag aus dem Norden keine Antworten geliefert. Denn auf längere Sicht stellt das schwächere Gesamtkonzept für den qualitativen Ausdruck der Stadt ein größeres Risiko dar, als es der potentielle Verlust handwerklicher Qualitäten sein könnte. Die doppelte Herausforderung, das Gesamtkonzept zu stärken und die wesentlichen Elemente des Innenausbaus gescheit zu bewahren, ohne zu verklären, ist jedenfalls nicht bewältigt. Nach Durchsicht der Dokumentation über das gesamte Verfahren bleibt ein unangenehmer Nachgeschmack.
Nachdem die Schnellebigkeit in den Metropolen die meisten Zeugen aus den fünfziger Jahren mit ihren - angeblich - vom Wiederaufbau bedingten Unzulänglichkeiten bereits beseitigt hat, werden nun die Städte der Provinz - wieder einmal - von außen dazu angehalten, im Interesse anderer ihre Kulissen zu pflegen. Man kann mir beide Standpunkte erklären, und ich verstehe auch beider Intentionen, aber ich meine, die Menschen, und insbesondere die Architekten, in der „Provinz“ sollen auch wollen dürfen. Umso mehr, als sie bewiesen haben, daß sie auch können.
Einheitliche Gestaltung: Diese fixe Idee verhinderte Jahrzehnte hindurch eine rationale Auseinandersetzung mit dem Thema „Ortsbild“. Einen nicht zu übergehenden Beitrag zur nun laufenden Diskussion stellt Helmut Dietrichs Wohnhaus in Schnepfau dar.
Mobilisierung und elektronische Medien haben im vergangenen Jahrzehnt den Gegensatz Stadt-Land relativiert. Das Bildungsprivileg der Stadt vor dem Land ist schon früher gefallen. „Land“ ist also nicht mehr eine rein landwirtschaftlich bestimmte Gegend, auch wenn im Sommer weiterhin Kornfelder wogen und schattige Wälder rauschen. Romantischen Projektionen stehen neue Realitäten gegenüber, und so ist es auch vorbei mit schematisch-starren Vorstellungen, wie so ein Ortsbild auszusehen habe oder angestückelt werden soll.
Die im Rhythmus von fünf bis zehn Jahren wechselnden Moden äußerer Gestaltung von Häusern haben die Versuche, mittels detaillierter Bestimmungen in Bebauungsplänen ein einheitliches Bild zu erzwingen, allesamt scheitern lassen. Denn fixe Regeln, von noch so gescheiten Analytikern aufgestellt, können nicht garantieren, daß andere, die sie anwenden, auch vernünftige Produkte zustande bringen. Eine diesbezügliche falsche Hoffnung hat jahrzehntelang die Köpfe beherrscht. Im Kulturbereich - das gilt auch für die Architektur - ist das Anstreben von Qualität nicht delegierbar.
Das normale Bauen böte wenig Probleme, wenn keine falschen Ansprüche erhoben würden. Aber der oder die Entwerfer müßten wissen, in welcher Liga mitzuspielen sie Rüstzeug und Erfahrung mitbringen.
Beim Vorstoßen in den Bereich der Architektur, die wir als die Kunstform des Bauens ansprechen wollen, gilt eine Aussage von Klaus-Jürgen Bauer, der als Architekt mit Qualifikationen in Architekturtheorie in Eisenstadt ein Atelier führt: „Architektur unterliegt heute überall, ob Kapitale oder Provinz, denselben Qualitätsmaßstäben“, beschied er vom Podium einer Veranstaltung in Krems, organisiert von den „ländlichen“ Architekturhäusern Burgenlands, Kärntens und Niederösterreichs zum Thema Ortsbild.
Das heißt, es gibt keinen Peripheriebonus mehr. Das entbindet die jeweils Beteiligten dümmlich tümelnder Bauweisen. Aber es zwingt zu einem Anheben der Bestellqualität auf Bauherrenseite.
Schnepfau, ein Dorf im Bregenzerwald. Locker liegt es hingestreut am südexponierten Rand des Talbodens, einer nutzbar gemachten Au der Bregenzer Ach. Im Süden ragt die Kanisfluh mächtig in den Himmel. Der kleine Dorfkern befindet sich bei der Kirche, wo das Sträßchen über die Schnepfegg nach Bizau abzweigt. Am Fuß des dahinter ansteigenden Hanges fließt der Dorfbach. Auch wenn das behäbige Bauwerk des klassizistischen Pfarrhauses mit seinem altersgrauen Schindelschirm schon bessere Tage gesehen haben mag, bestimmt es mit seinem ruhigen Äußeren heute noch den Ort.
Westlich davor steht nun seit kurzem ein kleines Haus mit Holzfassade und Satteldach. Sein primäres Volumen besteht aus einem länglichen Quader. Das Dach weist eine Neigung von nur 20 Grad auf, der daher wenig betonte First verläuft in Längsrichtung.
Aber aus dem Volumen sind größere Teile ausgeschnitten: da eine Ecke, dort ein Prisma über die gesamte Länge. Und die verglasten Öffnungen bilden meist Fortsetzungen der Ausschnitte oder schließen diese als zurückgesetzte Trennebene klimatisch ab. Ins Auge fällt jedoch die äußere Hülle, deren Feingliedrigkeit ins Textile changiert. - Nun möchten wir natürlich wissen, wer das Bauwerk entworfen hat. Es ist dies Helmut Dietrich, geboren in Mellau, zwei Dörfer unterhalb Schnepfau, der zusammen mit Much Untertrifaller in Bregenz ein Architekturbüro führt. Von den beiden stammen die spektakuläre Erweiterung des Bregenzer Festspielhauses, einige Wohnanlagen, mehrere Kindergärten und zahlreiche Ein- und Zweifamilienhäuser. Von Dietrich sind auch feinsinnige Möbelentwürfe und Innenraumgestaltungen bekannt.
Das unter Mitarbeit von Marina Hämmerle entstandene neue Haus dient einem Ehepaar als Alterswohnsitz. Auf dem benachbarten Grundstück befindet sich das gut zehn Jahre früher entstandene erste Einfamilienhaus aus der Hand Helmut Dietrichs, das prototypisch für die damalige Entwicklung der Vorarlberger Baukultur steht. Die von ländlichen Nutzbauten übernommene, nobilitierte Vertikalschalung; die von leichten Irritationen aufgelockerte Symmetrie der Fassaden; die Elemente regionaler Baukultur, wie Satteldach und „Schopf“ - ein loggienartig eingezogener Außenraum, der oft dem Eingang vorgeschaltet wird -, all das stand und steht für ein kollektives Produkt der „Baukünstler“, das Vorarlberg über den Kreis Architekturinteressierter hinaus in der Welt bekannt gemacht hat.
Nun also ein weiteres Haus an demselben Ort nach einer ganzen Reihe von Häusern, die auf das Unterland und den Bregenzerwald verteilt sind. Seine äußerste Fassadenschicht besteht aus zahlreichen, extrem feinen, horizontal befestigten Leisten, die mattenartig unter dem knappen Dachüberstand herabzuhängen scheinen. Damit wird jeglicher Eindruck von Masse sublimiert; und auch das Holzige, wie es manchen Lamellenfassaden oder vertikalen Verbretterungen anhaftet, wird neutralisiert.
Der neuartige Effekt liegt irgendwo zwischen grobem Stoff und Rutengeflecht und ist durchaus vergleichbar dem eines Schindelschirms. Formale Zuspitzung und Verfeinerung zeichnen diese Hülle aus. Die reine Symmetrie bezieht sich nur mehr auf die prinzipielle Großform. Die Ansichten mit ausgeschnittenen Teilvolumen sind überhaupt nicht axialsymmetrisch.
Was jedoch durch sorgfältiges Abstimmen von Proportionen erreicht wurde, ist Ausgewogenheit. Und zwar eine Ausgewogenheit des Verhältnisses von offenen und geschlossenen Flächen, wobei es sich bei ersteren immer um Anschnitte handelt und letztere, ungelocht, jeweils von einem Polygonzug umschrieben werden können.
Diese Flächen sind ein Ganzes, Öffnungen bilden das „Andere“, ja zählen zum Umraum. Damit gelingt es, eine Identität von Fassadenwirkung und Raumgefüge zu erzielen, die nicht primär funktional, sondern zuerst architektonisch ist. Und das alles bleibt angenehm unaufgeregt.
Damit liegt Schnepfau nahe bei Bregenz, bei Vals, bei Luzern und anderswo, wo immer Architektur mit hohem Anspruch realisiert wurde und wird. Ganz nebenbei wurde das Ortsbild perfekt gepflegt und nachhaltig angereichert.
Wie den dritten Stock einer aufgelassenen Wollwarenfabrik in Wien-Margareten für eine Werbeagentur adaptieren? Edel, versteht sich. Dolenc und Scheiwiller schaffen das, indem sie demonstrative Moderne mit einem bodenständigen Grundton unterlegen.
Die ehemalige Wollwarenfabrik Bernhard Altmann in Wien-Margareten, zwischen Siebenbrunnengasse und Stolberggasse gelegen, findet sich im „Achleitner“ verzeichnet. Vom Betriebsgebäude im südlichen Abschnitt der Gebäulichkeiten hat man einen schönen Ausblick auf den kleinen Park an der Zentagasse. Das halbrunde hofseitige Stiegenhaus mit den breiten Treppenläufen dürfte ebenso aus den zwanziger Jahren stammen wie die viergeschoßige Stahlbetonkonstruktion der Werksäle, in denen gevoutete Unterzüge den Raum zonieren.
Im dritten Stock mietete sich vor kurzem eine international tätige Werbeagentur ein. Ihr hoher Qualitätsanspruch schlug sich bereits in zahlreichen Preisen und Auszeichnungen nieder, und auch der Kundenkreis ist eindrücklich. Da wollte man sich bei der Einrichtung der Agentur nicht lumpen lassen. Die Firma Weber, Hodel, Schmid - heute mit einem Altersdurchschnitt der Mitarbeiter von 30 Jahren - startete 1991 von Zürich aus und betraute ein erfolgreiches Schweizer Architektenteam, Caroline Dolenc und Andreas Scheiwiller, mit der Umgestaltung.
Scheiwiller ist 1959 geboren, Dolenc Mitte der sechziger Jahre. Sie studierten beide an der ETH Zürich und arbeiteten danach in engagierten Architekturbüros. Die Gründung eigener Ateliers erfolgte 1988 beziehungsweise 1996. Seit 1998 besteht das gemeinsame Büro. Scheiwiller ist überdies Professor für Architektur an der Universität Genf.
Nun ist es Insidern nicht unbekannt, daß Schweizer und Wiener denselben deutschen Satz nicht selten verschieden interpretieren. Es kann auch einige Zeit dauern, bis alle Beteiligten dahinterkommen, daß sie einander nicht richtig verstehen. Ich möchte vorsichtig vermuten, daß die jeweilige Zwischenzeilensprache eben eine andere ist. Weil sie auf Nummer sicher gehen wollten, ihnen Erfahrungen mit hiesigen Handwerkern abgingen und weil sie seit längerem mit einem Betrieb gut zusammenarbeiten, ließen die Architekten die Einbaumöbel in Zürich fertigen. Ungewohnt daran ist nur, daß die Schweiz nicht EU-Mitglied ist, sonst sind derartige Lieferdistanzen mittlerweile üblich.
Es wurden die Fenster repariert - schöne Hebeschiebefenster, die einen Hauch Chicago in den fünften Wiener Gemeindebezirk wehen. Ein neuer Boden aus kaltgepreßten Asphaltplatten kam dazu. Aber vor allem wurde ein den Raum strukturierendes Element in den ungerichteten, unregelmäßigen Grundriß hineingestellt, das zonierend wirkt und die allgemeine Fläche von den verschiedenen Arbeitsbereichen trennt. Es besteht aus einer raumhältigen Wand von zwei Drittel Raumhöhe und beginnt schon im Stiegenhaus, umfaßt den Liftkern und stößt hinter dem Empfang in den weiten Raum vor, biegt ungefähr rechtwinklig ab und entwickelt sich, über fünf weitere Kantungen enger werdend, in Form einer eckigen Spirale bis zu einem geschlossenen Kern.
A n diesem ist außen die Kaffeeküche angeordnet, innen befindet sich sinnigerweise der Server für das interne Computernetzwerk. Abgesehen davon, daß die innere Zone als Erschließung für die außen liegenden Arbeitsbereiche dient - die allesamt durch „Schranktüren“ zugänglich sind -, befinden sich, von innen nach außen: nahe dem Kern die Kopieranlage, Zeitschriften und eine Handbibliothek, davor die Pausenzone und beim Eingang der Empfang.
Über der Schrankwand fließt der Raum kontinuierlich durch, von der befensterten Außenmauer zur ebenfalls stark aufgelösten Hofmauer. Hinter der Schrankwand und begrenzt durch die Außenmauer liegen kleine und große Arbeitsräume, durch Glaswände unterteilt. Mit Schiebepaneelen aus hellem Streckmetall lassen sich die lateralen Durchgänge schließen. Die von den Unterzügen abgehängten Gleitschienen tragen auch die Beleuchtung, die indirekt wirkt. Zur akustischen Dämpfung erhielt die Decke fein gelochte Oberflächen, und auch die Schiebepaneele wirken schallabsorbierend.
Nun ist das in Summe bereits ganz gescheit, es ist aber noch nicht alles. Farben kommen dazu. Das Betonskelett, die Unterzüge und Rippen sind glatt und scharfkantig gespachtelt und in blendendem Weiß gehalten. Die sich progressiv einwickelnde Schrankwand ist schwarz - ein perfekt hochglanzlackiertes Edelschwarz. Damit wird der Gegensatz ziemlich zugespitzt. Die Rolle des Moderators übernimmt daher der Fußboden.
E r ist überall unauffällig präsent, und das schwer definierbare Braungrau der Asphaltplatten in seiner alltäglichen Durchschnittlichkeit exponiert verbindlich das vornehme Schwarz und das dematerialisierende Weiß.
Das übrige Mobiliar ist ebenfalls schwarz, nur die Tischplatten aus matt anthrazit lasiertem MDF (mitteldichte Faserplatten) wirken schieferig grau. Doch sie sind an der Grundstimmung nur mehr marginal beteiligt. Diese lebt von dem akut polarisierten Gegensatz von Kreideweiß und Spiegelschwarz, die beide der klassischen Moderne entstammen.
Aber da kommt noch etwas dazu, das nicht der Moderne, der demonstrativen permanenten Innovation zugehört, sondern das als traditionales Element einen bodenständigen Grundton einbringt. Es erinnert an das Vorstadtgrau auf den Darstellungen der „Analogen“, wie die Strömung um den tschechisch-schweizerischen Architekten Miroslav Sik Ende der 1980er Jahre genannt wurde, deren Auswirkungen bis zu den neuesten Entwicklungen in Graubünden feststellbar sind. Andreas Scheiwiller charakterisiert den Plattenbelag als muffig. Das macht vorerst stutzen. Ein „muffiger“ Boden in einer Werbeagentur? Die Welt ist eben nicht nur schwarz und weiß, sondern besteht aus zahlreichen Zwischentönen. Und auf diesem Humus müssen auch Werbeagenturen arbeiten. Wir zitieren Miroslav Sik: „Ein Ja zum Realismus heißt ein Ja zu unzähligen, noblen und weniger noblen Architekturen unserer Umwelt, ein Ja zu unzähligen Stimmungen und Bildern, die man als radikaler Architekt hat stets übersehen und zertrümmern können.“
Die klassische Moderne neigte stets zum Idealisieren. Dolenc/Scheiwiller gehen darüber hinaus: In der Wiener Agentur von Weber, Hodel, Schmid finden wir radikale Zuspitzung und abgeschliffen wirkende Alltäglichkeit pfiffig kombiniert.
Architektur gestaltet Raum. Diesen an sich banalen Sachverhalt lassen zwei Objekte in Niederösterreich zur beeindruckenden Erfahrung werden: Max Pauly baute in Mitterretzbach, „the Poor Boys Enterprise“ in Hof am Leithagebirge.
Wir sind es gewohnt, der Baukunst abzufordern, daß sie nützlich sei. Der „Nebeneffekt“ architektonischer Erfahrungsmöglichkeiten wird oft drittrangig behandelt, obwohl gerade darüber ausgiebig gestritten wird. Zwei neue Objekte im Überschneidungsgebiet von Kunst und Architektur lohnen derzeit die Fahrt ins periphere Niederösterreich. Dort sind in den vergangenen Jahren über 200 Kunstprojekte im öffentlichen Raum mit Landesgeldern gefördert und realisiert worden. Die Werke decken ein breites Spektrum ab, das von bildender zu Konzeptkunst und neuen Medien reicht, aber auch Aspekte des Design, der Architektur und manchmal sogar der Ingenieurkunst umfaßt.
Meist sind es kleine Wettbewerbe unter drei bis sechs Kunstschaffenden, aus denen ein Projekt hervorgeht, das vom siebenköpfigen Gutachtergremium für Kunst im öffentlichen Raum empfohlen wird. Vertreter der örtlichen Behörden und engagierte Vereine sind in das Verfahren eingebunden. Demokratiepolitisch ist diese Art der Vergabe nach Qualitätskriterien sicher eine der besten.
Bei Mitterretzbach im Weinviertel befindet sich auf einer Anhöhe ein „Schalenstein“ aus vorgeschichtlicher Zeit, der die Menschen immer wieder faszinierte. Es gibt Berichte aus der frühen Neuzeit über spontane Heilungen durch Wasser aus den eigenartigen Vertiefungen. Eine Kapelle wurde errichtet und eine vorhandene Quelle gefaßt. Im 18. Jahrhundert kam es zu Wallfahrten, für die man in der Folge eine größere Kirche errichtete, durch deren Fundamente das Heilung versprechende Quellwasser eingeleitet wurde. Joseph II. und seine Verwaltung, denen die populistisch aufwallende Volksfrömmigkeit und vor allem damit verbundene Scharlatanerien und Geschäftemacherei zuviel wurden, ließen jedoch den Bau 1785 abtragen.
Seither überwucherten Buschwerk und Bäume die Fundamente. Der Ort blieb jedoch Anziehungspunkt für viele, nicht zuletzt auch deshalb, weil er eine herrliche Aussicht ins Retzer Land und bis nach Mähren hinein bietet. 1995 bis 1997 wurden die Grundfesten archäologisch ergraben und gesichert, wobei Retzbacher Bürger tatkräftig mitarbeiteten.
Der Wunsch, der Anlage eine wie auch immer geartete architektonische Fassung zu geben, führte die Antragsteller zur Abteilung Kultur und Wissenschaft der niederösterreichischen Landesverwaltung. Der kleine Wettbewerb zur künstlerisch-architektonischen Gestaltung wurde von Max Pauly gewonnen, er ist Absolvent der Kunsthochschule Linz und führt heute ein Architekturatelier in Wien.
Die im Spätsommer vorigen Jahres fertiggestellte Anlage interpretiert die Topographie des Ortes: Der niedrige Hügelzug fällt nach Südosten ab. Das architektonische Objekt, ein einfach gehaltener Steg, schwingt sich von der Kuppe weg, umrundet in elliptischem Bogen die spirituell aufgeladene Zone mit dem Schalenstein, den Kirchenfundamenten und der Kapelle sowie einigen Bäumen und kehrt zur Hügelkuppe zurück. Er rahmt die aus verschiedenen Zeiten stammenden Artefakte, bietet aber zugleich einen breiten Ausblick auf die sanftwellige Landschaft. Zur Verstärkung des Effekts steigt die Ebene des Stegs, die Hangneigung konterkarierend, leicht an, wobei sich aber Ellipsenscheitel und Kulminationspunkt nicht decken.
Dieses eher unbestimmte Verschleifen entspricht der dienenden Rolle des Stegs: Rahmen nach innen, Ausblick bieten nach außen. Eine exakte geometrische Zuordnung hätte sich vielleicht zu wichtig genommen. Auch ist eine Ellipse unbestimmter als der Kreis, der in herrischer Weise einen Punkt zentriert, während erstere ein Feld umschreibt. Die leichte Neigung bewirkt ein Verschneiden der Stegfläche mit dem Hang, sodaß nur die halbe Ellipse real existiert. Eine zweite, virtuelle Hälfte bewegt sich in der Geometrie unserer Vorstellung unter der Erde, sodaß der auratische Ort nach hinten ungestört ins Gelände übergehen kann.
Der Steg ist gestalterisch abstrahiert, Art und Weise des Tragens sind sublimiert. Dieselbe flache Bretterschalung deckt Ober- und Unterseite; betont wird die dünne Scheibe des Gehwegs, nicht das Konstruiertsein. Das luftige Geländergitter stört diesen Eindruck kaum. Und die runden Stützen aus Stahl sind nicht lotrecht, sondern stehen „normal“, das heißt orthogonal zur geneigten Ebene. Damit wird angedeutet, daß sie zum System des Stegs gehören, auch wenn keine konstruktiven Hinweise auf eine Einspannung zu sehen sind. Die reine architektonisch-geometrische Form bleibt künstlich und abstrakt. Sie eignet sich gut als Rahmen der historischen Zeugnisse in dem durch sie exponierten Feld. Aber als Steg hat sie eine zweite Seite: Die Aussichtsplattform verweist vom Inneren auf das, was außen ist, auf die Welt.
Ebenfalls ein lineares begehbares Objekt ist kürzlich in Hof am Leithagebirge vollendet worden. Nach dem gleichen Verfahren - kleiner Wettbewerb, Auswahl durch das Gutachtergremium - erhielt die Gruppe „the Poor Boys Enterprise“ aus Wien den Auftrag zur Ausführung ihres Entwurfs. Die Aufgabe hatte gelautet, die regionale Kulturwerkstätte vom Gelände des kommunalen Bauhofs abzutrennen. Die Architektengruppe, das sind Marie-Therese Harnoncourt, Florian Haydn und Ernst J. Fuchs, schlug einen langen, gekrümmten Gang aus Brunnenringen von zweieinhalb Meter Durchmesser vor, der als Zugang, Durchgang und Erlebnisraum sowie als Abgrenzung zum Bauhof dient.
Das heterogene Gewerbegebiet an einer in die Weite hinauszielenden Landstraße ist nicht eben attraktiv, vordem dienten die Hallen der Produktion von Betonsteinen, heute sind sie für die Zwecke der Kulturwerkstätte adaptiert, vor allem in Raumakustik wurde einiges an Arbeit - auch Fronarbeit - investiert, denn es wird gern, viel und unterschiedlich musiziert in Hof.
Die alte Nutzung bildete einen Ansatzpunkt: Brunnenringe aus armiertem Beton definieren den Zaun-Gang. Die um sprachlich doppeldeutige Formulierungen selten verlegenen Poor Boys nennen ihn „Blindgänger“. Zwischen den einzelnen Ringen ist ein etwas mehr als handbreiter Zwischenraum offen, weniger um durchzuschaun, denn um Licht einzulassen. Das verändert auch die Akustik, die anders ist als in einer geschlossenen Röhre, was man in einem Abschnitt, wo die Elemente dicht an dicht gesetzt sind, schnell merkt.
Die Innenseiten sind weiß gestrichen, außen ist der Beton roh und paßt zur Umgebung des Gewerbegebiets. Zwei Durchlässe mit Schiebetüren erlauben den Ausstieg in den platzartigen Hof der Kulturwerkstätte, der vom bogenförmigen Verlauf der Rohrteile erst definiert wurde. Doch die eigentliche Sensation ist der Weg durch den „Blindgänger“. Rhythmisch fällt das Licht ein, der gekrümmte Raum läßt offen, ob das Ende nicht geschlossen ist. (Ist es nicht.) Der Weg ist lang genug, um die sinnlichen Empfindungen beim Durchschreiten auszuloten. Es macht Freude, sich darin zu bewegen, die akustischen Nebeneffekte wahrzunehmen und den Licht-und-Schatten-Spielen zu folgen. Ein listiger Erlebnisraum, eine doppelt runde Sache.
Abgesehen von der außerordentlichen Qualität beider Arbeiten ist ein weiterer Aspekt wesentlich: Die Globalisierung zeigt hier ihre positiven Seiten für den ländlichen Raum. Es entstehen Werke in Dörfern, die man dort nicht vermuten würde. Internationale Vergleiche mit Großstadtprodukten brauchen sie aber nicht zu scheuen. Nicht daß deswegen schon ein Bilbao-Effekt entstünde, aber sie sind dem Ort angemessen, ohne einer falsch tönenden Ländlichkeit nachzuhängen. Sie sind frisch zeitgenössisch und entsprechen einem von den heutigen Medien noch in die entfernteste Stube transportierten Erfahrungshintergrund. Aber in Hof und in Mitterretzbach sind sie real und unmittelbar erfahrbar.
Es gibt sie noch: Menschen, die nicht zum Vergnügen herumziehen, sondern um sich den Lebensunterhalt zu sichern, eine Lebensweise, die als überholte Zwischenstufe in der Entwicklung menschlicher Gesellschaften gilt. Unsere Nomaden: von Ungleichzeitigkeiten und Behausungsprovisorien.
. . . folgt.
Land Art, Vorgarten, städtebauliches Verbindungsglied? Die Gestaltung des knappen Bereichs vor dem künftigen Wiener Museumsquartier ist derzeit in Diskussion. Einige Überlegungen zur Aufgabenstellung.
Schon in der ersten Ausschreibung eines Architektenwettbewerbs aus dem Jahr 1986, der Entwürfe für das neuzuschaffende Wiener Museumsquartier in den ehemaligen Hofstallungen einforderte, war die Durchlässigkeit des Quartiers in Ostwestrichtung - oder, etwas hochtrabender gesprochen, die städtebauliche Verbindung vom siebenten zum ersten Bezirk - verlangt. Nachdem der Sperriegel der Winterreithalle erhalten werden mußte, war diese Aufgabe nicht leichter geworden.
Skeptiker seien jedoch daran erinnert, daß die Gehzeit aus dem siebenten Bezirk bis zum Graben etwa eine halbe Stunde ausmacht. Mit der U-Bahn dauert es samt Anschlußwegen und Wartezeit etwa 15 bis 20 Minuten. Wenn nun ein schönes Stück Weg durch autofreie Anlagen führt, könnte diese doppelte Viertelstunde täglicher Mehrzeit beim Weg zur Arbeit nicht nur gesund, sondern sogar attraktiv sein. Auch wenn viele Bewohner des siebenten nicht im ersten Bezirk arbeiten, ist eine solche Verbindung nicht geringzuschätzen, besonders wenn die zu erwartende Ausstrahlung des Museumsquartiers in die anschließenden Wohn- und Geschäftsgevierte eingerechnet wird.
Das in Bau befindliche Projekt von Ortner & Ortner löst diese Öffnung nach Westen funktional einigermaßen zufriedenstellend. Für die Zahnlücke zur Breiten Gasse können die Architekten nicht verantwortlich gemacht werden, ein Durchgang war offenbar nicht anders zu haben. Und wenn die Passanten einmal um die Rückseite des wiedererrichteten rückwärtigen Halbrundbaus herum sind, ist auch der Weg räumlich wieder attraktiv: Man gelangt auf zwei die alte Reithalle - neu: Veranstaltungshalle - flankierende Terrassen, die zu den Großvolumen Museum Leopold und Museum Moderner Kunst vermitteln. Auf breiten Treppenanlagen steigt man von ihnen hinunter auf den Museumsplatz. Wer nun aus einem der fünf großen Durchgänge unter dem querliegenden Fischertrakt hinaustritt, steht auf einem knappen Vorfeld, dessen städtebauliche Bedeutsamkeit erst vor kurzem ins Bewußtsein getreten ist. Wie immer in solchen Fällen trudeln - wie die Tauben auf das von Rentnerinnen gestreute Futter - allerlei Einfälle herein, was auf dem Restflecken alles gemacht werden könnte.
Typischerweise sind dies fast immer selbstbezogene Konzepte, die auf städtebauliche Zusammenhänge wenig achten. Oder - wie im Fall der mittlerweile wieder abgebauten Kunstinstallation aus orangen Netzen, die im Spätsommer auf das Gelände aufmerksam machen wollte - die Adressaten sind die vorbeifahrenden Autofahrer. Es kommt vor und ist auch durchaus interessant, daß Autobahnen und Überlandstraßen auch nach Gesichtspunkten filmischen Sehens vom Lenkrad aus gestaltet werden. Im urbanen Umfeld dient der Städtebau weniger dem ästhetischen Genuß der Automobilisten - die sollen auf den Verkehr achten, und wenn es grün wird, nicht so lange brodeln -, sondern vor allem den Fußgängern und unter diesen den Flaneuren.
Wien ist in dieser Hinsicht eine außerordentlich attraktive Stadt, aber auch sie kann sich noch verbessern. Wir fragen daher, in welchem städtebaulichen Kontext dieser Vorgarten steht, dieser verschwindend kleine Rest des ehemals ausgedehnten Glacis. Ein Blick auf die Stadtkarte zeigt, daß er ein kleiner Bestandteil der gewichtigsten städtebaulichen Querachse zum Ring ist, wie sie im Kern von Gottfried Semper formuliert wurde. Sie wurzelt am Kohlmarkt in der Innenstadt und streckt ihre Fühler aus, sagen wir einmal, bis zum Siebensternplatzl unterhalb der Neubaugasse. An dieser Abfolge öffentlicher Räume gibt es Großartiges und Kleinteiliges, Älteres und Jüngeres zu ergehen und zu erschauen.
In Gedanken vom Kohlmarkt her kommend, empfängt uns der Michaelerplatz mit seinem klar definierten Rund. Die weich ausschwingenden Flügel des Michaelertrakts und das innere Burgtor nehmen den Betrachter auf und belohnen ihn mit dem hohen Kuppelraum. Einige Schritte weiter folgt ein weiterer Tordurchgang. Nun tangiert man den platzartigen Hof „in der Burg“, von dem kleine Durchgänge den Leopoldinischen Trakt unterfahren. Nach diesem neuerlichen Engnis, wo auch meistens ob der Düsenwirkung ein starker Wind weht, öffnet sich die Weite des Heldenplatzes. Nach den Gassen und Straßen der Innenstadt mit ihren mittelgroßen Plätzen ist diese Größe etwas Besonderes. Der Horizont senkt sich ab, der Himmel kommt zur Geltung und wird wichtig wie nirgends sonst im dichten Stadtgebiet. An klaren Abenden steht die Venus über dem Burgtor, später ist es zuweilen der Mond, als Sichel oder voll.
An diesem Platz zeigt sich, daß Kapitalmangel nicht selten ein guter Städtebauer ist. Hätte man, wie von Semper geplant, nicht nur im Süden, sondern auch im Norden einen konkaven Gebäudeflügel errichtet, wäre das Ganze ein pathetischer, aber steriler, weil stark gebundener Platzraum geworden. Durch das Ausfließen nach Norden gewinnt der Platz seine großartige, befreiende Weite; der Blick gleitet über Volksgarten und Rathauspark zur Front des neugotischen Rathauses, die uns in ihrer Schrägsicht die Biegung des Rings vermittelt.
Beim Weitergehen bündeln die fünf Unterkolumnien des Burgtors die aufgefächerten Sehstrahlen, bevor wir den Ring, die identitätsstiftende städtebauliche Figur der Stadt des 19. Jahrhunderts, überqueren. Die doppelten Baumreihen sind kurz unterbrochen, das Vorfeld des Burgtors reicht räumlich über den Ring hinüber, die Bewegung auf dem großartigen Boulevard wird - ein weiteres Mal - durch eine Querachse gebremst. Semper wollte dies durch flankierende Triumphtore noch verstärken. Auch hier wirkt der Verzicht auf das akademistische Muster meines Erachtens nach subtiler.
Der nun folgende Maria-Theresia-Platz ist eigentlich kein Platz, sondern ein Garten. Beherrscht von den beiden Mittelrisaliten der Museen und dem Denkmal, das die Mitte besetzt hält, vermag sich kein integrales Raumgefühl zu entwickeln, der Raum gliedert sich auf in Zonen, die ihrerseits nach beiden Seiten ausfließen. Die eher unattraktiven, kaum raumbildenden Schwarzkiefern vor der Lastenstraße bieten wenig Halt, stören aber den Raumfluß. Nun folgt die rein funktionale Achse der Lastenstraße, die in keiner Weise mit dem Ring vergleichbar ist. Da in beiden Richtungen doppelspurig befahren, bildet sie für Fußgänger eine unangenehmere Sperre als der Ring, auch wenn wir dort auf zwei Straßenbahngeleise zu achten hatten. Es versteht sich von selbst, daß eine Unterführung - nicht möglich wegen der U 2 - oder gar eine Überführung lächerlich wirken würde. Am ehesten diente ein breiter Zebrastreifen, auf das uns beschäftigende Vorfeld hinüber zu gelangen. Dahinter erhebt sich der Fischertrakt, in der Breite ausgreifend, aber nicht angemessen hoch. Als ältestes Bauwerk der näheren Umgebung ist ihm daraus kein Vorwurf konstruierbar.
Der Prospekt, der von Fischer auf Fernsicht über das Glacis hinweg entworfen wurde, hat für die Kurzdistanz an Wirkung eingebüßt. Immerhin bieten sich insgesamt fünf Tore als Durchgänge zu den dahinterliegenden Höfen und Platzräumen an. Er bildet daher keine wirkliche Sperre. Die Gestaltung der davorliegenden Fläche sollte aber mehrere Ansprüche einlösen: Unabhängig von historischen Animositäten ist der städtische Raum des Maria-Theresia-Platzes im Westen wirkungsvoll abzuschließen, das heißt, alles, was die städtebauliche Wirkung der mittleren Gebäudeteile - das sind das Palais und die anschließenden Ovalställe - schwächen könnte, ist zu unterlassen. Zugleich sollen die Wege zu allen fünf Tordurchgängen sich entfalten können. Überhaupt sollte der Fischertrakt in seiner städtebaulichen Präsenz unterstützt werden. Ein Wiedererrichten der 1809 - anläßlich der französischen Belagerung - heruntergeschossenen turmartigen Dachaufsätze auf den Außenrisaliten würde ihm effektvoll unter die Arme greifen, die äußersten Durchgänge betonen und die auslaufenden Flügel gegenüber den Nachbarbauten stärken. Mit der differenzierten Dachlandschaft und den betonten seitlichen Abschlüssen, wie dies in der Darstellung von J. Ziegler gut erkennbar ist, gewänne der Fischertrakt jenes städtebauliche Gewicht, das er in seiner künftigen Funktion dringend nötig hätte.
Die Fläche davor ist als mehrfache Überlagerung zu interpretieren. Einerseits greift, wie gesagt, der Stadtraum zwischen den Museen über die Lastenstraße; andererseits sollten aber die Hof- und Platzflächen im Inneren des Museumsquartiers sich durch die Tore hindurch bemerkbar machen, den Fischertrakt nicht als Barriere interpretierend, sondern als notwendiges Dazwischen zum nächsten städtischen Außenraum.
Nach ausführlichen Besprechungen mit den zuständigen Magistratsabteilungen, dem Bundesdenkmalamt, Gartendenkmalpflegern und Grünraumgestaltern liegt vom Atelier Ortner & Ortner ein Projekt vor, das nicht schlecht ist, das aber auch noch nicht wirklich begeistert, weil es irgendwie unentschieden bleibt. Die Bezirksvorsteherin von Wien-Neubau, Gabriele Zimmermann, erwartet sich für den Ort eine qualitative Steigerung. Für eine eigenständige Gestaltung ist die Fläche aber zu knapp und ihre städtebauliche Stellung zu schwach. Die Aufgabe ist daher viel schwieriger: Mit weitgehender gestalterischer Zurückhaltung soll die Verbindung von hinten nach vorn, von der „Vorstadt“ zur „Stadt“ und umgekehrt, von den Museen des 19. zu jenen des ausgehenden 20. Jahrhunderts geschaffen werden. Das hat mit der Fertigstellung einer angeblich imperialen Achse wenig zu tun - wie lange die Habsburger nicht mehr regieren in Wien, kann sich jede und jeder an den Fingern abzählen -, sondern mit stadträumlicher Sensibilität.
Eine Sache kann radikal falsch oder einfach dumm sein - Radikalität oder Einfachheit sind keine Qualitäten an sich. Nach all den Tabulae rasae des Jahrhunderts, nach Moderne und Gegenmoderne: was können wir aus dem Novecento lernen
Der Begriff Novecento"leitet sich von den Jahrhundertbezeichnungen der italienischen Renaissance mit Quattrocento und Cinquecento her. Bestimmend ist die Ziffer des Hunderters. Das Novecento begann somit 1900 und endet heute. Die nordalpine Zählweise ist um ein Jahr verschoben und benötigt noch zwölf Monate, um das 20. Jahrhundert vollzumachen.
Jene, die schon immer gern vom Unerledigten ins Unabsehbare flüchteten, reden jedoch unverfroren vom Beginn des nächsten Jahrtausends. Als überzeugte Europäer dürfen wir jedenfalls in einem Jahr noch einmal von Herzen feiern. Daß die Werbeplaner diese doppelte Chance im Sinne eines Vorrohrkrepierers verjuxen, stellt ihnen kein gutes Zeugnis aus.
Doch bleiben wir bei der Architektur. Das Novecento startet mit lebensreformerischen Bestrebungen, dem Bruch mit Konventionen und der Besinnung auf frühbürgerliche Werte und Traditionen. Gestalter, Handwerk und Industrie finden sich in den Werkbünden und begründen das Industrial Design. Der Erste Weltkrieg mit den Schrecken von Grabenkampf und Gaskrieg erstickt die zarten Tendenzen. Angestauter sozialer Druck entlädt sich in Revolutionen.
In der Verzweiflung gedeiht der Glaube an absolute Lösungen, die Tabula rasa wird rechts und links zum beherrschenden Paradigma. Von Industrialisierung und Moderne überzeugte Gestalter propagieren den totalen Ersatz des Bisherigen durch den „modernen Zweckbau“. Die Bewahrer des Alten reagieren auch nicht zimperlich. Das flache Dach gilt als bolschewistisch. Vorsichtig reformerische Bestrebungen werden zerrieben.
Ein weiterer Weltkrieg und totalitäre Ideologien zerstören sowohl die Kultur des einzelnen durch Traumatisierung, Entwurzelung und Tod als auch die Kultur gewachsener Gemeinschaften durch Rassismus, Angriffskrieg und Massenmord. Der Bombenkrieg führt zu Architekturzerstörungen größten Ausmaßes. Diese Traumata behindern lange ein Wiedererstehen qualifizierter Architektur- kultur. Der Wiederaufbau erzwingt Pragmatismus, Mittelmaß herrscht vor. Es kommt zu einer abgeschwächten Weiterführung von Moderne wie Gegenmoderne. Beide Strömungen unterliegen dem Bauwirtschaftsfunktionalismus unter modernistischer Tünche.
Die zunehmende ökologische und demokratiepolitische Verunsicherung in den sechziger und siebziger Jahren provoziert ein Infragestellen unreflektierter modernistischer Dogmen und das Ausrufen der Postmoderne, die sich zwar in der Breite als formalistischer Flop erweist, aber ein Nebeneinander verschiedener Strömungen zuläßt, die teils untereinander in erbittertem Streit liegen und die Kämpfe der zwanziger und dreißiger Jahre noch einmal durchspielen. - Heute, am Ende des Novecento, gibt es einmal den relativ breiten Strom einer pragmatischen Weiterführung der Moderne, dem es weitgehend gelungen ist, die inhaltliche Kritik einzuarbeiten. Neben zahlreichen Einzelbauten sind da und dort ansehnliche Ensembles moderner Raum- und Gestaltauffassung entstanden.
Die Betonung der Konstruktion in High-Tech-Manier zeitigt einerseits attraktive Leichtbauten, welche die Einflüsse von Flugzeugbau und Seglerromantik nicht verleugnen. Das Material Glas hat im Novecento eine beispiellose technologische Entwicklung durchgemacht, die heute allgemein verbreitet ist. Doch findet sich zuweilen ein konstruktiver Formalismus, der unangenehm in den Vordergrund drängt.
Die Negation klassischer Konstruktionsprinzipien führt zu einem gegenteiligen Ausdruck. Allerdings erfordert gerade dies noch viel eingehendere fachliche Kenntnisse und enorme konstruktive Kreativität, da die Entwürfe ja „baubar“ gemacht werden müssen, ohne daß der Ausdruck des Unkonstruktiven, des Nichttragens, ja Unbelastetseins verlorengeht.
Relativ exakt auf Peter Zumthor - oder auf Tadao Ando - läßt sich eine Bewegung zurückführen, die das Wesen des Materials betont, Holz als Holz, Stein als Stein, Beton als Beton und sonst als nichts anderes zur Geltung bringen will. Wohldosiertes Pathos und gekonnte Auratisierung spielen eine gewichtige Rolle. Wie schmal dieser Pfad ist und wie rasch die Stimmung ins Peinliche oder gar Lächerliche abgleiten kann, führen uns gewisse epigonenhafte Großbüros in diszipliniert uninspirierter Weise vor.
Übertragung von Wirkungsweisen aus der Kunst, vornehmlich aus der Minimal Art, bestimmen eine weitere Richtung. Als „neue Einfachheit“ arbeitet sie mit dem Pathos von Sparsamkeit und der Auratisierung von Verzicht. Extrem anspruchsvoll in der Ausführung, erträgt sie nicht die geringste optische Störung, da diese sofort unerwünschte Bedeutung erlangen würde.
Seit den siebziger Jahren bewegt die Frage der Ökologie und der Nachhaltigkeit die Gemüter. Was als oft sektiererische Bewegung begann, ist heute tief in die Lehre von Konzeption und Detailkonstruktion eingedrungen. Auf den architektonischen Ausdruck kann dies Auswirkungen haben, ist aber nicht zwingend.
F ragen des verdeckten Energieverbrauchs und der Raumplanung werden wichtig. Das Nullenergiehaus auf dem Land bringt wenig, wenn zwei Erwachsene mit zwei Autos in die Stadt pendeln.
Neben diesen etablierten Strömungen finden sich da und dort experimentelle Tendenzen, die über formalistische Attitüden hinausreichen und an denen sich zeigt, daß die Debatte weitergeht.
In der zweiten Hälfte des Novecento wächst die Rolle der Medien bezüglich Information und Desinformation gewaltig an. Dabei soll nicht vergessen bleiben, daß sich Architektur am besten durch sich selbst vermittelt. Die Verselbständigung diverser medialer Wirklichkeiten, auch die der sogenannten virtuellen Architektur, zeigen nur umso deutlicher die Unersetzlichkeit der direkten Architekturerfahrung auf, die mit allen Sinnen, nicht bloß mit den Augen, erfolgt; wo nicht zuletzt reale Gebrauchsspuren vor dem Hintergrund kulturgeschichtlichen Wissens Bedeutung erlangen. Die neuen Medien kommen daher zu den bisherigen dazu und stehen mit diesen in Konkurrenz um Gunst und Zeitbudget des Publikums.
Da Gebautes eine längere Errichtungszeit voraussetzt und nicht pausenlos nach Opportunität veränderbar ist, ist Architektur nur bedingt populismus- tauglich. Man braucht sich daher nicht allzusehr zu sorgen, das aufgemotzte Pathos eines politischen Sattelbefehls ist kurzlebig. Architektur entfaltet ihre Breitenwirkung in nachhaltiger Verzögerung.
Wir sind also am Ende des Novecento angelangt. Als Bild dient uns eine Photographie des Theatersaals der Jesuiten, angefüllt mit dem Gerüst, das den provisorischen Boden für die Restaurierung der Deckenfresken trägt. Das dienende Raumgitter füllt den Großraum, macht Raum quasi sichtbar, neutralisiert ihn aber zugleich bezüglich seiner Benutzung. Das Gerüst gewinnt ästhetische Qualitäten. Der temporäre Zustand hat Dauer. Wir haben einen Zwischenstand vor uns. Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen.
Anstelle eines Ausblicks frage ich, was wir vom Novecento lernen können: Zuvörderst die Erkenntnis, daß das Prinzip der Tabula rasa nur selten zielführend ist. Das Neue leistet nicht vollständigen Ersatz des Bisherigen, es kommt vorerst einmal dazu, muß sich in der Praxis und unter sich verändernden Bedingungen bewähren, gegenüber noch neueren Ansätzen behaupten. Ein Prozeß, der weder logisch noch gerecht und ohne Garantien abläuft.
Soziale Fragen werden nicht mit Architektur gelöst, sondern müssen von der Politik vorbereitet werden und in taugliche Programme umgegossen werden. Die Architektur kann in der Folge Antworten anbieten. Vergessene Fragen und unterdrückte Antworten suchen sich dennoch ihre Räume, auch ohne Architekten. Es gilt daher vorab, die Bestellqualität auf Bauherrenseite zu verbessern und deren Verantwortlichkeit durch Repersonalisierung zu erhöhen.
Die immer wieder genährte Hoffnung auf einen „neuen Menschen“, der die neue Architektur richtig nutzt und empfindet, ist eine Illusion. Da wird auch Gentechnologie nicht weiterhelfen. Man wird mit Menschen, wie sie sind, arbeiten und kultivierend tätig sein. Nicht auf schnellen Vorteil bedacht, sondern auf nachhaltige Entwicklung. In der Rückschau wird man es dann Hochkultur nennen.
B edeutungen haften nur bedingt und zeitlich begrenzt an Formen und Bauwerken. Es ist die Nutzung, die ihnen mittelfristig ihre Bedeutung zuschreibt. Eine geistige Entideologisierung der Formen bietet daher neue gestalterische Freiräume, eine bewußte Übernahme von Formen samt Ideologie engt sie ein.
Nicht in Architekturzeitschriften sind neue Ideen zu suchen, sondern aus der Problemstellung heraus zu erarbeiten. Die Architekten sollen selber denken und nicht zirkelschließend im bedingten Reflex den Pawlowschen Hunden der Architekturkritik folgen. Radikalität oder Einfachheit sind nicht Qualitäten an sich. Eine Sache kann radikal falsch oder einfach dumm sein. Ob radikal oder behutsam richtig ist, folgt aus der Analyse der Aufgabe; ob ein Konzept einfach oder komplex sein soll, wird auch vom Kontext mitbestimmt.
Das Zwischenjahr mit den augenfälligen Nullen bietet somit genügend Stoff zum Überdenken - um dann weiterhin zu bauen.
Hermann Kaufmann mit einem Biomasse-Heizwerk in Lech und Christian Lenz mit einem Apartment-Haus in Warth stellen einfrucksvoll unter Beweis: Auf den falschen Firnis verlogener Heimattümelei kann beim alpinen Bauen mittlerweile verzichtet werden.
Nach den elegant ausgebauten Kehren an der Westseite des Arlbergs wenden wir uns kurz vor der Paßhöhe nach Norden, um auf der von zahlreichen Lawinengalerien geschützten Flexenstraße den Wintersportort Lech zu erreichen. Unterwegs taucht vor uns im Windschutzscheibenausschnitt ein großes, holzverschaltes Gebäude auf, dessen Frontseite hoch aufragt, während das Dach pultartig flach nach hinten abfällt.
Der Bau liegt einige hundert Meter vor dem Dorf, an einer Stelle, wo Straße und Flüßchen um den knappen Raum wetteifern und die Talflanken schluchtartig zusammenrücken. Es blieb gerade noch genug Platz, um das Biomasse-Heizwerk für das nahe Lech zu errichten. Die Straße fällt in einer Rechtskurve relativ steil ab. Ihrem äußeren Rand folgt konkav eine über zehn Meter hohe, oben holzverbretterte Wand.
Der als Stützmauer niedrig beginnende, gestockte Betonsockel wird mit fallender Straße höher, übernimmt dann die Funktion der Gebäudebasis, löst sich aber nach halber Länge auf in drei runde Stahlbetonstützen, hinter denen eine offene Vorhalle liegt. Immer höher wird der untere, nun verglaste Teil, während der obere, holzverkleidete, dem Gefälle der Straße folgend, abnimmt. Nach Norden ergibt sich daraus eine klare Teilung 1:1, oben Holz, unten Glas.
Der Baukörper des Biomasse-Heizwerks interpretiert feinfühlig Topographie und Straßenverlauf. Markant bildet er ein künstliches Engnis als Auftakt zum darauffolgenden natürlichen Engnis. Er dialogisiert mit den Mitteln von Volumen, Proportion und Material mit der bestehenden Situation und schafft zugleich einen neuen Ort. Und das alles ziemlich unprätentiös. Wie eine textile Decke scheint der Holzschirm über einem unsichtbaren Gestell zu hängen, an der Attika abgekantet, unten bündig abgeschnitten. Die Stirnseiten sind leicht zurückgesetzt, an der Südseite in Form zweier gebäudehoher Schiebetore, so hoch, daß die Lastwagen zum Entladen mit vorn hochgestemmtem Ladecontainer hinausschieben können.
Doch meist sind sie geschlossen, wirken fast abweisend. Ganz im Gegensatz dazu ist die Nordfassade mit Glaswand und Vorhalle einladend. Eine Besichtigung ist nicht ausdrücklich verboten, Kinder und Jugendliche sollen aber nur in Begleitung Erwachsener hineinschauen, besagt ein Hinweiszettel. Als ökologisch wichtige Maßnahme zur Luftverbesserung im Kurort, wo bei den nicht seltenen Inversionslagen Hausbrand und Autoverkehr die Schadstoffkonzentration unangenehm ansteigen lassen, ist die Anlage Teil einer Basisinfrastruktur zur nachhaltigen Verbesserung des touristischen Angebots. Über diese Nutzfunktion hinaus bildet die von Architekt Hermann Kaufmann gestaltete äußere Hülle eine Station in der Tradition alpiner Baukunst, wie sie Lois Welzenbacher und Franz Baumann für dieses Jahrhundert begründet haben.
Einige wenige Kilometer von Lech entfernt liegt das Bergdorf Warth. Doch trennt ein unverbauter Lawinenhang die beiden Wintersportorte. Am südöstlichen Siedlungsrand, mit Blick gegen Lech hat der Vorarlberger Architekt Christian Lenz ein Apartment-Haus an die Hangkante gebaut, das dieser Tage in Betrieb geht. Zwölf kleine und zwei etwas größere Einheiten sind in einem liegenden Prisma versammelt, vor dessen Südostfassade sich dreigeschoßig Balkone hinziehen, die an den Stirnseiten keck über das Gebäudevolumen hinausstehen.
Die übrigen drei Fassaden sind horizontal mit Lärchenbrettern verschalt. Noch strahlen sie hell und schnittfrisch, während die nahen landwirtschaftlichen Nutzbauten von Sonne und Wetter längst dunkelbraun gegerbt sind und dennoch den warmen Grundton nicht verloren haben. In der kühlen und trockenen alpinen Höhenlage hält Holz länger, kann es unbedenklicher bezüglich Feuchtigkeit eingesetzt werden, weil die organischen Zerfallsprozesse langsamer ablaufen. Holz ist daher ein ideales Material fürs Bauen in den Bergen.
Doch wissen gerade die Vorarlberger Holzbauspezialisten um die Brandgefährdung des Materials Holz. Das Innere des Apartment-Hauses ist daher durch Schotten aus Stahlbeton unterteilt, die auch die drei Stiegenhäuser umschließen. Die Apartments weisen zwei Zimmer, Bad und Kochnische auf. Der breite Balkon würde selbst bei Wintersonne zum vergnüglichen Frühstücken einladen – wenn nicht die weißen Pisten wirksamer lockten.
Das knapp kalkulierte, rational konzipierte Bauwerk erscheint nicht als Fremdkörper, weil es sorgfältig in die Topographie eingefügt wurde. An der Rückseite entsteht zwischen der zweieinhalbgeschoßigen Hausfassade und dem in den Hang eingegrabenen, erdüberdeckten Carport eine Gasse, die durch die drei Eingänge mit ihren kurzen, kragenartigen Wetterschutzvorbauten belebt wird.
Die mittlere Größenordnung des Gesamtbaukörpers wird durch diese Dreiteilung angenehm relativiert. Die Vorderfront,als Ganzes auf Fernwirkung bedacht, erhält mit der luftigen Balkonstruktur eine schleierartige Raumschicht vorgelagert, die das kantige Volumen weicher macht.
Dem Entwerfer gelingt es damit, in einer zeitgenössischen Formensprache zur nahen und ferneren Umgebung zu vermitteln, das Bauwerk zwar neu, aber in struktureller Hinsicht nicht fremd erscheinen zu lassen. Dies wird sich insbesondere als Qualität erweisen, wenn das Gebäude später mit wettergebräunter Hülle in schneefreier Landschaft steht. Da Schnee die Konturen weich werden läßt und vieles zudeckt, wirken Bauwerke im Winter meist „idealer“ und präziser von der Umgebung abgesetzt. Der Anblick im Sommer bildet daher eine härtere Prüfung.
Hermann Kaufmann und Christian Lenz arbeiten schon seit längerer Zeit in Ateliergemeinschaft. Meistens bearbeiten sie ihre Bauten individuell, bei komplexeren Aufgaben aber auch gemeinsam, da das Gespräch Eindringtiefe und Qualität steigert und Christian Lenz nach einem Jahr Designpraxis in Italien zusätzliche Aspekte einbringt.
Doch stehen sie in Vorarlberg nicht allein. Andere Büros arbeiten vergleichbar. Gesamthaft zeigt sich, daß zeitgenössische Architektur auch für die Tourismusindustrie selbstverständlicher geworden ist.
Auf den falschen Firnis verlogener Heimattümelei kann mittlerweile verzichtet werden. Die Kriterien verschieben sich hin zu zeitgenössischer architektonischer Qualität.
Die Skepsis war groß: Würde es gelingen, die Gebäude der Veterinärmedizinischen Universität im dritten Wiener Gemeindebezirk für die Universität für Musik und darstellende Kunst zu adaptieren? Reinhard Gallister schaffte es – mit Eingriffen in den klassizistischen Zweckbau.
Die ausgedehnten Anlagen des ehemaligen kaiserlichen „Tierarznei-Instituts“hinter der Straßenzeile an der Ungargasse im dritten Wiener Gemeindebezirk, die mit ihrer eher bescheiden wirkenden Hauptfront zum Bahneinschnitt orientiert sind, befanden sich in einem desolaten Zustand. Sie waren in den Jahren 1821 bis 1823 von Johann Aman (1765 bis 1834) errichtet worden, dessen Name wohl nur einem kleinen Prozentsatz der Fachleute heute noch geläufig ist. Damals war er immerhin Hofbaumeister, und sein in sprödem Klassizismus errichteter Zweckbau hat seine kühle, disziplinierte Grundhaltung mittlerweile wiedergewonnen. Anfangs hatten nicht wenige gezweifelt, ob diese Substanz für die Verwendung als Musikuniversität überhaupt taugen könne.
Es bedurfte eines ausgeprägten Möglichkeitssinnes, in den von zahlreichen Einbauten und abgehängten Decken überwucherten, mehrheitlich als Labors genutzten Baustrukturen die historischen wie die künftigen Räume zu erschauen, in denen neu die universitäre Musikausbildung in Wien stattfinden sollte. Reinhard Gallister als Architekt und Generalplaner sowie Gerhard Buresch von der Bundesimmobiliengesellschaft als Bauträgerin und die Gruppe der Nutzervertreter um Rektor Erwin Ortner standen daher vor einer anspruchsvollen Aufgabe.
Johann Aman hatte den Hauptbau der Tierarznei-Schule um einen querrechteckigen Hof organisiert, auf den er den Erschließungsgang orientierte. Die Treppenhäuser befinden sich jeweils in Traktmitte. Die Hauptansicht zum heutigen Bahneinschnitt –damals der Wiener Neustädter Kanal, dessen unterste Schleusenstufe sich exakt vor dem Hauptbau befand – zeichnete er durch einen palaisartigen Mittelbau aus; niedrigere, freistehende Flügelbauten verliehen der Schaufront zusätzliche Breite. Heute ist sie durch den unregelmäßigen Baumbestand in ihrer Wirkung leider ziemlich eingeschränkt. Ein auf die Architektur abgestimmtes gärtnerisches Pflanz-und Pflegekonzept würde die Wirkung auf mittlere Distanz wesentlich verbessern.
Das Innere der Gebäude wurde durch die Erneuerung wieder auf seine ursprünglichen räumlichen Strukturen zurückgeführt. Eine Mittelmauer in asymmetrischer Lage trennt Gang- und Foyerbereiche von den Übungssälen und -zimmern. Dabei kommen die Mauerstärken von über einem Meter den akustischen Bedürfnissen entgegen. Einziger Störfaktor ist die Bahnlinie, insbesondere die Güterzüge, weshalb die empfindlichsten Nutzungen in den hofseitigen Trakten untergebracht wurden.
Das gesamte Erdgeschoß ist massiv überwölbt, was den Räumen zu einem feierlichen Ausdruck verhilft. Die Mauern und Gewölbekappen wurden glatt geputzt und weiß gestrichen, wodurch die klaren räumlichen Dispositionen zutage treten. Dazu im Gegensatz stehen die Treppenhäuser, die Aman in rauhem Muschelkalk, aber in feiner Detaillierung ausgeführt hatte, sodaß sie sich mit ihrer materialen Kraft vom abstrahierenden Weiß absetzen. Ein bequemes Stufenverhältnis von 13 zu 40 Zentimetern – heute gelten 16 auf 30 Zentimeter als Norm – bestätigt, daß die Treppenanlagen nebender säulengeschmückten Eingangshalle dem Hofbaumeister gestalterisch ein Hauptanliegen gewesen sein müssen. Von der damaligen Festsaalgestaltung ist hingegen nichts erhalten.
Dieser durchaus noblen, vom Bundesdenkmalamt gewürdigten Struktur überlagerte Architekt Gallister sein System hinzugefügter Elemente, das in Form unterschiedlich gearteter Paneele klar als neue Maßnahme erkennbar bleiben wird. Damit ist die historische Struktur nicht verunklärt, sondern erfährt eine Präzisierung und Steigerung.
Alle Übungsräume mußten mit Doppeltüren ausgestattet werden. Dies wurde so gelöst, daß gangseitig ein Paneel vor die Mauer gestellt wurde, in das eine oder mehrere Türen bündig eingeschnitten sind. Der warme Buchenholzton erzeugt in den Gängen und Foyers eine angenehme Stimmung. Die Holzverkleidung zieht sich nun in der Türlaibung nach innen und weitet sich im Übungszimmer wieder zum Paneel – oft sogar noch in einer Raumecke weitergeführt – ,in das die Tür wieder bündig eingeschnitten ist. Feine Lochungen überziehen zwecks Dämpfung des Halls innen und außen und im Türzwischenraum die in Buche furnierten Tafeln. In aufwendiger Konstruktion sind sämtliche Zwischenwände in den Übungsbereichen doppelt ausgeführt und um einige Winkel gegeneinander verschwenkt, was mit dem Auge nicht bemerkbar ist, sich aber raumakustisch positiv auswirkt, da ein Flatterecho vermieden wird.
Die Decken der überwölbten Räume mußten speziell behandelt werden, da konkave Flächen extrem problematisch sind, weil sie die Schallwellen fokussieren. In Zusammenarbeit mit dem Akustiker Karl Bernd Quiring entwickelte Gallister ein abgehängtes konvexes Paneel, in das auch die Beleuchtungselemente integriert worden sind. Ebenfalls in Buche furniert, trägt es mit dem Parkettboden zu einer wohnlichen Raumstimmung bei, ohne daß der Sachverhalt der Überwölbung wie bei einer abgehängten Decke ausgeblendet wäre. Im Gegenteil, die in den Gewölbeansatz hinaufgreifenden Anschnitte der Rundbogenfenster bleiben sichtbar.
Mag sein, daß der spröde Klassizismus des Johann Aman heute anders gesehen wird als noch vor wenigen Jahrzehnten. Die zeitgenössische Architekturströmung einer schnörkellosen Einfachheit schafft es jedenfalls ausgezeichnet, mit den klaren Proportionen der Räume und dem kühlen Weiß der Mauern in Dialog zu treten.– Die Lage der Gangbeleuchtung ist auf die Fensterachsen der Hoffassade abgestimmt und in „Striche“(Fluoreszenzleuchten) sowie große (Tiefstrahler) und kleine „Punkte“ (Halogenleuchten) differenziert.
Es ergibt sich, entsprechend den Fensteröffnungen für das natürliche Licht, eine architektonisch gebundene Ordnung für die Beleuchtung, auf die zudem die jeweiligen Längen der Türpaneele abgestimmt wurden, sodaß ein subtiles Zusammenwirken von Decke und Wänden entsteht, das zwar kaum explizit wahrgenommen wird, aber dennoch räumlich eine Rolle spielt.
Konzertsäle und Studioräume erfuhren unter Beiziehung des Akustikers eine intensive Bearbeitung. Mehrere Paneele – teils verschwenkt und hart, teils hinter einer leichten Stoffbespannung weich und veränderbar – bestimmen sowohl akustisch als auch gestalterisch den Raum. Hier setzte Gallister gezielt Farbe ein, um den Sälen Individualität und zusätzliches Flair zu verleihen. Die Fensterwände blieben unverändert, sodaß eine Gesamtidentität gewahrt bleibt.
Mit sparsamen architektonischen Interventionen gelang es bei diesem Bauwerk, den kargen Ausdruck klassizistischer Zweckarchitektur in eine geringfügig, aber entscheidend festlichere Stimmung zu versetzen, die der international gewichtigen Wiener Universität für Musik und darstellende Kunst angemessen ist.
Differenziert und ausgewogen zugleich: Das neueste Bauwerk von Architekt Heinz Tesar bietet der Sammlung von Agnes und Karlheinz Essl in Klosterneuburg Raum und Heimstatt.
Da Stadtgebiet von Wien wird etwas außermittig vom Donaustrom in nordwest-südöstlicher Richtung durchschnitten. Vor den Grenzen der Stadt, aber noch in ihrem Wirkungsbereich – und auch nicht allzu weit entfernt vom Strom – liegen im Südosten und im Nordwesten zwei Pole einer Unternehmenskultur, für die sich im Kleinstaat nicht so leicht Vergleichbares findet. Der Mega-Baumarkt im Südosten, in Schwechat, steht für das ökonomische Fundament des Schömerkonzerns. Seine dynamische Architektur, von Dieter Henke und Marta Schreieck entworfen (siehe „Spectrum “vom 7.November 1998) zählt zu den absoluten Glanzlichtern unter den oft belanglosen Angeboten für diese Bauaufgabe.
Im Nordwesten, am Rande des Auwalds, überragt von der Klosterneuburger Stadtsilhouette, ruht blockhaft unverrückbar das neueste Bauwerk von Architekt Heinz Tesar, das der Sammlung des Ehepaars Agnes und Karlheinz Essl Raum und Heimstatt bieten wird. Unweit befindet sich seit 1987 der Sitz der Firmenzentrale, ebenfalls von Heinz Tesar entworfen, ein Hauptwerk aus dem Schaffen der „Wiener Szene , die aus ihrer kritischen Haltung zur Moderne kein Hehl machten. Seine ovale Mittelhalle und die Galerien dienten bisher der Präsentation der wachsenden Kunstsammlung der Firmeninhaber. Die drei Bauwerke sind Teil des breiten kulturellen Engagements der Familie Essl.
Die Lage des Neubaus zwischen Auwald und den Verkehrsträgern Straße und Eisenbahndamm, von letzterem räumlich abgesetzt durch einen Weingarten, kommt dem mächtigen Solitär zupaß. Der Bauplatz gehört gerade nicht mehr zum Gewerbegebiet, ist diesem aber noch verbunden, weil er nicht auf der Stadtseite, sondern auf der Stromseite der Bahnlinie liegt, eine qualitative Trennung, die erst die jüngste Zeit relativiert hat.
Ein hoher Sockel aus Sichtbeton, der aber mittels einer Schattenfuge vom umgebenden Terrain abgesetzt ist, trägt den weiß geputzten Überbau. Das mächtige Volumen negiert visuell die erwartete Verankerung im Erdreich und wirkt daher leicht angehoben, wie auf einem Luftkissen.
Die ungefähr dreieckige Grundkonfiguration ergibt drei Fassaden und drei Eckausbildungen. Dabei ist die Ansicht zur Stadt geeignet, aus Distanz betrachtet zu werden. Sie ist nach Westen orientiert und wird im Sockelbereich durch drei große Dreiecknischen in ihrer Länge gegliedert und von sechs Oberlichtgaden gekrönt, die über einer weitgehend geschlossenen Wand aufgereiht sind. Die Nordwestspitze des Baukörpers löst sich in gefächerte Betonscheiben und einen zylindrischen Erker auf. Beide Maßnahmen bieten dem Sog der langen Fassade sowie der Versuchung zum Pathos Widerstand und halten den Baukörper ohne Anstrengung an der Stelle. Die Südecke ist zu einem rechten Winkel beschnitten, ein kräftiges, turmartiges Prisma setzt hier den Akzent. Weich schwingt sich die flache Kuppe des Daches über der oberen Ausstellungshalle in die entgegengesetzte Richtung und schafft einen Ausgleich.
Die anderen beiden Fassaden treten von der Zufahrtsstraße her übereck in Erscheinung. Das schlanke Liftprisma vor der Südostseite betont die Eingangssituation, während die nordöstliche Flanke ruhig und geschlossen wirkt, ohne jedoch abzuweisen. Der Schwung des Daches nobilitiert das Bauwerk in sparsamer Weise. So ist das gesamte Äußere differenziert und ausgewogen zugleich.
Eine kleine Rampe überwindet den einen Meter Höhendifferenz zum Eingang, der über dem Niveau des 1000jährigen Hochwassers liegt, zum Schutz der Depots im Sockelgeschoß. In der hohen Eingangshalle entwickelt sich die Treppe kunstvoll nach oben und erschließt auch die beiden Zwischengeschoße, die auf dieser Seite eingeschoben sind. Hat man – mit Lift oder über die Stufen – die Ausstellungsebene erreicht, werden die Besucher von einem Foyer empfangen, dessen breite Glaswand zum begrünten Innenhof geöffnet ist. Damit wird ein Eindruck vermittelt, als würde man noch einmal im Erdgeschoß beginnen. Hier bietet sich ein Rundgang an: nach links, mit den sieben Oberlichtsälen beginnend, oder nach rechts, durch die untere Ausstellungshalle, die über Seitenlicht verfügt und von unterschiedlich breiten Mauerscheiben zoniert wird. Den langen Raum begleitet die Spalte eines Deckendurchbruchs in die darunter befindlichen Depots. Der Blick fällt in den Manipulationsgang; Unten und Oben werden in Beziehung gesetzt; die Ausstellungsfläche dient als Schauseite einer dichtgepackten Sammlung.
In der Ausstellungshalle fällt der Zylinder einer gebogenen Wand auf, hinter der eine Treppe nach oben führt. Als Galerie tangiert der Weg hinauf die oben offene Rotunde, es entsteht ein Übergangsraum, der zwischen den beiden Ausstellungshallen liegt. Von unten betretbar und von oben einsehbar, gehört er zu beiden Ebenen und scheidet sie als Mittler dennoch voneinander. Die obere Halle wird von der Dachkuppe überwölbt. Lichtschlitze die mit zunehmender Raumhöhe dichter stehen, verstärken dynamisch das räumliche Empfinden. Im vorderen Bereich sind hier der Shop und das Café angeordnet, eine Glaswand hält Störgeräusche ab.
Räumlich sind die Säle und Hallen von großer Mannigfaltigkeit. In den Oberlichtsälen gehen die Wände konkav gerundet in die Decke über, aus der dann wieder ein Trapez für die Lichtgaden ausgeschnitten ist. Lichtquelle und Abschattungsmaßnahmen bleiben sichtbar. Die Bildbetrachtung stören sie kaum, weil sie hoch liegen und eine obere Raumkante durch die Rundung vermieden wurde.
Die Verbindungen zwischen den Sälen sind von zweierlei Gestalt: einmal als pfortenartige Durchgänge, die aus den trennenden Wänden herausgeschnitten sind, und einmal als schlitzartige Durchlässe entlang der schrägen Außenmauer. So erhält jeder Raum eine klassische und eine moderne Öffnung. Daraus ergeben sich Gruppierungsmöglichkeiten, harte Schnitte und gleitende Übergänge finden eine räumliche Basis. Spontan wirkende Ausblicksfenster in Bodenhöhe oder an Raumkanten konterkarieren die Strenge der weißen Wand, ihre schlitzartige Dimensionierung vermeidet jedoch eine Konkurrenz zu den Bildern.
Dennoch werden die Kunstwerke hier nicht wie Pflegefälle behandelt, die nicht dergeringsten visuellen Störung ausgesetzt werden dürfen, weil ihre Aura Schaden nehmen könnte. Vielmehr vertraut man auf die Kraft der Werke, deren Wirkung von den gezielt gesetzten Öffnungen und der räumlichen Varianz kaum geschmälert, sondern vielmehr verstärkt werden kann.
Dasselbe gilt in der unteren Ausstellungshalle, wo verschieden breite Wandscheiben eine auf den ersten Blick zufällig wirkende Gliederung in Raumzonen vorgeben. Der Raum ist hier offener, es entstehen mehr und gestaffelte Durchblicke. So können Bilder und Plastiken auch räumlich – nicht bloß nebeneinander – konfrontiert werden. Und einem freien Flanierender Besucher bieten sich Durchgänge und Durchschlupfe an. Die obere Halle will dagegen als Ganzes gesehen werden, auch wenn die offene Rotunde zonierend wirkt; aber der Schwung der Deckenkuppe ist stärker.
Heinz Tesar erzeugt mit seinen vielfältigen Raumkonfigurationen gleichsam eine Art Topographie, auf die mit der Positionierung der Kunstwerke eingegangen werden kann. Dennoch ist jederzeit eine Ortung möglich, Ausblicke und Durchblicke zeigen an, wo im Gebäude man sich gerade befindet. Oft läßt er ein Thema fast bruchstückhaft anklingen, gerade so weit, daß eine spezifische Stimmung entsteht, aber auch so knapp, daß ein Klischee vermieden wird. Damit gelingt es ihm, neben normalen Wandflächen zahlreiche mehrdeutige Plätze für Kunstwerke anzubieten, die erst mit deren Inhalt und Präsenz fixiert werden. Ein Ausloten dieser räumlichen Vielfalt mit der Schau zur Eröffnung und mit künftigen Ausstellungen dürfte dem Kunstgenuß angenehm förderlich werden.
Das Pionierwerk der Familie Essl kann nicht hoch genug gewertet werden. Zeitgenössisches Kunstschaffen trifft wegen mancherlei Ungleichzeitigkeiten beim Erfahrungsstand von Kommentatoren und Betrachtern oft zu Unrecht auf Mißverstehen. Hier kann das Engagement privater Sammler weit besser als der staatliche Museumsbetrieb anregend, entspannend und vermittelnd wirken, weil die persönliche Identifikation, ja die Besessenheit dieser Kunstfreunde direkt spürbar wird, sodaß die Funken überspringen und sich Menschen auf Werke einlassen, denen sie vorher ablehnend gegenüberstehen mochten. Wenn sich öffentliches und privates Engagement in einem derartigen Wechselspiel entwickeln können, öffnet sich ein Ausweg aus der Sackgasse, in die eine vornehmlich staatliche Kunstpolitik immer wieder zu geraten droht. Das Gegengewicht dieser vielgleisigen und wendigeren privaten Kunstpolitik gibt den Kunstschaffenden mehr Bewegungsraum und Unabhängigkeit.
Stehen wir vor einer Wende in der Architektur? Was nützt das Herbeireden und Herbeischreiben, wenn die Architekten nicht weitertun? Nichtraucher und Nichttrinker debatierten aufs heftigste, wie es mit er Architektur weitergehen soll, und wurden dabei belauscht.
Der Berichterstatter konnte sich in letzter Zeit nur selten im Café Museum gemütlich hinsetzen, um dem Nichtraucher und dem Nichttrinker bei ihren Auslassungen zum aktuellen Architekturgeschehen zuzuhören. Weil er ihre Sager nicht ganz aus den Ohren verlieren wollte, hat er sich wieder einmal dazugesetzt, sich kundig zu machen. Wie in Wien nicht unüblich, definieren sich die beiden Kontrahenten dezidiert durch das, was sie ausdrrücklich nicht tun.
Nichttrinker:„Da war doch kürzlich eine Ausstellung über ein halbes Hundert Bauten in Österreich; und wenn ich mich richtig erinnere, lautete der Kommentar eines ernstzunehmenden Vertreters der Wiener Szene: ,Endlich haben wir in Österreich wieder einen Stil.‘ Dabei ist doch das Zeitalter der Stilkunst längst vorbei.“
Nichtraucher:„Da der Betreffende nikotnfrei lebt, schließe ich mich solidarisch seiner Meinung an. Ob eine breite Entwicklung als Stil identifizierbar wird oder ob sogenannte Stararchitekten seit 30 Jahren denselben Personalstil pflegen, ist unerheblich. Kommt eine Entwicklung ins Stadium eines Stils, ist es mit der Innovation vorbei. Stilexegeten verwalten nur mehr ein Schleifen am Ei. Seien dies nun die Neueinfachen mit faden Oberflächen und Lamellenkrankheit oder die High-Tech-Veteranen mit exhibitionistisch verschraubten Konstruktionen – letztendlich macht sich Langeweile breit.“
Nichttrinker:„Du machst die führenden Strömungen bloß aus Neid herunter. Je bekannter ein Baum, desto mehr Hunde lüpfen daran ihr Bein. Die Reinheit, ob in der Geometrie, der Konstruktion oder dem Material,dbildet in der Architektur einen Wert an sich. Das Streben nach absoluter Perfektion hat sie und ihre Schöpfer immer schon geadelt. Am meisten bewundert werden seit jeher jene Gebäude mit der reinsten Ausformulierung ihrer Architektur.“
Nichtraucher:„Interessanter sind allemal die Pionierwerke, weil daran die Entwicklung, quasi das fortschreitende Denken ablesbar ist. Man spürt dahinter die geistige Arbeit und kann das Wesen des Bauwerks besser nachempfinden.“
Nichttrinker:„Du möchtest wohl noch Künstlerschweiß riechen. Nein, diese Art Naturalismus lehne ich ab als schlechte Art, eigenes Unvermögen zu kaschieren. Da lobe ich mir jene Werke,wo die Anstrengung sublimiert ist, die in keiner Weise auf gehabte Mühen verweisen. Nur so ist ein wirkliches Genießen möglich, alles andere verursacht mir schon beim Anschauen Muskelkater.“
Nichtraucher:„Deine Anschauung ist oberflächlich und dringt nicht in tiefere Schichten eines Bauwerks ein. Wenn man die von dir gelobten Bauten befragt, repetieren sie nur Stereotypen. Weder erzählen sie etwas von sich, noch setzen sie Gefühle frei. Ihre Wirkung ist nicht nachhaltig. Erst eine bewegte Geschichte vermöchte sie aus ihrer Endlosschleife zu befreien. Eine vielschichtige Architektur, die mit dem täglichen Leben und Erlebender Menschen verknüpft ist, benötigt keine pathetische Stilisierung, deren Designer nur nach en pawlowschen Hunden in den Redaktionssesseln der Hochglanzmagazine schielen.
Da las ich doch kürzlich ein paar einleuchtende Sätze des Burgtheaterdramaturgen Stephan Müller, der sich als Fan von Schichten bezeichnet: ,Wie Goethe schon sagte, die Verschichtung ist wesentlich. Es gibt immer soundso viele Bedeutungsebenen. Und auch eine Theaterfigur wir immer interessanter, wenn neue Schichten aufgebrochen werden. Mein Credo geht in die Richtung, die Dinge so kompliziert anzuschauen, wie sie in Tat und Wahrheit sind. Theater funktioniert dann, wenn es gleichzeitig etwas Elementares anspricht, das ganz konkrete Alltägliche, und einen Durchstich schafft in etwas Rätselhaftes, Unbekanntes‘ („Schaufenster „Nr.38/ 1999). Damit wird das Ende der ,terrible simplification ‘eingeläutet.“
Nichttrinker:„Warum sollte das Theater der Architektur Erkenntnisse liefern. Architektur ist auf Dauer ausgerichtet. Mit ewigen Werten wie Geometrie und Proportionen sowie langlebigen Materialien wie Naturstein, Beton und Chromstahl, was auch als Ruine noch etwas hergibt. Derartige Bauwerke zu errichten, braucht es Stars, die das verharzte Regelgefüge der Baugesetze überwinden können und deren Personalstil gesicherte Publizität genießt. Nur noch Stars werden den europaweiten Kulturkampf überleben, die Absolventen mittelmäßiger Architekturschulen werden alle als Unselbständige in Großbüros verdümpeln.“
Nichtraucher:„Deine sogenannten Stars kochen doch auch mit Wasser. Besonders außerhalb der Metropolen. Bregenz ist nicht Luzern, und die verquetschten Cola-Dosen am Prager Moldauufer haben mit Bilbao schon gar nichts gemein. Sie sind vielmehr ein eklatantes Beispiel westlicher Überheblichkeit, die meint, für die unterentwickelten Osteuropäer würden zweit- und drittklassige Entwürfe ausreichen.
Vor allem können auch sogenannte Stararchitekten ein verfehltes städtebauliches Nutzungskonzept nicht retten. Das wird sich beispielsweise an den Wiener Gasometern zeigen, die ihre überragende städtebauliche Zeichenhaftigkeit verlieren werden, wenn sie nutzungsmäßig profaniert sind.
Man bedenke nur, was für ein tolles Technisches Museum dort mit Bahnanschluß und U-Bahn-Station möglich gewesen wäre. Dafür baut man daneben ein Kinocenter, was auch eine gescheite Nutzung für einen der Riesenkübel gewesen wäre. Hier liegt es im argen. Hier fehlen tragfähige Konzepte. Der Wille allein, ein besonderes Bauwerk zu errichten, das in den medialen Infight gehen kann, reicht nicht aus. Ohne konzeptionelle Basis können auch die Spin-Doktoren der Architektur nicht weiterhelfen.“
Nichttrinker:„Du weißt nicht, wovon du sprichst. Die neuen Medien und CAD werden die Architektur komplett umkrempeln. Da wird kein Stein auf dem anderen bleiben.“
Nichtraucher:„Gemach, gemach. Was nicht vorher als Konzept durchgdacht wurde, läßt sich auch nicht in den Computer tippen. Und warum sollte ich meine Freude beim Entwerfen ans Gerät abgeben? Wenn die Euphorien verflogen sind, werden die Ideen über die Implikationen des Arbeitsmittels – und mag es noch so dienstbar sein – die Oberhand behalten.“
Vegetarier (hat sich mittlerweile dazugesetzt): „Euer Streiten über gestrige Probleme ist ja rührend naiv. Die jungen Büros sind längst woanders. Sie arbeiten parallel mit Modellen, Zeichnungen und CAD, weil jede Darstellungsmethode im Prozeß der Konzept- und Formfindung ihre spezifischen Vorteile hat. Arbeitsmittel haben seit jeher dazu gedient, die Idee in verschiedenerlei Hinsicht zu überprüfen. Wem nichts einfällt, dem ist auch mit CAD nicht zu helfen.“
Ein multifunktionale Foyer und ein Tiefspeicher mit einer Kapazität von 6700 Fachmetern: so bieten sich die Räumlichkeiten unter dem Prunksaal der Österreichischen Nationalbibliothek nach der Neugestaltung durch Alessandro Alverà und Sepp Müller dar.
Der Prunksaal der Österreichischen Nationalbibliothek ist wohl den meisten Kulturinteressierten ein Begriff; viele haben ihn gesehen und vielleicht die Zahl der dort aufgestellten Bücher zu schätzen versucht. Auch wenn – nach offiziellen Angaben – zirka 190.000 Bände in den barocken Regalen aufgereiht sind, reichte der Raum schon lange nicht mehr aus, um die umfangreichen Bestände zu fassen. Daher dienten die darunterliegende erdgeschoßige Halle und auch die Untergeschoße als Bücherspeicher.
Diese Substruktionen stammen offenbar bereits aus dem 17.Jahrhundert und wurden in den Entwurf einbezogen, den Johann Bernhard Fischer von Erlach (1656 bis 1723) am Ende seiner Lebenszeit konzipierte. Ob der Vorbestand als Reithalle, Remise oder Pferdestall gedient hatte, ist unklar. Jedenfall waren die Fundamente im lehmigen Untergrund den erhöhten Pressungen durch den von Joeph Emanuel Fischer weitergeführten und erst 1735 vollendeten Kuppelbau nicht gewachsen.
Hofbaumeister Nicolaus Pacassi (1716 bis 1790) ließ daher schon Mitte des 18.Jahrhunderts Verstärkungspfeiler hochziehen, die vom Keller durch Erdgeschoß und Prunksaal führen und die Kuppel stützen. Heutigen Augen wird es schwerfallen, den gestalterisch integrierten Eingriff zu erkennen. Die Kuppel elbst wurde an der Basis mit einer Umgürtung versehen, wie die damals zur Vertärkung elbst am Petersdom erforderlich war. Eine Verbesserung des Zugangs zum Prunksaal erfolgte zu Beginn des 20.Jahrhundert durch den Einbau eines kleinen Vestibüls an der südöstlichen Stirnseite. Friedrich Ohmann zeichnet für den Entwurf verantwortlich. Zehntausende sind seither durch das kleine Kuppelrund zur barocken Prachtstiege geschritten, um den Prunksaal zu besuchen.
Der Bau des neuen Bücherpeichers im Burggarten und die verwaltungsrechtliche Umstrukturierung der Österreichischen Nationalbibliothek zur Teilrechtsfähigkeit schufen die Voraussetzungen für eine Neugestaltung des Erdgeschoßes. Das Konzept sah in den tonnenüberwölbten Räumlichkeiten ein multifunktionales Foyer vor, während in den drei Untergeschoßen die Sammlung von Inkunabeln, alten und wertvollen Drucken untergebracht werden sollte. Dieser Tiefspeicher weist eine Kapazität von 6700 Fachmetern auf, wie der Leiter die er Abteilung, Gerhard Wilhelm, ausführt. Davon sind 5300 Fachmeter für den heutigen Bestand, der 220.000 Bände beträgt, genutzt. Für weitere 50.000 Bände steht Reserveraum bereit. Die Sammlung umfaßt die Bestände seit Einführung des Buchdrucks im 15.Jahrhundert bis 1850, dem Ende der ausschließlichen Verwendung der Handpresse.
Die alten Gestelle wurden wiederverwendet, nur die hölzernen Fachbretter mußten durch solche aus Blech ersetzt werden, um die potentielle Brandlast zu reduzieren. Auf stählernen Gitterrosten aus den dreißiger Jahren bewegt sich der staunende Besucher in den mehrgeschoßigen Abteilungen des klimatisierten Tiefspeichers.
Man muß kein Büchernarr sein,um zwischen diesen Regalen und den zahllosen ledernen Buchrücken Ehrfurcht zu empfinden. Das konzentrierte Wissen und die kulturelle Leistung von Generationen finden hier ihr geordnetes Gedächtnis .Beruhigt nimmt man daher zur Kenntnis ,daß eine Brandchutzanlage existiert, die mit dem Löschgas Energen einen Brandherd im Keim ersticken würde. Ein Aufzugsschacht, der an der Südwestecke in die mächtigen Mauern geschrämt wurde, verbindet nun die drei unterirdischen mit fünf oberirdischen Geschoßen.
Erst diese Neuorganisation des Tiefspeichers befreite den Erdgeschoßraum von den Regalen, sodaß man nun als Normalbesucher darin herumspazieren kann. Der Architekt Alessandro Alverà erarbeitete den konzeptionellen Entwurf des neuen Foyers, während Architekt Sepp Müller und sein Mitarbeiter Stephan Seehof mit Planung und örtlicher Bauaufsicht betraut waren.
Der Eingang, bisher in einer Ecke des Josefsplatzes, liegt neu in der Mitte der Fassade, an logischer Stelle in dem von der Prunksaalkuppel gekrönten Risalit. Ein halbelliptischer Vorraum vermittelt zur zentralen Halle, deren Boden auf dem ursprünglichen Niveau, das etwa einen Meter unter jenem der heutigen Platzfläche liegt, belassen wurde.
Ein komplexes System von Stufen und rollstuhlgängigen Rampen erlaubt den Zugang zu den Seitenflügeln, ohne daß die architektonisch zentrierende Wirkung der Absenkung verlorengeht. Daß zu diesem Zweck die Pfeiler der Pacassischen Stützkonstruktion perforiert werden mußten, ist heute nicht mehr zu spüren, weil deren abschnürende Wirkung durch die seitlichen Passagen relativiert wurde, was den Raum insgesamt aufwertet.
Der nordwestliche Seitenflügel ist als Saal für festliche Anlässe, Konzerte und als Ausstellungsort eingerichtet. Als einziger Raumschmuck findet sich an der Stirnwand der blinde Kamin aus barocker Zeit, in dessen pylonartigem Aufsatz ein römischer Grabstein als Spolie eingeetzt ist. Von kräftiger Wirkung ist der Steinboden aus (rotem) Adneter Marmor mit eingesetzten Quadraten aus Untersberger Kalkstein. Das Muster entstammt dem darüberliegenden Prunksaal, nur wurden Hell und Dunkel vertauscht.
Der südwestliche Seitenflügel enthält eine kürzere Halle, in der die Portierloge und ein Shop die Zugangsachse zur Prachtstiege flankieren. Als vermittelnder Raum folgt Friedrich Ohmanns Vestibül. Das erneuerte Erdgechoß gewinnt nun eigenständige Qualität, und die räumliche Abfolge des Zugangs zum Prunksaal wird aufgewertet.
Im Gegensatz zu letzterem wird jedoch jede Prachtentfaltung vermieden; vielmehr ist die profane Gewölbekonstruktion glatt geputzt und geweißt, sodaß nach dem spröden Pathos des Verzichts die barocke Pracht ihre Wirkung entfalten kann. Da und dort finden sich kleine gestalterisch-intellektuelle Spitzfindigkeiten, die auf den räumlich-hi torischen Kontext Bezug nehmen. Sie zeugen von der intensiven Gedankenarbeit, die an das heute so einfach erscheinende, komplexe Bauwerk gewendet wurde.
Das Fertighaus ist ein architektonisches Stiefkind. Technische und Kostenvorgaben scheinen nur wenig gestalterischen Spielraum zu lassen. Gustav Peichls Entwurf verwirklicht indes eine Reihe klassisch moderner Postulate und genügt auchbaukulturellen Ansprüchen.
Ein oberflächlicher Blick in einen Fertighauskatalog könnte glauben machen, die Moderne sei in dieses nicht unbedeutende Segment des Eigenheimbaus noch nicht eingezogen. In der Bauorganisation, der Vorfertigung und der Abwicklung jedoch hätten sich die Protagonisten des Neuen Bauens keine rationalere Praxis vorstellen können.
In den Anpreisungen tönt es allerdings wieder anders. So scheint es in der Fertighauswelt beispielsweise den Begriff „Beton “nicht zu geben. Das Gemisch aus Zement, Zuschlagstoffen und Wasser wird in einem Fall, da nicht Kies und Sand, wie sonst üblich, sondern – der besseren Dämmwerte wegen –Blähtonkügelchen als Zuschlagstoff dienen, so beschrieben: „Aus völlig naturbelassenem Ton werden ohne chemische Zusätze beizumengen, kleine, keramische Tonkügelchen gebrannt. Unzählige dieser Tonkügelchen sowie zu Zement veredelter Kalkstein (!) werden unter Anwendung modernster Fertigungstechnologien zu massiven Wand- und Deckenelementen geformt. “Wenn man diese Werbetexte liest, möchte man glauben, es seien biozertifizierte Heinzelmännchen am Werken.
Der äußere Eindruck ist fast durchwegs bieder, manchmal sogar ungestalt und plump. Ein diffuses Gemisch aus überkommenen und modischen Stilelementen, die oft reichlich ungeschickt amalgamiert werden, herrscht vor. Was dabei herauskommt, ist dennoch nicht unbewohnbar. Wirklich architektonischen Pfiff haben aber die wenigsten dieser effizient und kostengünstig hingestellten Häuser.
Doch gibt es seit geraumer Zeit Bestrebungen, auch im Fertighaussektor höheren architektonischen Ansprüchen zu genügen. Hans Kollhoff, Roger Diener, O.M.Ungers und andere lieferten entsprechende Entwürfe. In Österreich wird ein Vorschlag von Matte Thun angeboten.
Nicht ohne widerstrebende Gedanken hat sich nun Gustav Peichl mit seinem Partner Rudolf F.Weber dazu entschlossen, einen Entwurf für ein Fertighaus zu entwickeln. Die Vorgaben der Fertighausfirma legten die Systematik und den Wandaufbau fest. Die Grundrißgestaltung und die architektonische Wirkung stammen von den Architekten. Einschränkungen ergaben sich bei den Elementgrößen wegen der Transportierbarkeit mit Lastwagen.
Eine gewisse Flexibilität im Grundriß, etwas länger der kürzer, je nach Familiengröße und Bauherrnwunsch, war Bedingung. Dennoch sollte das Haus Charakter haben. Diesem Anliegen kam Gustav Peichl, der einen klar erkennbaren Personalstil pflegt, mit seinem Entwurf entgegen.
Längsschnitt und Seitenansicht folgen einem flachen Kreissegment. Hauptwohnebene ist das Erdgeschoß; im Obergeschoß bleibt unter dem Bogenscheitel Raum für eine Wohnzimmergalerie, eine windgeschützte Dachterrasse sowie einen der Terrasse zugewendeten Dachraum.
Der Erdgeschoßgrundriß ist langgezogen und unterscheidet sich damit vom Gros der Fertighausgrundrisse, deren Räume sich in aller Regel aneinander drängen. Ein langer Gang an der vorzugsweise nach Norden orientierten Eingangsseite bildet eine Art Rückgrat, von dem die Räume erschlossen sind. Ein kubischer Anbau enthält den Windfang. Er bildet zusammen mit dem locker angekoppelten Zylinder, der das Bad enthält, die stark plastische Charakterisierung der Eingangsseite. Das lange Rechteck des Grundrisses ist in der Mitte geteilt. Die westliche Hälfte enthält das Wohnzimmer mit dem Aufgang zur Galerie, die Küche und die Nebenräume.
Die östliche Hälfte ist den privateren Räumen,den Kinderzimmern und dem Elternschlafzimmer, vorbehalten. Besonderheit und zusätzliche Erschließung zieht sich an der Südseite vom Wohnraum bis zum Elternschlafzimmer ein gangartiger, mit Lamellen beschatteter Glasvorbau, der mittels Schiebetüren entsprechend dendahinterliegenden Zimmern unterteilbar ist. Fenster und Lamellenwände lassen sich zum Teil beiseite schieben. Nach Westen wie nach Osten ist jeweils ein geschützter Außenwohnplatz vorgelagert.
An diesem Grundriß ist einiges bemerkenswert: Da ist vorab der langgezogene Zuschnitt, der innerhalb des Hauses Distanzen schafft. Dies ermöglicht den individuell gewählten Rückzug ins Private. Die doppelte Erschließung, eine gleichsam offizielle vom Gang her sowie eine eher familiäre durch die Schiebetüren im südorientierten Glasvorbau, bietet ebenfalls Wahlfreiheit.
Mit über zwölf Quadratmetern sind die Kinderzimmer gut bemessen, und die differenzierten Außenwohnbereiche bieten für jede Jahres- und Tageszeit und für jede individuelle Stimmung Raum. Das Haus weist einige Exklusivitäten auf: die Wohnzimmergalerie, die Dachterrasse und nicht zuletzt das runde Bad. Da nicht anzunehmen ist, daß die Häuser batterieweise situiert werden, sondern vermutlich einzeln inmitten anderer (Fertig-) Häuser stehen, bleiben diese Eigenheiten identitätsstiftende Bes0nderheiten.
Man könnte nun einwenden, daß es dem Haus an Radikalität mangle, kein Loft, keine offenen Grundrisse und so weiter. Dem ist entgegenzuhalten,daß sich der Entwurf erstens an eine breitere Käuferschicht wendet und daß er zweitens eine ganze Reihe klassisch moderner Postulate verwirklicht, die bei den sonst üblichen Fertighäusern nicht berücksichtigt sind. Es steckt einiges an Lebensweisheit und Familienerfahrung indiesem Grundriß –und an kulturellem Bewußtsein auch.
Natürlich mag es etwas erstaunen, daß die wärmegedämmte Holzständerkonstruktin an der Außenseite mit Heraklitplatten verkleidet und mit zwei Zentimetern mineralischem Verputz versehen wird; doch ist dies nicht nur eine Konzession an die Wünsche der Konsumenten nach einer äußeren Anmutung von Dauerhaftigkeit, es entspricht auch dem Personalstil von Gustav Peichl, der seine Bauten schon immergern weiß verputzt hat. Und besser als der längerfristig bauphysikalisch problematische „Vollwärmeschutz “mit dem millimeterdünnen, elektrostatisch wirkenden Kunststoffverputz, der den Staub anzieht, ist diese Fassade allemal.
Die Qualität dieses Entwurfs liegt in seinem modernen Selbstverständnis – kombiniert mit ein paar zeitgenössischen Elementen wie den Sonnenschutzlamellen, versteht sich. Gustav Peichls Fertighaus: ein Pr0jekt,zudem demnächst in der „Presse “noch mehr zu lesen sein wird.
Ob Loggia, Balkon oder Dachterrasse: eine private Aussenwohnfläche erhöht den Wohnwert beträchtlich. Gisela Podreka hat die Umgestaltung eines Althauskonglomerats in Wien-Hernals mit einem Dachgarten gekrönt, der ohne weiteres ein Wochenendendhaus ersetzt.
Die Bretterroste es Bodens erinnern ein wenig an ein Schiffsdeck, anstelle einer Reling ziehen sich jedoch Pflanzentröge um das Bord. Das Häusermeer der Wiener Außenbezirke umbrandet hier eine kleine Insel: den Pezzlpark hinter dem Jörgerbad in Wien-Hernals.
Diesem von Leben erfüllten Grünraum ist er Dachgarten zugewendet. Der Ausblick gleitet über Baumkronen, hakt sich kurz fest an kaminbezahnten Dachfirsten und verliert sich in er wolkigen Weite es Himmels. Sehr viel Himmel, wie wir das sonst in der Stadt kaum gewohnt sind, überspannt das Sonnendeck. Er vermittelt ein Gefühl von Freiheit, von Entrücktheit – dabei liegt der Alltag bloß zwei,drei Treppen tiefer in den Bürogeschoßen.
Doch handelt es sich hier nicht um ein simples flaches Dach. Die Attika ist gesäumt von bepflanzten Trögen, in denen Blauraute, Schafgarbe und Lavendel mit Königskerzen und Karden abwechseln. Zur zarten Metallpergola ranken sich Glizinien hoch; empfindlichere Gewächse wie Feigen und Rosmarin wurzeln in Töpfen und können in der kalten Jahreszeit eingestellt werden.
Der konzeptionelle Entwurf für diese reichhaltige Bepflanzung stammt von der Landschaftsarchitektin Anna Detzlhofer. Sie weist darauf hin, daß die trockenen Stauden auch im Winter, bereift oder beschneit, einen interessanten Anblick bieten, weshalb sie erst im Vorfrühling zu schneiden sind. Jetzt, im Sommer, mag man noch nicht daran denken, sondern freut sich über en privaten Charakter,den die Pflanzen der Terrasse verleihen und sie in einen Dachgarten verwandeln, wo man in angenehmer Entrücktheit von der Adria träumen kann. Ein Zuviel an Sommersonne halten verschiebbare Stoffbahnen ab, die auch gänzlich eingezogen werden können, da man die Altweibersommer- und Frühjahrssonne ja ganz gern direkt genießt.
Eine solche Dachterrasse mit Bepflanzung ersetzt locker das Wochenend haus. Man spart sich Straßenverkehr und Schlepperei. Dabei muß sie gar nicht besonders groß sein. Es reicht, wenn sie von der Lage her und gestalterisch eine Welt für sich schafft, damit das Gefühl, dem Alltag ein wenig entronnen zu sein, zur Gewißheit werden kann. Sowohl in der Gesamtenergiebilanz als auch ökonomisch wirkt sich das positiv aus.
Natürlich gab es schon früher Dachzinnen, Söller, Altane; doch sie waren nicht für einen längeren Aufenthalt gedacht, sondern dienten meist als Ausguck. Und die Dachterrassen, die Le Corbusier 1922 in seinen fünf Punkten forderte, sind für heutige Bedürfnisse zu karg. Es bedurfte einer Kooperation mit Gärtnern und Landschaftsarchitektinnen, um jenes spezifische Zusammenwirken von Natur und Bauwerk zu erzielen, das Zufriedenheit schafft.
Das Wohnen im Dachgarten als zeitgenössisches Phänomen paßt zur Renaissance des Urbanen. Es verweist auf eine Wende in einer Entwicklung, die durch Stadtflucht und desurbanistische Strömungen in Architektur und Städtebau geprägt worden war. Nun wir man nicht jeder Wohnung einen Dachgarten zuteilen können. Dennoch ist im Außen-Wohnbau vermehrt darauf Bedacht zu nehmen, daß jede Wohnung über eine qualifizierte, möglichst ungestörte Außenwohnfläche verfügt. Das kann eine Loggia, ein kleiner Hof, ein vernünftig situierter Balkon oder eben eine Dachterrasse sein. Damit werden Bedürfnisse gestillt, die sich sonst in zusätzlicher Zersiedelung durch Wochenendhäuser äußern.
Schon sind die Mauersegler abgereist. Vor lauter sommerlicher Dachgartenbegeisterung wäre fast verschütt gegangen, daß unter jeder Dachterrasse auch ein Haus steckt. In unserem Fall hat es sogar eine rekonstruierbare Geschichte. Zu Beginn war es ein Hofgebäude und der Bergsteiggasse zugeordnet. Dicke, mehrschalige Wände schützten einen großen Eisraum vor sommerlicher Wärme, darunter befand sich ein Bierlager, das von der Eisluft und dem Tauwasser gekühlt wurde. Daneben schloß ein Pferdestall an.
Das zweigeschoßige Gebäude wurde 1929 von Kurt Gessner mit zwei zusätzlichen Geschoßen versehen, reichlich befenstert und in seiner Orientierung zum mittlerweile Park gewordenen rückwärtigen Raum gewendet. Nun blickt es mit der Hauptfront nach Westen, die sich in einer flachen Pilasterordnung über zwei Geschoße und darüber in zwei Bandfenstern äußert, deren Teilung für die Moderne ungewohnt kleinmaßstäblich ist. Genutzt wurde das viergeschoßige Bauwerk nun als Putzerei und Büglerei.
Auf seinen Stadtwanderungen war es Friedrich Achleitner aufgefallen, der das mittlerweile leerstehende Gebäude in seinen Führer aufnahm. Wäre der Grund nicht so knapp und die Verwertbarkeit nicht fraglich gewesen, stünde heute ein neues Haus an seiner Stelle. Der Möglichkeitssinn der Architekten Gisela und Boris Podrecca bot die Chance einer Sanierung: Büronutzung in den unteren zweieinhalb Geschoßen, darüber Wohnen. Wichtig war deshalb ein zweiter Zugang, der mit dem erneuerten Aufzug die Wohnung erschließt, während die Treppe vor allem dem Büro dient, aber auch bis zur Dachterrasse reicht.
Gisela Podreka, die das Projekt mit ihrem Atelier betreute, vermied modischen Schnickschnack. Schadhafte Stellen und Bauteile wurden erneuert und die Grundfesten trockengelegt. Die teils wild gewachsene Konstruktion ist sichtbar und zeugt von der wechselhaften Baugeschichte. Der relativen architektonischen Qualität wurde mit Selbstverständlichkeit begegnet.
Dies ist auch er Grund, warum das Bauwerk einer Betrachtung wert ist, denn die Mehrzahl der Bauaufgaben wäre von den Entwerfern in dieser Art zu bearbeiten. Denn sie taugen nicht zum Manifest und schon gar nicht zur Manifestkopie, an der vor allem abzulesen ist, wo abgekupfert wurde. Dies würde zu einem Sammelsurium aufgesetzter Secondhand-Gestaltungen führen. Daher mein regelmäßiges Insistieren auf sorgfältig durchgeführten Selbstverständlichkeiten, die des Spektakels nicht bedürfen. Der Dachgarten ist dafür krönender Abschluß.
Kulturkampf in Klosterneuburg: Bauherren werden angeprangert, weil sich Häuser angeblich nicht in den Bestand einfügen – was nicht nur darum bedenklich ist, weil das Baurecht eine distanzlose Anpassung keineswegs vorsieht. Eine Nachschau.
Die „Stadtzeitung“ der Klosterneuburger Sozialdemokraten prangert in ihrer Juninummer einzelne Bauherren teils namentlich an, weil ihre Wohnhäuser sich angeblich wesentlich von den Einfamilienhäusern ihrer Umgebung unterscheiden. Weitere Beispiele in einer nächsten Nummer werden angekündigt. Abgesehen davon, daß hier das Recht auf Niederlassungsfreiheit durch eine bedenkliche Aufwiegelungstaktik zumindest tangiert wird, daß also demokratiepolitische Fragen zur Diskussion stünden, geht es um Aspekte der Ortsbildgestaltung und damit der Architektur.
„Passen diese Häuser wirklich ins Stadtbild?“ fragen die Autoren der Stadtpostille in der Überschrift, um im Schlußsatz hämisch anzumerken: „Es wäre interessant zu erfahren, wie die gutächterlichen Stellungnahmen des oftmals sehr strengen Stadtbildkonsulenten zu diesen ,Häuschen‘ lauten.“ Nun, der Begriff Stadtbild könnte dazu verleiten, den Ort des Geschehens im historischen Kern zu vermuten. Dem ist nicht so. Die angeprangerten Häuser befinden sich in Einfamilienhausquartieren im Weichbild oder gar an der Peripherie des Siedlungsgebiets. Der Begriff Ortsbild ist daher treffender, weil keine urbanen Verhältnisse vorherrschen. Die lockere Einzelhausbebauung läßt zudem die Topographie und die landschaftlichen Komponenten stärker ins Gewicht fallen.
Die Frage der Ortsbildgestaltung wird in der niederösterreichischen Baugesetzgebung im Paragraph 56 abgehandelt. Absatz eins besagt, daß Bauwerke, die einer Bewilligung bedürfen, sich in ihre Umgebung „harmonisch“ einfügen sollen. Falls ein Bebauungsplan einschränkende Regeln enthält, gelten diese, andernfalls ist das Bauwerk in Hinblick auf seine Einfügung zu prüfen. Dabei ist von der Struktur des umgebenden Baubestandes, der Charakteristik der Landschaft im Baugebiet und den charakteristischen gestalterischen Merkmalen des geplanten Bauwerks auszugehen.
Entscheidend scheint mir aber, was der Gesetzgeber unter dem Begriff Harmonie versteht: „Harmonie ist jene optische Wechselbeziehung, die sich – unabhängig von Baudetails, Stilelementen und Materialien – durch eine zeitgemäße Interpretation des ausgewogenen Verhältnisses sowie der gebauten Struktur sowie der dabei angewandten Gestaltungsprinzipien und dem geplanten Bauwerk ergibt.“
Lassen wir uns vom Amts- oder Juristendeutsch nicht irritieren. Die Intention des Gesetzgebers – und darauf kommt es an –zielt auf ein unschematisches Vorgehen: „Wechselbeziehung“; auf typologische und nicht auf stilistische Verwandtschaft: „unabhängig von Baudetails, Stilelementen und Materialien“; und sie blickt nach vorne: „zeitgemäße Interpretation“. Damit werden Bedingungen geschaffen, die der Architektur einen Weg aus stilkonservativer Befangenheit öffnet. Wenn wir uns nun an einen der inkriminierten Bauplätze begeben, treffen wir auf einen leicht nach Norden abfallenden Hang, an dem die Quartierstraße nahezu hangparallel, ansteigend verläuft. Der Straßeneinschnitt bedingt an der Südseite Stützmauern, an der Nordseite sind die Grundstücke eben betretbar, fallen aber mehr oder weniger stark ab. Die Topographie zwänge zu unterschiedlichem entwerferischem Verhalten für die beiden Straßenseiten. Als weiterer Aspekt stellt die Nordexposition des Hanges Probleme, die im Süden noch durch einen schattenwerfenden Waldsaum kompliziert werden.
Dies sind für einen halbwegs erfahrenen Architekten keine unüberwindlichen Hindernisse. Roland Rainer, ein klassischer Moderner, der nahezu das ganze Jahrhundert überblickt, Architekt des an diesem Nordhang errichteten Neubaus, hat diesen nahe an die Straße gerückt, um an der davon abgekehrten Seite dem privaten Gartenbereich genügend Sonne zu lassen. Zur Straße bietet das Privathaus wenig Einblick, dafür ist es zum Garten offen gehalten.
Die Gliederung der Bauvolumen reagiert auf den leichten Terrainanstieg in Ostwestrichtung; Landschaft und Topographie spielten bei der Kompositiontion eine wesentliche Rolle. Das begrünte Flachdach ist ökologisch sinnvoll für den Umgang mit dem Regenwasser und daher zeitgemäß. Der sichtbar gemauerte Recycling-Ziegel gehört in dieselbe Gedankenwelt. Das wesentlichste strukturelle Merkmal dieses Bauwerks lautet: Architektur. Kein Monument, aber das sorgsam durchdachte, gelände- und materialfühlig umgesetzte Konzept für ein Wohnhaus im ausgehenden Jahrhundert. In den Einfamilienhausquartieren Klosterneuburgs stehen gar nicht wenige ähnlicher Qualität und vergleichbaren Ausdrucks.
Die Häuser der näheren Umgebung reagieren weder besonders auf die topographische Lage noch auf die Nordhangexposition. Sie sind ortsüblicher Standard, meist von einem Baumeister adaptierte Schemagrundrisse, gestalterisch weder gut noch schlecht, von einer Familie durchaus glücklich bewohnbar. Vom Erscheinungsbild heterogen, sind die eher kompakten Volumen meist in die Grundstücksmitte gerückt. Der Garten erfährt damit keine Zonierung, wäre meist einsehbar und wird in der Regel durch hohe Grünhecken abgeschirmt.
Auch wenn sie zumeist nicht von Architekten entworfen wurden, folgen sie einer allgemeinen Typologie, die sich über die Jahre durch wechselseitiges Kopieren herausgebildet hat.
Ein derartiger Topos wirkt fast wie eine Norm, und obwohl jeder Bauherr ein individuelles Heim anstrebt, gleichen sich die Häuser. Diese Welt der baumeisterlichen Häuser unterscheidet sich von jener der Architektenhäuser vor allem durch eine Ungleichzeitigkeit der Kulturen: Im einen Fall geht ein kollektiver, eher ungeregelter, langsamer Prozeß vor sich, im anderen aber bettet ein gerichtetes Wollen die Gestaltung in die allgemeine Architekturentwicklung ein. Damit ergibt sich der Unterscheidungsgrund: das Anstreben von Architektur.
Klingt elitär? Es ist auch elitär, aber im Sinne von Qualität. Daher ist es bedenklich, wenn heutzutage Architektur im negativen Sinn als Argumentationskeule für Ausgrenzungsversuche mißbraucht wird, wo umgekehrt der Gesetzgeber mit seiner offenen Formulierung einer zeitgemäßen Architektur den Weg bereiten will.
Das Bundeskanzleramt, beziehungsweise dessen Kunstsektion, fördert über die „Häuser der Architektur“ in den Bundesländern die Vermittlung von zeitgenössischer Architektur, damit das öffentliche Verständnis mit der Architekturentwicklung einigermaßen Schritt halten kann. Zahlreiche Medien widmen sich ebenfalls regelmäßig dieser Aufgabe. Warum? Weil die neuere österreichische Architektur sich im internationalen Vergleich sehen lassen kann.
In dieser Situation architekturwilligen privaten Bauherren das Leben mit gleichmacherischen Parolen die Baufreude zu vermiesen ist kulturpolitische Sabotage an einer insgesamt positiven Entwicklung, die von öffentlicher und von privater Seite gemeinsam getragen wird – eben jener der Architektur in Österreich.
Die funktionale Verknüpfung der Wiener Vorortelinie mit der U3 in Ottakring hat das Umfeld der beiden Stationen aufgewertet. Diese Chance wurde von den Architekten Nehrer &Medek erkannt und vorausblickend umgesetzt.
Vor etwas mehr als einem Jahrzehnt waren die Straßengevierte entlang der stillgelegten Vorortelinie in der Gegend von Ottakring mehrheitlich zu Industriebrachen verkommen. Neben den Geleisen zog sich über Hunderte Meter eine hölzern eingezäunte Gstätten hin, auf der – zwischen verdorrten Gerippen hochgeschossener Pioniervegetation – aufgebrochene Kassen von Zeitungsverkaufstaschen herumlagen.
Die Gegend schien von allen guten Geistern verlassen, in der Thaliastraße sperrten die Geschäfte eins nach dem andern zu. Abgewohnte Zinshäuser der Gründerzeit förderten den Eindruck des Niedergangs genauso wie früh vergreiste Wohnanlagen aus den sechziger und siebziger Jahren. Ein drastisches Bild des Zerfalls, dem die Melancholie würdigen Alterns – die den Betrachter manchmal mit absehbaren Verlusten versöhnt – in jeder Beziehung abging.
Als jedoch gesichert war, daß die U3 bis Ottakring geführt würde, um dort mit Schnellbahn und Straßenbahn verknüpft zu werden, konnte ein in Stadtentwicklungsfragen erfahrener Fachmann wie Manfred Nehrer vorausahnen, welche Chancen für den Stadtorganismus und für den Stadtraum hier auf Verwirklichung drängten. Nun ist es eine alte Weisheit, daß Städtebau nicht bloß das mehr oder weniger ansprechende Verteilen von Gebäuden und das normengerechte Verlegen der Verkehrsbänder umfaßt. Vielmehr geht es um eine kluge Anordnung von Nutzungen ebenso wie um die Sicherstellung und Planung im Exkursionsprogramm urbaner Freiräume: der Gassen, Straßen, Höfe, Plätze und Parks, denn diese bilden die Voraussetzungen für eine Entwicklung urbanen Lebens.
Als Herzstück schlugen Nehrer &Medek daher einen Platz vor, der im Westen von den mit Geschäften und Gastronomiebetrieben angereicherten Bögen der Substruktion der Vorortelinie begrenzt wird. Im Norden verläuft tangential die Thaliastraße; dahinter eine erneuerte Blockrandbebauung, die mit den benachbarten gründerzeitlichen Häusern korrespondiert.
An der Ostseite befinden sich die Gebäude der ehemaligen Tabakregie. Heute enthalten die zur Thaliastraße vorgeschobenen Flügelbauten Geschäfte, Büros und Wohnungen, während das Hauptgebäude für die Höhere Technische Bundelehranstalt Wien XVI adaptiert und erweitert wurde. Der Zaun, der früher das Gelände der Aubstria Tabak umschloß, und sogar ein städtebaulich etwas verirrtes Gebäude aus jüngster Zeit wurden entfernt, sodaß der Platzraum über die auf ihre Wirkung als Verkehrsband reduzierte Paltaufgasse hinüberfließt und bis an die hohe Seitenfassade des nunmehrigen Schulgebäudes reicht.
An der Südseite erhebt sich, 22 Geschoße hoch, über linsenförmig ausbauchendem Grundriß ein neues Appartementhaus für das Personal des AKH, wofür Manfred Nehrer den hochhauserfahrenen Harry Seidler als Berater beizog. Ein kostenmäßig und funktionell extrem schlankes Konzept resultierte aus dieser Zusammenarbeit. Auf dem leicht ansteigenden Platz wirkt die aufragende, plastisch verformte Scheibe als Abschluß und als steigernder Gegensatz. Ihr Sockel enthält auf zwei Geschoßen gastronomische Einrichtungen sowie eine ausgedehnte Terrasse, die von Morgen und Abendsonne beschienen wird. Vor der harten Mittagssonne schützt der Hochhausschatten.
Wie bei allen Bauwerken ihres Büros haben Nehrer &Medek sich auch hier bemüht, Künstler mit ihren Werken direkt auf Raum und Bauwerk wirken zu lassen. Drei in Vitrinen gefaßte Plastiken von Manfred Wakolbinger gruppieren sich an und vor der Terrassenbrüstung. Etwas verschlossener gibt sich die Arbeit von Leo Zogmayer auf dem platzartigen Hof zur Thaliastraße vor dem ehemaligen Hauptgebäude der Austria Tabak: Mächtige, in der ansteigenden Platzfläche eingelassene Betonblöcke in Sitzhöhe bilden vielgliedrige Zwischenräume, die bei näherem Hinschauen als Buchstaben lesbar sind. Zusammen ergeben sie das Wort JETZT. Damit bezieht sich Zogmayer auf städtebauliche Prinzipien, in dem mit nutzbaren Volumen Zwischenräume gebildet werden, die einzeln und im Zusammenhang einen interpretierbaren Sinn ergeben. Stadträumlich betrachtet besteht das neue urbane Zentrum von Ottakring aus einem großen und einem kleinen Platz, die untereinander in Verbindung stehen. Diese städtebauliche Figur findet sich in zahlreichen urbanen Zentren nördlich und südlich der Alpen.
Als Besonderheit, die für eine gedeihliche Entwicklung des urbanen Charakters von nicht geringer Bedeutung ist, stellt sich die Hochlage der beiden Verkehrsträger Schnellbahn und U-Bahn dar: Die U-Bahn-Trasse trennt nicht, sondern beschirmt mit ihrem Brückenbauwerk den öffentlichen Raum – übrigens ein bestens geeigneter Ort für einen Markt mit Frischgemüse. Die vertikale Überlagerung der Verkehrsebenen wird von dem von Hermann Czech entworfenen „Haus, das im Obergeschoß die UBahn schluckt“, symbolhaft ausgedrückt.
Obwohl oder gerade weil Ottakring vom Zentrum relativ weit entfernt ist – im Westen beginnen die Ausläufer des Wienerwaldes –, konnte an dieser Stelle mit ihren optimalen Voraussetzungen die urbane Verdichtung gelingen. Hier war kein Kraftakt nötig, vielmehr galt es, die Dynamik der Entwicklung geschickt aufzunehmen und zu einer vernünftigen städtebaulichen Figur hinzuleiten. Das ist „Judo“, der sanfte Weg, im Städtebau; das weise Spiel der Körper und Nutzungen unter dem harten Licht ökonomischer und politischer Realitäten. Und es funktioniert sofort: Die Gastronomie und die Geschäfte erhalten Zulauf, der Stadtteil lebt auf, die Krisenstimmung der achtziger Jahre ist verabschiedet, da sind keine zusätzlichen Fördermaßnahmen erforderlich.
Städtebau bedingt Mitdenken und kluge Voraussicht. Kraftmeierei, Partikulärinteressen und Objektfixiertheit sind fehl am Platz. Es ist die vorausblickende komplexe Zusammenschau, jene wesentliche Fähigkeit eines guten Architekten, die durch kein elektronisches Hilfsmittel, keine Umfrage ersetzt werden kann, welche die Voraussetzung bildet für ein unmittelbar lebensfähiges Resultat. Eindimensionale, undifferenzierte Planungen benötigen dagegen Jahrzehnte, bis der urbane Organismus die vergessenen oder vernachlässigten Aspekte assimiliert hat.
Goethes Weimarer Gartenhaus gibt es jetzt doppelt: Der Urahn bürgerlicher Wohnkultur wurde Im Park an der Ilm originalgetreu nachgebaut. Aber warum nur einmal? Warum nicht in einer kostensenkenden größeren Serie als Fertighaus?
Gutbürgerliche Sparsamkeit legte schon immer Wert darauf, von einem guten Stück deren zwei zu haben. Und was bei Schuhen recht ist, erscheint bei Gartenhäusern billig. Das leuchtet jedem ein.
Doch gehen wir erst einmal zu den Wurzeln: Obwohl vor 223 Jahren von Herzog Carl August gesponsert, der das bereits damals bejahrte Weinberg- und Gartenhaus seinem 27jährigen Erzieher grundüberholt und mit einigen Möbeln eigener Wahl zur Verfügung stellte, gilt das als „Goethes Gartenhaus“in die Architekturgeschichte eingegangene Gebäude als Urahn bürgerlicher Wohnkultur.
An ihm orientierten sich die Sehnsüchte der Reformer von Architektur und Handwerk, die zu Beginn unseres Jahrhunderts im frühbürgerlichen Klassizismus das Vorbild für die künftig zu schaffende Architektur sehen wollten. Paul Mebes betonte dies mit seiner 1907 erschienenen Publikation „um 1800“ und ebenso Paul Schultze-Naumburg in seinen „Kulturarbeiten“, auch wenn die beiden Paule um das wirkliche Vorbild einen Bogen machten wie die Katze um den heißen Brei, setzten sie dafür umso mehr vergleichbare Beispiele ins Gefolge der als selbstverständlich bekannt vorausgesetzten Ikone des Bildungsbürgertums.
Aber worin liegt das Prototypische des Hauses, in dem Goethe zuerst allein und dann, nachdem der an der deutschen Provinz Verzweifelnde 1786 nach Italien ausgewichen war, einige Jahre mit seiner Geliebten, Christiane, wohnte? Dank der vorausschauenden Vorarbeit der Kollegen von der Zeitschrift „arch+“ sind wir seit Oktober 1982 (ein Goethejahr!) bestens dokumentiert: 11,90 Meter lang, 8,00 Meter breit, so die Außenmaße. Ein massiver Baukörper in leichter Hanglage, überragt von einem nahezu gleich hohen Zeltdach mit knappem Überstand. Drei Fensterachsen auf der Längsseite, deren zwei an der Schmalseite.
Die Grundrisse sind ohne viel Überraschung konzipiert. Im Erdgeschoß betritt man durch die rundbogige Haustür einen Flur, von dem die Treppe in eineinhalb geraden Läufen nach oben führt. Geradeaus geht es ins Speisezimmer, das zwei Fenster der Gartenseite beansprucht. Daran schließt linkerhand die Küche an, die vom Flur nur über einen Vorraum zugänglich ist. Die Kammer daneben in der Hausecke diente wohl dem Personal. Küche und Kammer sind massiv überwölbt, da sie offenbar Feuerstellen enthielten.
Im Obergeschoß erfolgt die Raumtrennung durch ausgefachte hölzerne Ständerwände; wieder ein Flur bei der Treppe oder eher eine Diele; daran reihen sich über Eck vier Zimmer: Empfangszimmer, Arbeitszimmer, Bibliothekszimmer, Schlafzimmer. Arbeits- und Schlafzimmer weisen keine Tür zur Diele auf, sind daher nur über das Empfangszimmer oder die Bibliothek zugänglich. Ein Bad suchen wir vergebens, den Abtritt finden wir unten im Vorraum neben der Kammer.
Der gedrungene Quader wird von einem großzügigen Dachraum überspannt, einem klassischen Kaltdach mit stehendem Stuhl. Der Kamin mußte leicht schräg verzogen werden, damit er am First mündete. Mehrere Schleppgaupen mit Fenstern, über deren Lage und Zahl die Dokumente widersprüchliche Angaben enthalten, sind in den Dachflächen verteilt.
Über niedrige Deckenbalken braucht man sich nicht zu ärgern: Eine großzügige Raumhöhe von 3,44 Meter im Erd- und immer noch stattliche 2,75 Meter im Obergeschoß weisen das Haus als Oberschichtbehausung aus. Die Nettowohnfläche ohne Flur und Treppe liegt knapp unter 130 Quadratmeter. Wenn man berücksichtigt, daß das Haus ohne Kinder bewohnt wurde, sind das üppige 65 Quadratmeter Wohnfläche pro Person. Das kann mit heutigen Ansprüchen durchaus mithalten.
Aber alle diese Nützlichkeiten können nicht der Grund sein, warum die Kargheit so anmutig wirkt, die sparsame Bescheidenheit spätere Generationen derart verzückte und noch heutige Besucher in Rührung versetzt. Daher zu den Feinheiten: Bei genauer Betrachtung fällt auf, daß die Mauern leicht geböscht sind, was das Bauwerk turmartiger, ja wehrhafter, aber gleichzeitig auch stärker mit dem Boden verhaftet wirken läßt. An der Gartenseite ist zudem das Fenster links oben, hinter dem das Schlafzimmer liegt, zugemauert und bloß aufgemalt.
Hier liegt sicher eine Schwäche, indem Dichtung und Wahrheit in Konflikt geraten. Die Ergänzung als blindes Trompel’œil ist weniger stark als eine leicht irritierte Symmetrie, wie jeder weiß, der sich mit bürgerlichem Klassizismus befaßt. Denn ein leichter Silberblick macht sympathisch. Jedenfalls sind die übrigen drei Fassaden freier und mit viel Maueranteil komponiert.
Doch zurück zur Gartenseite, die als Hauptwohnseite wohl die wichtigste ist: Hier sind die drei Erdgeschoßfenster etwas breiter und vor allem höher als jene im Obergeschoß. Der Maueranteil nimmt nach oben zu, das Gewicht verlagert sich nach oben. Außerdem sind die Obergeschoßfenster von oben her aus der Mauer ausgeschnitten und stoßen bis unter das Dachgesims.
Sie werden zwischen Mauermasse und Dach gleichsam eingeklemmt, was dem trennenden Strich der Traufe mehr Gewicht gibt und vor allem den bergenden Charakter des Dachs mit mehr Bedeutung hervorhebt.
Das Dach wird zu einem dem Mauersockel gleichwertigen Teil des Bauwerks, kein Wunder, daß die Flachdächer der Moderne so lange ohne Chance auf dem Markt blieben. Daß der dünne Raster der Spalierstangen als Gitter aus horizontalen Rechtecken vor die Fassaden gelegt ist, gibt dem Haus sein besonderes Flair und macht es erst richtig zum Gartenhaus im Sinne einer barocken Folie, die als Kulisse für die tägliche Selbstinszenierung dient.
Ein Leben in diesem Haus, in dem üppigen, halbverwilderten Garten, hinter den kräftigen, schutzbietenden Mauern und unter dem hohen schirmenden Dach muß für die nahen Kleinstädter, die in ihren dichtgedrängten schmalen Häusern mit den niedrigen Kammern hinter zugezogenen Gardinen wohnten, mit einer Aura von Freiheit umwoben gewesen seien. Wer in diesem Gartenhaus wohnte, unterlag nicht den gesellschaftlichen Zwängen der biederen Bürger, sondern genoß den arkadischen Freiraum, den man damals Hirten, Räubern und eben auch Gärtnern zuschrieb.
Diese gesellschaftlichen Projektionen machten „das Gärtnerhaus“ zur besonderen Bauaufgabe, die an Architekturschulen im Einführungsjahr beliebt war. Und so ist eben dieses Häuschen in Weimar mit seinem raunenden Bedeutungshintergund zu viel mehr als einer Dichterwohnstatt geworden.
Oftmalige Restaurierungen haben immer wieder zu leichten Veränderungen geführt, die heute anhand einer Dokumentation nachvollzogen werden können. Doch zusätzlich zum Original wurde nun gleichsam als haptische Sicherstellung in minutiöser Detailarbeit ein Gleiches errichtet. Die Kulturstadt Weimar verfügt daher über zwei Gartenhäuser, die beide besichtigt werden können und die den Bürgern bereits gleichermaßen ans Herz gewachsen sind.
Über die Gründe für diese Verdoppelung läßt sich nur orakeln: Soll die Abnutzung des Originals durch Besucher auf die Hälfte reduziert werden, oder ist die wundersame Verdoppelung eine verspätete Interpretation des kurzzeitigen Direktors der kubanischen Nationalbank, der vor bald vier Jahrzehnten dazu aufrief, zwei, drei, viele Gartenhäuser zu schaffen – wahrscheinlich als staatliche Geldbeschaffungsmaßnahme.
Für den kleinen Geldbeutel gibt’s das Haus immerhin als Ausschneidebogen; die blockhafte Konfiguration stellt kaum Anforderungen an Bastler, sie ist in wenigen Minuten aufgestellt. Doch kann eine derartige Miniaturisierung die Sehnsüchte befriedigen, die über zwei Jahrhunderte, und mehrmals befeuert, in kulturbürgerlich gebildeten Busen schmachteten? Scheute man sich wieder einmal, den Weg zum wirklichen Volksmodell zu beschreiten und das Häuschen als Wahlmodell einer gehobenen Fertighauspalette anzubieten? Die paar notwendigen Adaptierungen hätte das Bauwerk doch ausgehalten.
Da läßt man von Stararchitekten leicht verkrampft wirkende Fertighaustypen entwerfen, um auch in diesem Bereich„ das Volk“ an den neuesten Errungenschaften der Kultur teilhaben zu lassen; aber das Sehnsuchtsmotiv jeder neuklassizistischen Besinnung wird nicht neu aufgelegt, sondern, viel schlimmer, nur einmal exakt kopiert, um den Leuten vorzuspielen, worauf sie schon wieder verzichten müssen.
Die Kosten des handgeschnitzten Modells von 1,5 Millionen Mark (10,5 Millionen Schilling, 760.000 Euro) sollten sich bei entsprechenden Stückzahlen doch senken lassen, besonders wenn auf eine vorgängige Abnutzung von Stiegen und Türschwellen verzichtet werden kann. Ist es die Ehrfurcht vor der deutschen Klassik, die das Unternehmen auf halbem Weg haltmachen ließ und die bisher verhinderte, daß das Haus an der Blauen Lagune angeboten wird? Oder ist es einfach zu karg in seiner Anmutung, löst es zuwenig Kaufreize aus, weil es keinen Erker aufweist, keinen Wintergarten und keinen Turm? Wie konnte es Goethe bloß in dieser kläglichen Hütte ohne Geschirrspüler aushalten? Ach ja, er verfügte noch über Hauspersonal.
Wir werden also auf unserer Fertighausidee sitzenbleiben, niemand will mehr leben wie der große Dichter vor seiner Italienreise, denn nichts ist enttäuschender als peinlich genau eingelöste Sehnsüchte.
Ernst Hiesmayrs Clima Villenhotel in Wien Nußdorf, ein beispielhaftes Bauwerk der sechziger Jahre, wird dieser Tage umgebaut und in seinem architektonischen Ausdruck zerstört: was zwar Rechtens, aber trotzdem ein kultureller Fauxpas ist. Ein Einwurf.
An einer landschaftlich empfindlichen Stelle am Siedlungsrand unter den Weinbergen im Norden Wiens Ernst Hiesmayr vor drei Jahrzehnten einige flache Quader gestaffelt in die anspruchsvolle Topographie. Sie versammelten sich um einen ruhigen Gartenhof, in dessen Teich Enten ihre Küken großzogen.
Die klar zugeschnittenen Volumen wiesen eine äußere Schale aus Sichtbeton auf, die seitlichen Sichtschutzlamellen an den Balkonen bestanden aus Holz, alle übrigen Ausbauteile, ob Geländer, Kragrahmen, Bodenplatten oder Treppenstufen, waren aus einem einzigen Material, aus sorgfältig gegossenem Stahlbeton, gefertigt.
Schon nach wenigen Jahren hatte wilder Wein die blockartigen Baukörper überzogen, sodaß zwischen rauhem, felshaftem Untergrund und weichem Blätterpelz –noch in den sechziger Jahren – mit Absicht jenes gleichgewichtige Spannungsverhältnis von Menschenwerk und Natur aufkam, das ein Dutzend Jahre später von vielen eingefordert wurde.
Die Anlage diente als Villenhotel, hätte aber ökonomisch gewinnbringender auch als anspruchsvolle Wohnsiedlung genutzt werden können. Als beispielhafte Architektur einer touristischen Infrastruktur wie als feinfühlige Setzung in landschaftlich empfindlicher Lage fand es von fachlicher Seite Anerkennung. Die reduzierte Formensprache, ein spezifisch knapper Materialeinsatz, das Blockhafte der Mauern, die großflächig verglasten, zur Landschaft sich weitenden Innenräume und zum Verweilen einladende Gartenbereiche – all dies erinnerte irgendwie an Kargheit und Lebenskraft alpiner Landschaften, an die Selbstverständlichkeit des einfachen, auf jahrhundertealten Erfahrungen und Sparsamkeit beruhen-fügte den Bauens in vielen ländlich-gebirgigen Gegenden der Erde.
In den siebziger Jahren kam es dann zur pauschalen Verurteilung der zweiten Moderne an Hand der gravierenden Auswüchse des Bauwirtschaftsfunktionalismus, zur generellen Ablehnung sichtbaren Betons und in der Folge zur selbsternannten Postmoderne mit ihren billigen Rezepten, was zu wenigen interessanten und unzähligen mittelmäßigen und schlechten Bauten führte. Der Publikumsgeschmack driftete mangels gelebter kultureller Führung durch weltoffen-bürgerliche und intellektuelle Schichten zu Hundertwasser und Medienboulevard.
Eine Erneuerung der Architektur formulierte sich vorerst aus gesellschaftlichen Gegensätzen. Die Architektur der fünfziger und sechziger Jahre geriet in Vergessenheit – übrigens in einer Zeit, als die Fachöffentlichkeit sich pionierhaft und kämpferisch um die Erhaltung der Werke Otto Wagners verdient machte!
Irgendwann kam es seitens der Stadt Wien zu einer Aufzonung des Grundstücks, was einer Vergrößerung des potentiellen Bauvolumens an dieser Stelle gleichkam. Bei genauerer Begutachtung des empfindlichen Siedlungsrandes am Fuß des Nußbergs ruft dies heute leichtes Kopfschütteln hervor.
Nach einer Handänderung sieht der neue Eigentümer sich legitimiert, den möglichen höheren Ertrag auch zu realisieren. Marktwirtschaftlich und rechtlich ist das Urteil schon gesprochen. – Zu diesem Zeitpunkt rufen besorgte Bürger in der Regel nach dem Denkmalamt. Doch dafür ist es historisch gesprochen zu früh, denn auf ein wissenschaftlich nachweisbares „öffentliches Interesse“ hat sich die Zivilgesellschaft noch nicht geeinigt. Denn es mangelt in Mitteleuropa an einer Kultur des sorgenden Umgangs mit Werken der jeweiligen Vätergeneration. Erst die Enkel sind bereit, in den Arbeiten der Großväter Beispielhaftes zu erkennen.
Es ist heute ein leichtes, für die Bewahrung eines beliebigen Gründerzeithauses breite und emotional gestützte Zustimmung zu erhalten. Daß dabei die Qualitätsfrage außer acht gelassen wird, stört nur wenige. Es reichen hundert Jahre Baualter, um die Gemüter zu rühren. Das Denkmalamt seinerseits verfügt für diese Zeitabschnitte über gesicherte wissenschaftliche Beurteilungskriterien. Alterswert und architektonischer Wert lassen sich diskutieren und bestimmen.
Daß in spezifischen Ausnahmefällen wie beim Museumsquartier die Gehsteigzeitungen von ihren Einflußmöglichkeiten demagogisch Gebrauch machen, wissen wir. Sie tun es aber nicht in hundert anderen Fällen, weil diese für ihre täglichen Zwecke uninteressant sind. Dagegen ist die knapp eine Generation zurückliegende Zeit gleichsam eine Terra incognita. Vieles ist vergessen, und das Feld wird beherrscht von subjektiven Erinnerungen, die jeweils individuell als richtig verteidigt werden, für die aber noch kein (Architektur-)Historiker das objektivierende Bezugsfeld erarbeitet hat.
Die nachfolgende Generation ist mit ihrer eigenen Entwicklung befaßt, wird sich daher kaum um eine Würdigung der Bauten ihrer direkten Vorgänger kümmern, umso mehr, als deren Exponenten gar nicht selten ihren Einfluß auf das Tagesgeschehen noch geltend machen können: Wir haben es hier auf dem Feld der Architektur mit einem Phänomen, vergleichbar dem der späten Hofübergabe, zu tun – mit allen Begleiterscheinungen.
Doch vielleicht braucht es dieses glättende Vergessen, bevor wieder Werte gesetzt werden können. Es wäre daher im individuell konkreten Fall Sache der Zivilgesellschaft, Aufgabe ihrer mündigen Bürger, ihre Rolle eigenverantwortlich im Wechselspiel zivilisatorischer Entwicklung wahrzunehmen. Eine gesetzliche Verpflichtung gibt es nicht, nur eine kulturelle. Fachleute stehen zur Verfügung, man muß die entsprechenden Forscherpioniere nur beiziehen.
Die Verantwortung liegt daher in der Phase unklarer offizieller Bewertung bei den Besitzern und Eigentümern, auch bei den Käufern und Verkäufern. Ein Marktgeschehen, gespickt mit Zufällen, befindet darüber, ob ein Bauwerk den unsicheren Lebensabschnitt im Alter zwischen drei und acht Jahrzehnten auch bezüglich seines architektonischen Charakters unbeschadet übersteht.
Dabei können wir uns heute nicht mehr auf Weltkriege und gebrochene Biographien der Exponenten ausreden. Es hängt schlicht davon ab, ob die mit einer Liegenschaft befaßten Leute: Eigentümer, Architekten, Beamte, über das entsprechende Kulturverhalten verfügen, ob sie „Kultur haben“, wie man im Alltag sagt. Ob also dieser Markt unter einigermaßen kultivierten Bedingungen abläuft.
Dann läßt sich nach bestem Wissen und Gewissen bewahren und/oder weiterbauen und/oder erneuern. Und dann wird das Urteil der Geschichte auch ein positives oder zumindest ein mildes sein.
Zum Tod des Architekturpublizisten Walter Zschokke
Er hat die Architekturpublizistik Österreichs in den vergangenen Jahrzehnten entscheidend mitgeprägt. Seit 1988 schrieb der gebürtige Schweizer, Jahrgang 1948, Hunderte einschlägige Essays im „Spectrum“ – präzise, leidenschaftliche Reflexionen am Puls der regionalen und internationalen Entwicklung. Zschokkes Engagement für gestalterische Qualität in allen Maßstäben produzierte sich nie in lauter Polemik oder in brillant gedrechselten, ästhetischen Urteilen. Unbeirrt von Zeitmoden, kultivierte er die sachbezogene, vielschichtig ausgelotete Beschreibung des Faktischen als Grundlage jeder Diagnose, jeder kritischen Äußerung, jeder negativen oder positiven Wertung. Dazu befähigten ihn ein exzellentes technisch-konstruktives Wissen und Gespür, die breite Erfahrung auch als praktizierender Architekt, die kulturwissenschaftliche Schulung an der besten technischen Hochschule Europas und nicht zuletzt sein handwerkliches Know-how, speziell im Umgang mit Holz.
Aufgewachsen im Kanton Aargau, kam Zschokke nach dem Studium an der ETH Zürich, nach acht Jahren Assistenz bei Adolf Max Vogt und mit einem von André Corboz und Jacques Gubler approbierten technischen Doktorat 1985 nach Wien; hier führte er ab 1989 mit Walter Hans Michl ein Atelier, war Mitautor eines Wohn- und Bürohauses in Wien-Neubau, des Kirchenzentrums im Stadtteil Wien-Leberberg und großer städtebaulicher Wettbewerbe; 1992 gestaltete er mit Margherita Spiluttini die Fotoschau „Neue Häuser“, welche die damals junge Szene Österreichs auf vielen Stationen bis nach New York und Mexiko präsentierte; anlässlich des EU-Präsidentschaft Österreichs 1998 war er Mitautor und -gestalter der multimedialen Wanderausstellung „Architekturszene Österreich“.
Neben der Arbeit für das „Spectrum“ redigierte Zschokke etliche Architektenmonografien, war Mitbegründer von „Orte – Architekturnetzwerk Niederösterreich“, gefragter Juror und Gutachter, Vortragender. All dies wurde offiziell mit Preisen für Architektur und Publizistik von den Ländern Wien und Niederösterreich gewürdigt; zuletzt wirkte er als Juror/Mediator beim Um- und Zubau der Wiener Arbeiterkammer.
Sein bestes Buch ist die in der Schweiz verlegte Dokumentation über die hochalpine „Sustenpassstraße“, ein Standardwerk internationalen Formats an der Schnittstelle von Verkehrs- und Landschaftsplanung, von Ingenieurwesen und Architektur, von Wissenschaft und Ästhetik. Sein letzter Auftritt in der Öffentlichkeit war in Wien die Vorstellung des mit Walter Bohatsch betreuten nachgelassenen Buches „Geschautes“ von Ernst Hiesmayr.
Walter Zschokke konnte wie kein anderer konstruktive Stärken und Schwächen von Tragstrukturen auf Anhieb analysieren oder gebaute Raumereignisse in nachvollziehbare Beschreibungen gießen, vermochte aber auch aus der Betrachtung einer windschiefen Vorgartenmauer oder einer hölzernen Trinkschale ein ganzes Panorama alltagskultureller Kausalitäten und Schönheiten zu erzählen. Am 5. Februar war sein jahrelanger Kampf gegen den Krebs zu Ende, er starb im AKH, umsorgt von seiner Frau und den beiden erwachsenen Kindern. Er fehlt uns.

2008
Die Architektur von Dietrich|Untertrifaller hat eine starke Beziehung zum Ort und seinem Umfeld. Sie ist individuell aus der Situation und dem Programm entwickelt. Dies garantiert differenzierte Lösungen, Individualität und Unverwechselbarkeit. Bestehendes und Neues ergänzen einander und führen zu einem
Hrsg: Walter Zschokke
Verlag: SpringerWienNewYork

2007
Seit Jahrzehnten gleichen sich die Bürogebäude: Rasterfassade mit viel Glas, rechteckige Grundrisse. Gegen diese Klischees setzt der Neubau für die niederösterreichische Wirtschaftskammer, des Architekturbüros Rüdiger Lainer + Partner, einen überzeugenden Kontrapunkt. Das mächtige Bauwerk ist als Großform
Autor: Walter Zschokke
Verlag: SpringerWienNewYork

2006
Sowohl die Bedeutung des Holzes als Roh-, Bau- und Werkstoff als auch die Vielfältigkeit und Nutzungsmöglichkeiten der verschiedenen Holzarten werden oftmals unterschätzt. Denn jede Holzart besitzt ihre spezifischen Eigenschaften, die sich je nach Anwendungsbereich vorteilhaft einsetzen lassen. Zugleich
Hrsg: proHolz Austria
Autor: Walter Zschokke, Josef Fellner, Alfred Teischinger
Verlag: proHolz Austria

2006
Architektur hat in Niederösterreich, dem großen Bundesland rund um Wien, im Zuge der Hauptstadtplanung in St. Pölten erhöhte Aufmerksamkeit gewonnen. Seither sind im ganzen Land Bauwerke entstanden, deren Qualität Betrachtung und Auseinandersetzung lohnen. Ältere und jüngere Architekten wie Ernst Beneder,
Hrsg: Walter Zschokke, Marcus Nitschke
Verlag: SpringerWienNewYork

2003
Die präzise und materialreiche Darstellung einer wichtigen Epoche - mit überraschenden Einsichten und Anregungen für das heutige Architekturschaffen.
Hrsg: Walter Zschokke, Michael Hanak
Verlag: Birkhäuser Verlag
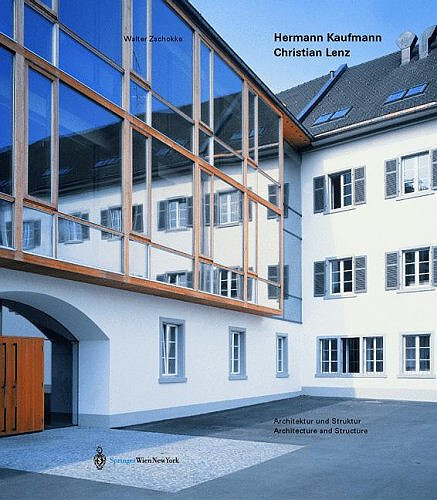
2002
In der Vorarlberger Architekturlandschaft verfolgen Hermann Kaufmann und Christian Lenz mit eigenständig und gemeinsam bearbeiteten Bauwerken eine Linie, die auf sorgfältiger Konstruktion beruht und sich an klare Geometrien und exakte Proportionen hält. Dem Baumaterial Holz und industriell erzeugten
Autor: Walter Zschokke
Verlag: SpringerWienNewYork
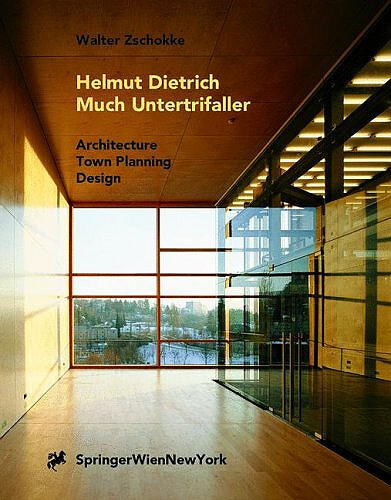
2001
Im scheinbar homogenen Architekturschaffen Vorarlbergs, das im vergangenen Jahrzehnt international bekannt wurde, treten die Bauwerke von Helmut Dietrich und Much Untertrifaller aus verschiedenen Gründen hervor: sie sind feinfühlig architektonisch und großstädtisch, sie bevorzugen keines der primären
Autor: Walter Zschokke
Verlag: SpringerWienNewYork

1999
Die erste Monographie über den österreichischen Architekten Rüdiger Lainer, der in seinen Bauten systemische Ökonomie und individuelle Lebendigkeit in Einklang bringt.
Hrsg: Walter Zschokke
Verlag: Birkhäuser Verlag

1997
Das Bundesland Niederösterreich, ehemals das Umland von Wien, hat im 20. Jahrhundert eine schrittweise Emanzipation vollzogen, was zuletzt in der Wahl St. Pöltens zur eigenen Hauptstadt (anstelle von Wien) und in der Folge im Bau eines entsprechenden Regierungsviertels kulminierte.
Die ländlich industriell
Hrsg: ORTE Architekturnetzwerk Niederösterreich
Autor: Walter Zschokke, Otto Kapfinger
Verlag: Birkhäuser Verlag

1997
Im September 1946 ist die Sustenpassstrasse, die in einschlägigen Kreisen damals schon als «Musterstück schweizerischer Strassenbaukunst» galt, nach achtjähriger Bauzeit offiziell eröffnet worden. Der Architekt Walter Zschokke zeigt, wie die Linienführung einer Strasse in die Landschaft integriert werden
Autor: Walter Zschokke
Verlag: gta Verlag

1996
Boris Podrecca, dessen umfangreiches Schaffen sich inhaltlich im Bereich der Pole Wien und Triest bewegt, liegt mit seinen auf organische Prozesse bezogenen und Lebensvorgänge interpretierenden Entwürfen weder im Trend einer zur Manier verkommenen «Neuen Einfachheit», noch folgen sie dem zum Dekorstil
Autor: Walter Zschokke
Verlag: Birkhäuser Verlag
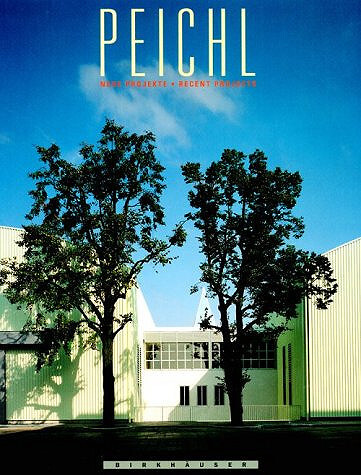
1996
Gustav Peichl gehört zu jenen international anerkannten österreichischen Architekten, «die das österreichische Selbstverständnis mitstilisiert haben» (Friedrich Achleitner). Unter seinen Arbeiten sind vor allem die Rundfunkstudios des ORF sowie die Bundeskunsthalle in Bonn international bekannt geworden.
Autor: Walter Zschokke, Gustav Peichl
Verlag: Birkhäuser Verlag