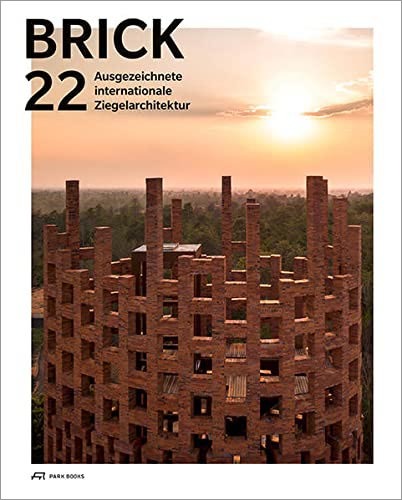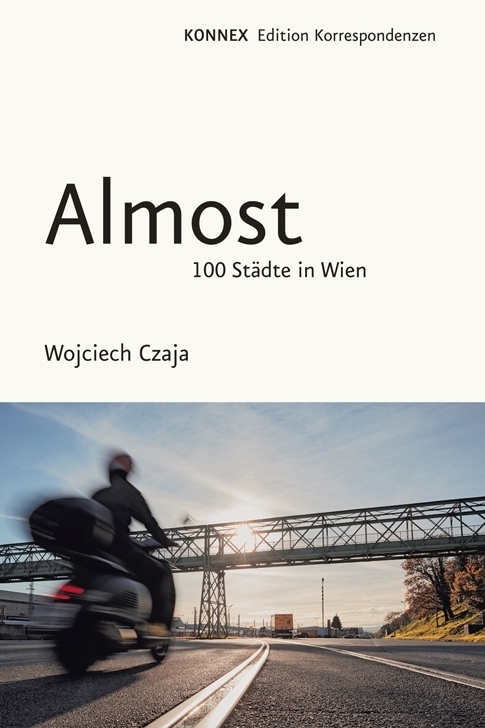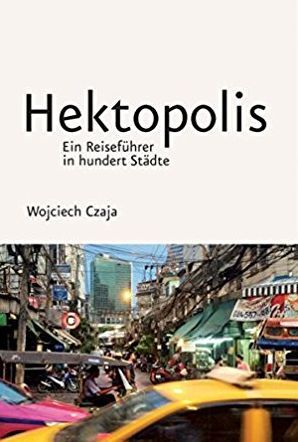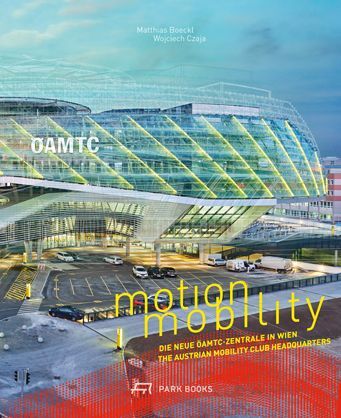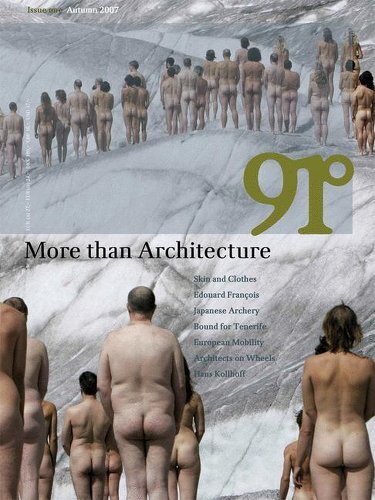Tränen, Schreie und Applaus Sieben ausgezeichnete Häuser
Der Umbau war teuer, langwierig und voller Überraschungen. Doch die beiden Auftraggeber ließen sich nicht unterkriegen und boxten das Ding mit den Architekten erfolgreich durch. Nun wurde das Salzburger Hotel zum Hirschen mit dem Österreichischen Bauherr:innenpreis 2025 ausgezeichnet.
Katharina und Nikolaus, seit letzter Woche haben sie leicht lachen, die beiden. Aber das war nicht immer so. „Das war ein tolles Projekt, mit super Architekten, die uns an der Hand genommen haben, ein paar wunderbaren Baufirmen, und überhaupt erst die Tischler! Traumhaft! Aber wenn das Bauen in die schlimmste Zeit überhaupt hineinfällt, mitten in die Energiekrise, in die steigenden Zinsen, in die explodierenden Baukosten hinein, mit all den Materialengpässen und einer Ever Given, die im Suezkanal stecken bleibt und alles blockiert, und die Anbote werden immer teurer und teurer, und dann wolltest du eigentlich nur umbauen, aber dann halten die Decken nicht das, was sie sollten, und dann findest du statt Stahlträgern plötzlich alte Straßenbahnschienen, die nach dem Zweiten Weltkrieg da oben eingebaut wurden, und dann schüttelt der Statiker den Kopf, und dann musst du die Decken rausreißen, und dann stehst du im Erdgeschoß und siehst oben im vierten Stock den Himmel … Dann kannst du nicht mehr, dann gibt es Tränen und Schreie, der blanke Horror.“
Aber sie haben durchgehalten, Katharina Richter-Wallmann, 34 Jahre jung, und ihr Mann Nikolaus, ein Jahr weniger jung, sie ausgebildete Hotelfachfrau und Marketing-Expertin, er Betriebswirt mit einem Schwerpunkt auf Immobilienentwicklung. Kennengelernt haben sich die beiden vor fünf Jahren an der Donau-Universität Krems, in einem Lehrgang für Immobilienmanagement, denn wenn ihr die Eltern schon das Hotel in der Elisabeth-Vorstadt übergeben, nur wenige Schritte vom Salzburger Hauptbahnhof entfernt, wenn sie sich schon entschieden hat, das wilde Berlin zu verlassen und das Haus zu übernehmen und aufzupäppeln, dann muss sie sich zumindest einschlägiges Fachwissen aneignen, dachte sie sich. Und ja, es hat sich ausgezahlt: Letzte Woche wurden die beiden mit dem Österreichischen Bauherr:innenpreis 2025 ausgezeichnet.
Potenziale nutzen
„Das Stammhaus in der Elisabethstraße ist an die 150 Jahre alt, der Zubau in der Saint-Julien-Straße stammt aus den Fünfzigerjahren, ich bin hier aufgewachsen, kenne den Betrieb in- und auswendig, und es ist ein Geschenk, in solche Fußstapfen hineinzutreten“, sagt Katharina. „Aber es gab einen ziemlich großen Investitionsstau, und nachdem ich von klein auf gelernt habe, dass mit all dem Glück und der vielen harten Arbeit große Verantwortung einhergeht, haben Nikolaus und ich beschlossen, das Hotel zu sanieren und zu erweitern und die Potenziale zu nutzen – und auf Wunsch der Stadt einen Wohnbau mit 40 Miet- und Eigentumswohnungen zu errichten.“
Und das alles in Holz. Bei einer Veranstaltung haben Katharina und Nikolaus den Salzburger Architekten und Holzspezialisten Tom Lechner (LP Architektur) kennengelernt, dieser wiederum holte sich, um das große Projekt überhaupt stemmen zu können, Dietrich Untertrifaller Architekten mit an Bord. Studio Eliste machte die Interior-Planung, Karin Standler die Gartengestaltung, das Grazer Studio Bruch das neue Grafikkonzept. Am konstruktiven Holzbau, das war von Anfang an klar, obwohl die Preise damals gerade durch die Decke gingen, gab es kein Rütteln. „Es gibt eben mehr als nur eine ökonomische Nachhaltigkeit“, so die beiden.
Das Endergebnis, seit genau zwei Jahren in Betrieb, ist ein schönes, gemütliches, hochwertig gestaltetes Haus mit 106 Zimmern und vier Sternen, eine Collage aus Putz und Holz, aus Omama und Gegenwart, aus Träumerei und Realismus. Wahrscheinlich kein Bau, mit dem man den nächsten Pritzker-Preis gewinnen wird, aber ein angemessenes, hoch engagiertes und konsequent umgesetztes Best-Practice-Beispiel. „Vielleicht waren wir damals ein bissl naiv, uns so ein großes Projekt aufzuhalsen“, blicken die beiden heute zurück, „aber jedenfalls wussten wir, was wir wollen, aber auch, dass wir nicht die Kompetenz haben, um diese Wünsche in ein Gebäude zu übersetzen. Wir wussten, welche Rolle wir einzunehmen und wie wir den Auftrag zu delegieren haben, und offensichtlich haben wir diese Rolle gut wahrgenommen.“
Der Österreichische Bauherr:innenpreis wurde 1967 ins Leben gerufen, mit dem Ziel, nicht nur die Planenden und Gestaltenden zu würdigen, sondern auch jenen Bauherren und Auftraggeberinnen eine Bühne zu geben, die Architektur überhaupt erst ermöglichen und finanzieren. „Architektur und Baukultur beginnt nicht mit einem Entwurf und einem Wettbewerb, sondern mit der Wertehaltung und Entscheidung eines Bauherrn“, sagt Veronika Müller, Präsidentin der Zentralvereinigung der Architekt:innen Österreichs (ZV), die den Preis heuer zum 48. Mal ausgelobt und vergeben hat. „Diese besondere, mit hoher Qualität verbundene Haltung und Positionierung des Etwas-besser-machen-Wollens wollen wir vor den Vorhang holen.“
Das konkrete Besser beim Hotel zum Hirschen, sagt Müller, sei die Summe von vielen Elementen, die sich zu einer schönen Geschichte gefügt hätten – zu einer Geschichte von Glück und Zufall, von Mut und Vertrauen, von Weiterbildung und nachhaltigen Entscheidungen. „Aber es gibt auch viele andere Geschichten“, so Müller. „Sie reichen von bauenden Privatmenschen über gewerbliche Bauträger bis hin zu Institutionen und öffentlichen Körperschaften, die sich allesamt ernsthaft Gedanken darüber gemacht haben, wie sie mit ihrem Projekt zu einer Nachhaltigkeit, Gemeinschaftlichkeit und Verteilungsgerechtigkeit beitragen können. Und daher geht der Preis heuer an insgesamt sieben Bauherren und Bauherrinnen, denen wir von Herzen gratulieren.“
Neben dem Hotel zum Hirschen in Salzburg geht der Österreichische Bauherr:innenpreis 2025 außerdem an folgende sechs Projekte: Loft-Flügel in Wien, Wiener Städtische Versicherung AG (Studio Vlay Streeruwitz); Zubau Firmenzentrale Windkraft Simonsfeld, Windkraft Simonsfeld AG (Juri Troy Architects); Domcenter Linz, Bischof-Rudigier-Stiftung zur Erhaltung des Mariä-Empfängnis-Domes (Peter Haimerl Architektur und Studio Clemens Bauder); HOS House of Schools an der JKU Linz, BIG Bundesimmobiliengesellschaft, Unternehmensbereich Universitäten (Querkraft Architekten); Waldarena in Velden, ATUS Velden (Hohengasser Wirnsberger Architekten); Museum Bezau, Museumsverein Bezau (Innauer Matt Architekten).