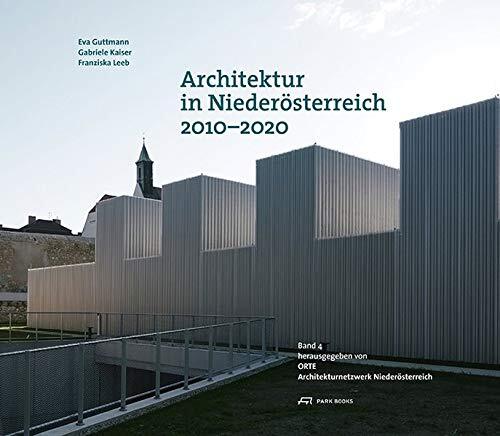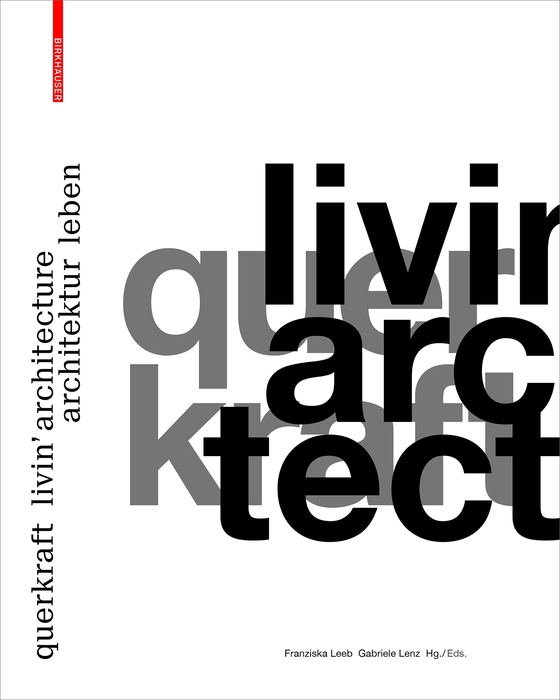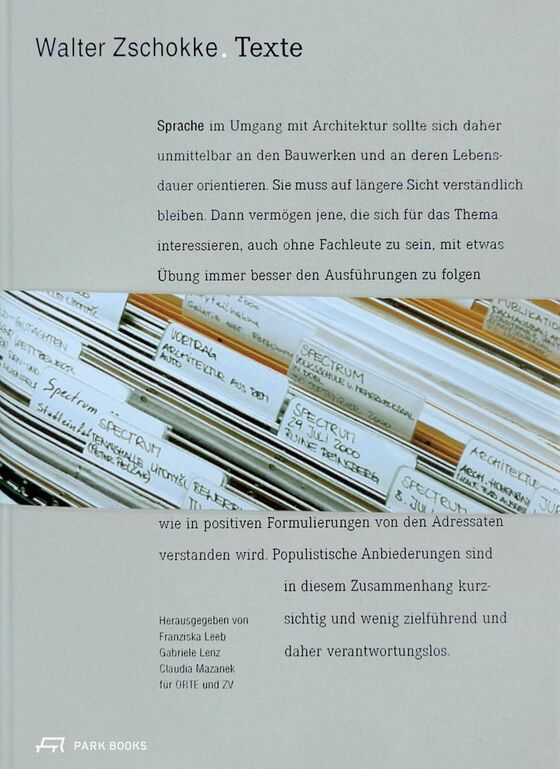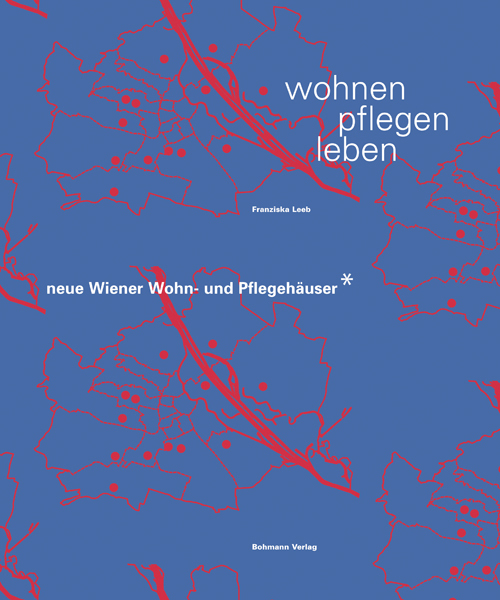Eine Volksschule im Burgenland: Am Abend kommen die Damen zum Turnen
Im Südburgenland befindet sich der Bildungsbau auf einem hohen Niveau: Die Volksschulen von Güssing und Oberwart setzen neue Standards in der Region.
In der Schulstraße in Güssing und der Schulgasse in Oberwart entstanden seit der Nachkriegszeit große, auch architektonisch bedeutende Schulbauten. In Oberwart zum Beispiel die „Zentralschule“ der Architekten Charlotte und Karl Pfeiler aus Innsbruck und Rudolf Schober aus Oberwart, eine der modernsten Schulen aus der Zeit um 1960. In Güssing Anfang der 1970er-Jahre das Schulzentrum von Wilhelm Hubatsch.
In beiden Städten platzten die Volksschulen aus allen Nähten und erhielten nun Neubauten, um zeitgemäßem Lehren und Lernen ganztägig Raum zu geben. Beide Male wurden die Volksschulen mit einer Musikschule gekoppelt, in Güssing kam noch die Sonderschule dazu. In beiden Fällen hatten die Gemeinden ambitionierte Ziele. Beide Gebäude gingen aus von den Gemeinden ausgelobten Wettbewerben hervor, beide wurden von der PEB, der „Projektentwicklung Burgenland“, einer Tochtergesellschaft der Landesimmobilien Burgenland, umgesetzt.
„Schule der Zukunft“ lautete das Motto in Güssing. Schon seit vorigem Schuljahr ist der nach Plänen von Pichler & Traupmann Architekten errichtete neue Schulcampus in Betrieb. Johann Traupmann besuchte das nebenan gelegene Gymnasium. Ob es deswegen so gut gelang, auf dem schmalen Bauplatz „Spannung im Raum“ (wie die 2022 erschienene Büromonografie übertitelt ist) zu erzeugen? „Wir hatten zu kämpfen, wie auf diesem engen Raum ein kommunikativer Schulbetrieb unterzubringen ist“, gesteht Johann Traupmann. Der Kampf hat sich gelohnt. Dem dreigeschoßigen Gebäude gelingt es, Außen- und Innenraum über alle Ebenen zu verweben und Großzügigkeit in der Enge zu erzeugen.
Der gepflasterte Vorplatz geht in ein überdachtes Freifoyer über. Es bietet viel Platz zum witterungsgeschützten Ankommen und Versammeln und bildet einen Schwellenraum zum Parkplatz und zur Straße. Übergangsräume zwischen Innen und Außen sind auch die über die ganze Gebäudelänge laufenden Südterrassen, im obersten Stock ergänzt durch große Terrassen an den Stirnseiten, wo auch Freiluft-Unterricht stattfindet. Sie verbinden alle Klassen horizontal, Freitreppen dienen als vertikale Außenverbinder.
Ein Highlight ist die Begrünung. Vom baumbestandenen Parkplatz über den Schulhof bis zum Dach sind mit Gräsern, Stauden und Essbarem bepflanzte Brüstungen, Tröge und Beetflächen sowie Fassadenberankungen integrativer Teil der Gestaltung. „Ich genieße es, hier zu arbeiten“, sagt Schulleiterstellvertreterin Astrid Wurglics, die uns durch das Gebäude begleitet.
Auch innen gelang ein geschmeidiges Zusammenspiel der Raumfolgen und Schulformen. Die zweigeschoßige Aula ist der Innenverbinder und der „Showroom“ der Schule. An sie knüpft alles an. Die Sonderschule im Erdgeschoß, die Musikschule in den beiden Obergeschoßen im Gebäudekopf und im Anschluss die Volksschule. Alles hängt kompakt zusammen, funktioniert aber ebenso autonom. Die große Sitztreppe kann Zuschauertribüne sein und ebenso Bühne für Konzerte der Musikschule. An die Aula knüpft alles an.
Wie in Güssing können auch in Oberwart die Schulkinder während der Nachmittagsbetreuung auf kürzestem Wege in die Musikschule wechseln. Am offenen Wettbewerb beteiligten sich über 60 Architekturbüros. Eine „Vielfalt an Lernwegen“ und „neue Unterrichtskulturen“ sollte der Neubau ermöglichen. Das tut er, laut Schulleiterin Roswitha Imre: „Aufteilung, Großzügigkeit und Alltagstauglichkeit haben mir von Anfang an sehr gefallen.“ Die Wettbewerbssieger Franz & Sue Architekten sind voll des Lobes für die Bauherren-Kompetenz der Gemeindeführung. Eine gemeinsame Exkursion zu vorbildlichen Schulbauten half beim Kennenlernen und beim Finden einer gemeinsamen Sprache. Die PEB kam erst nach rechtsgültig erteiltem Baubescheid dazu und schloss mit der Gemeinde einen Baurechtsvertrag. Der endet nach 25 Jahren. Dann geht das Gebäude ins Eigentum der Gemeinde als Liegenschaftsbesitzer über. Die PEB hat die ursprünglich vorgesehene Holzfassade eingespart und auch bei der Freiraumgestaltung (Simma Zimmermann) galt es Abstriche hinzunehmen. Für Architekt Michael Anhammer war es „das Wichtigste, dass wir innen alle Qualitäten wie geplant umsetzen konnten.“ Mit etwas zusätzlichem Planungsaufwand ist nun auch die sandfarbene Putzfassade mit der Besenstrichstruktur ganz ansehnlich geworden. Auffallend sind die unterschiedlichen Fensterformate, die aus den Funktionalitäten des Inneren entwickelt wurden. Jeder Klassenraum hat ein Fenster, das bis zum Boden geht, um stets den Blickkontakt zum Umfeld zu haben.
Das Herz des Schulcampus ist die zentrale, dreigeschoßige Aula, in die sowohl der Musikschuleingang von der Schulgasse als auch der Schulhaupteingang von der Sportlände mündet. Hier wird gegessen, musiziert und gespielt. In den Obergeschoßen sind sechs mal vier Klassen in Clustern so organisiert, dass jeweils alle Schulstufen durchmischt sind. „Differenzierung und Individualisierung sind sehr wichtig“, erklärt Frau Imre. Ein Kind, das schon sehr gut liest, kann in der Lesestunde einfach in eine höhere Klasse wechseln. Zum „Dorfplatz“ der Cluster hin sind die Klassenzimmer verglast. Die Offenheit lenke die Kinder nach einer kurzen Gewöhnungsphase auch gar nicht mehr ab, sagt die Schulleiterin. Eine Besonderheit sind bilinguale Ungarisch- und Kroatisch-Klassen, zusätzlich wird Unterricht in Romanes angeboten. Das architektonische Ziel, so Architekt Anhammer: die Gemeinschaft und die Vielfalt unterstützen.
Eine Attraktion ist das frei im Raum stehende Bibliothekshaus im ersten Obergeschoß. Es wird viel genutzt, weil rundherum viel Platz ist, um sich zu bewegen oder niederzulassen. Ein anderes Highlight sind die Sportanlagen. Die große Turnhalle ist in zwei Normturnsäle teilbar. Der Bewegungsraum ist mit einer fixen Mattenfläche auf einem Schwingboden ausgestattet. „Oberwart ist eine Sportstadt“ erklärt Amtsleiter Roland Poiger. Insbesondere eine Judo-Hochburg. Poiger ist Präsident des Burgenländischen Judoverbandes und trainiert den Oberwarter Nachwuchs. Der Mattenboden bringe nicht nur den Judokas was: Die Schulanfänger turnen einfach in Socken und verlieren keine Zeit mit dem An- und Ausziehen der Turnschuhe. Abends können die Damen von der Turngruppe ihre eigenen Matten zu Hause lassen. „Wäre schön, wenn das auch andere Schulstandorte übernehmen.“