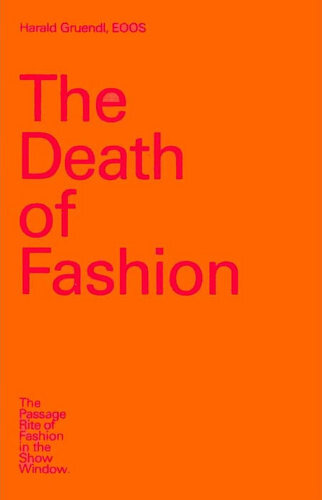Was kann eigentlich recyceltes Aluminium besser?
Die Designerin Inga Sempé ist für ihre kritische Haltung bekannt, sie baut auf die vertrauensvolle Koproduktion mit Firmen. Für einen Alu-Hersteller hat sie erstmals mit wiederverwendetem Aluminium gearbeitet. Wurde ihr Vertrauen enttäuscht?
Aluminium ist ein wichtiger Werkstoff in Architektur und Design – aber ist es auch zukunftsfähig? Und wie sieht es mit seiner Recyclingfähigkeit aus? Ein Blick in den „Atlas Recycling. Gebäude als Materialressource“ (2021) beruhigt vorerst hinsichtlich der Verfügbarkeit des Materials: Aluminium ist das in der Erdkruste am häufigsten vorkommende Metall. Eine Verknappung wie bei anderen Rohstoffen ist demnach nicht zu befürchten. Die Produktion von neuem (virgin) Aluminium erfordert den Aufschluss von Bauxiterz mit Natronlauge, dabei fällt giftiger Rotschlamm als Abfallprodukt an.
In der Vergangenheit war das Ablassen von Rotschlamm in Flüsse oder ins Meer ein durchaus gebräuchliches Abfallszenario. Die Umweltauswirkungen müssen nicht weiter ausgeführt werden, man denke nur an die Naturkatastrophe, die in Brasilien der Dammbruch von Bento Rodrigues 2015 ausgelöst hat, bei der Millionen Kubikmeter Giftschlamm Dörfer und Umwelt zerstörten. Der Rotschlamm wird in abgedichteten Becken gesammelt, die Natronlauge wiederverwendet. Und es wird zumindest versucht, Feststoffe im Rotschlamm für die Zementindustrie, die Stahlproduktion, den Straßenbau und die Baustoffindustrie zu nutzen – doch ist das ein verschwindend geringer Prozentsatz.
Kein Verbrennen oder Deponieren
Kreislaufwirtschaft stellt man sich anders vor. In Aluminiumhütten wird dann durch Schmelzflusselektrolyse Reinaluminium hergestellt; dass dafür einiges an elektrischer Energie nötig ist, hat sich schon herumgesprochen. Je nach Stromgewinnung hat das Endprodukt dann einen größeren oder kleineren CO2-Fußabdruck.
Es ist nur eine Mutmaßung, aber vielleicht ist die „Vorgeschichte“ von Neualuminium nicht so attraktiv zu erzählen – lieber redet man doch über Recycling. Betrachtet man die österreichische Kreislaufwirtschaftsstrategie, ist Recycling das Zweitdümmste, was man machen kann. Nur Verbrennen ist dümmer, das funktioniert aber mit Aluminium nicht. Deponieren wäre eine ähnlich sinnlose Alternative. Also bleiben wir beim Recycling von Aluminium. Wie bei Stahl gibt es auch hier verschiedene Legierungen, die bestimmte Verarbeitungseigenschaften ermöglichen.
Gebäudeabrisse erinnern an Bergwerke
Aluminium für Fensterprofile haben eine andere Zusammensetzung als das Fußkreuz eines Bürodrehstuhls oder eine Getränkedose. Aus dem Fußkreuz eines Designklassikers aus den 1950er-Jahren wird weder eine moderne Aluminiumfassade des 21. Jahrhunderts noch eine Verpackung für Bier oder Softdrinks. Das liegt nicht am Materialalter, sondern an der Legierung. Die Stadt als Rohstofflager oder Bergwerk war einmal so ein geflügeltes Wort, als die Architektur die Kreislaufwirtschaft in ihre Überlegungen einbezog. Der Abriss von Gebäuden erinnert tatsächlich an Bergwerke, wo unfassbare Materialmassen mit übergroßen Maschinen abgebaut werden. Das, was man eigentlich an Rohstoffen verwendet, ist oft nur ein Bruchteil der abgebauten und bewegten Materialmenge.
Aus Sicht von Konsument:innen ist beim Kauf eine klare und einfache Botschaft gefragt, etwa: „Aus 100 Prozent Rezyklat“ oder „Aluminium ist unendlich oft rezyklierbar“. Es macht ein gutes Gewissen, dass hier alle Probleme der Kreislaufwirtschaft gelöst sind. Letztere Aussage ist wohl mathematisch richtig, denn wenn man von 100 Prozent immer zehn Prozent abzieht, bleibt auch nach mehrmaligem Abziehen noch etwas übrig. „90 Prozent des Aluminiums wurden aus Bau und Transport wiederverwendet“, liest man in einem Bericht der Europäischen Interessenorganisation der Recyclingwirtschaft EuRIC. Man liest allerdings auch, dass der Bedarf an Aluminium bis 2050 um 50 Prozent steigen wird.
Stellt man sich ein Aluminiumprofil mit einem Meter Länge vor und schneidet man immer zehn Prozent ab (= Recyclingrate), nach wie vielen Schnitten ist weniger als die Hälfte des Profils übrig? Nach sieben Schnitten. Die Kurve nähert sich dann etwas langsamer dem Nullpunkt an, Aluminium ist ja unendlich oft wiederverwendbar. Bei der Rechnung wurden nicht einmal die schwindenden Eigenschaften des Sekundäraluminiums berücksichtigt, die durch derzeit noch schwer entfernbare Störstoffe in der Schmelze auftreten.
Ein nordischer Aluminiumhersteller hat bei der Milan Design Week im April 2024 das außerordentliche metallurgische Kunststück vollbracht, Aluminiumprofile aus 100 Prozent wiederverwendetem Aluminium zu präsentieren. Das alchemistische Projekt, das aus Aluminiumschrott „makellos aussehende Designobjekte“ zauberte, bediente sich einer handverlesenen Runde von sieben „weltbekannten Designschaffenden“, die aus der „sehr speziellen Legierung“ Möbel oder andere kleine Designobjekte erschaffen sollten. Die Objekte sollten monomateriell, leicht zerlegbar und rezyklierbar sein. Als übergeordneter ästhetischer Ausdruck wurden die Objekte mit bunten Eloxalschichten überzogen.
Warum ist ein Stuhl „grün“?
Der Recyclingatlas bestätigt den konstruktiven Ansatz des Projektes, zeigt aber auch, dass der Oberflächenschutz aus organischen Beschichtungen gewählt werden sollte, da diese beim Einschmelzen besser entfernt werden können. Es entstehen zwei kleine Tischleuchten, die ohne Not schwer rezyklierbaren Elektronikschrott in das Recyclingszenario einbringen. Wäre eine Blumenvase oder ein Stifthalter nicht besser gewesen?
Die Rolle von Design und Architektur im Greenwashing ist äußerst problematisch. Das beginnt mit wundersamen Narrativen, warum ein Haus, ein Stuhl oder eine Verpackung grün oder nachhaltig wäre. Hintergrund für das wohlwollende Aufnehmen der Geschichten ist eine unzureichende (Aus-)Bildung, die auch die Jahre nach dem offiziellen Bildungsabschluss einschließt. Der Echoraum des Greenwashing wird durch uniformierte Berichterstattung in Fachzeitungen, Design- und Architekturblogs aufrechterhalten und verstärkt. Gut gemachte Presseaussendungen, schöne Bilder und berühmte Designschaffende, wissenschaftliche Erkenntnisse und Studien erzeugen ein Klima des Wohlwollens.
Selbstüberschätzung von Designschaffenden
Inga Sempé ist für ihre reflektierte Art gegenüber dem Designzirkus eine respektierte Persönlichkeit, die dem Geniekult und der Selbstüberschätzung von Designschaffenden mehr als kritisch gegenübersteht. Sempé hatte bis zu dem Projekt keine Erfahrung mit Aluminiumprofilen. Ihr Credo ist das vertrauensvolle Zusammenarbeiten mit guten Firmen. Wurde dieses Vertrauen hier enttäuscht? Auf ihrer Homepage findet sich das Projekt jedenfalls nicht.
Zum Schluss noch einmal die Umweltvorteile von Sekundäraluminium: ein um 92 Prozent reduzierter CO2-Fußabdruck und eine Energieeinsparung von 95 Prozent gegenüber Rohaluminium sowie die Einsparung von acht Tonnen Bauxit, 14.000 Kilowattstunden Energie und 7,5 Kubikmeter Deponiematerial pro Tonne Sekundäraluminium gegenüber Rohaluminium. Das im Designprojekt verwendete 100 Prozent rezyklierte Aluminium ist bisher nur „sehr limitiert“ verfügbar. Über den Preis herrscht auch nach Nachfrage bei der Presseabteilung Stillschweigen.