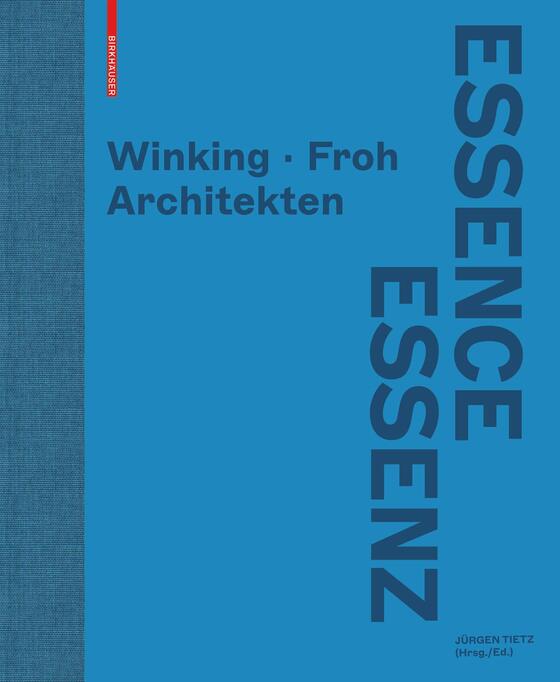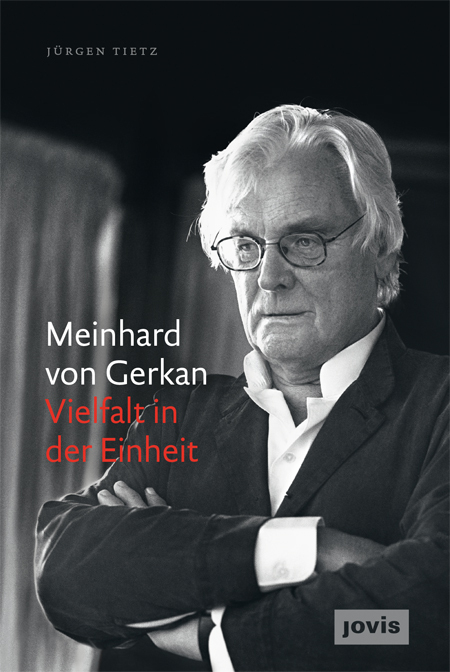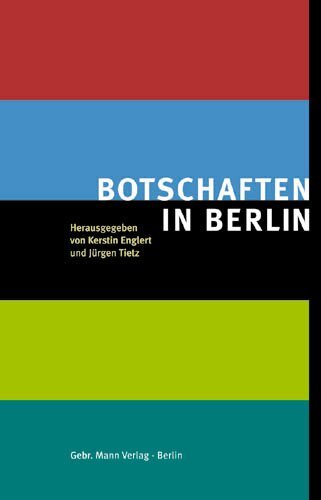In der kanadischen Metropole Toronto am Ontariosee herrscht architektonische Aufbruchstimmung
Mit Museumserweiterungen, Universitätsbauten und Wohntürmen erfindet sich Toronto neu. Dabei kommen nicht nur die Grossen der Architekturszene wie Daniel Libeskind und Frank O. Gehry zum Zug. Auch einheimische Architekten setzen in der Stadt am Ontariosee Zeichen.
Es handelt sich um eine glanzvolle, aber späte Heimkehr für den 1929 in Toronto geborenen Frank O. Gehry. Mitte November nämlich wird in seiner Heimatstadt die von ihm entworfene Erweiterung der Art Gallery of Ontario (AGO) eröffnet. Für Gehry, der von Basel bis Boston schon in aller Welt gebaut hat, ist es erstaunlicherweise das erste in Kanada verwirklichte Grossprojekt. Dabei erscheint die Transformation der Art Gallery zumindest von aussen weniger spektakulär als einige ältere Museumsprojekte Gehrys, allen voran der Paukenschlag des Guggenheim-Museums in Bilbao. Der Bau im Zentrum von Toronto gibt sich städtisch gezähmt, aber gleichwohl prägnant mit einer Glasfassade, die sich wie eine Welle des Lake Ontario vor dem Galeriegebäude an der Dundas Street West hebt und senkt. Weniger inspiriert wirkt die hohe Box, mit der Frank Gehry das bestehende Museum auf der Rückseite ergänzt und dadurch auch den Charakter des sich gleich hinter dem Museum weitenden Grange Park verändert.
neue Entdeckungen
Die Erweiterung der Art Gallery bildet den vorläufigen Schlussstein in der gegenwärtigen baukünstlerischen Verwandlung Torontos. Seit einigen Jahren ist die Stadt dabei, sich als «design city» neu zu erfinden und dabei jenen architektonischen Grauschleier abzulegen, der manche der mittelmässigen Betonburgen umgibt, die während Torontos letztem grossem Bauschub in den siebziger Jahren entstanden sind. Für Bruce Kuwabara, Partner im renommierten kanadischen Architekturbüro Kuwabara Payne McKenna Blumberg (KPMB), befindet sich Toronto «an einem entscheidenden Punkt in seiner Geschichte». Nie sei hier das Interesse an Architektur, Städteplanung und Design grösser gewesen als heute. Die städtebauliche Entwicklung werde intensiv in der Öffentlichkeit diskutiert. Tatsächlich spiegelt sich dieser Diskussionsprozess nicht nur in den traditionellen Medien wider, sondern auch auf zahlreichen Websites, die sich intensiv mit der Gestaltung Torontos auseinandersetzen und dabei Position beziehen.
Das neue Toronto gibt sich bunt und vielfältig in den architektonischen Formen – auch wenn nicht alle Projekte der letzten Jahre völlig überzeugen können. Gleichwohl ist die kulturelle Aufbruchstimmung in der quirligen Metropole unverkennbar. Dabei besitzt die «Renaissance der Städte» hier ein durchaus anderes Antlitz als in Europa. Dieses wird nicht nur durch zahlreiche neue Bauten für Kultur und Wissenschaft geprägt, sondern auch durch etliche neue Condominium-Towers, die hoch in den Himmel von Downtown Toronto ragen. Einige Protagonisten der architektonischen Neupositionierung sind alte Bekannte aus dem globalen Architekturzirkus, etwa Daniel Libeskind, von dem die Planung für einen dynamisch L-förmigen Wohnturm stammt. Er wird künftig dem ehrwürdigen, in den frühen 1960er Jahren entstandenen «Sony Centre for the Performing Arts» (von Peter Dickinson mit Page und Steele) an der prominenten Kreuzung von Yonge und Front Street bedrohlich nahe rücken.
Von Libeskind stammt auch die zweite neue Architekturikone neben Gehrys Art Gallery, mit der sich Toronto seit dem Sommer 2007 schmückt: Zwischen die Flügel des Royal Ontario Museum (ROM) hat Libeskind eine mächtige Stahlstruktur aus ineinander verschachtelten Kuben geschoben. Neben einer neuen, grosszügigen Eingangshalle entstehen so Ausstellungsräume für die natur- und kulturhistorischen Sammlungen des ROM. Die vielgelobte «kristalline» Architektur des Hauses könnte man ganz einfach auch als eckig beschreiben, bedient sich Libeskind doch beim ROM letztlich einer dem Jüdischen Museum in Berlin verwandten Formensprache. Die expressive Geste der dramatisch weit in den Strassenraum ragenden Erweiterung bleibt auch im Inneren des ROM als Leitmotiv sichtbar und besitzt dabei durchaus faszinierende Momente. Etwa wenn gewaltige Saurierskelette durch Libeskinds dekonstruierte Raumwelten mit den eingeschnittenen schmalen Fensterstreifen zu schweben scheinen. Allerdings dominiert die klobige Architektur die Exponate allzu sehr; und der eine oder andere Weg durch die Museumsräume endet für die Besucher überraschend im Nichts. Zudem zeugt Libeskinds Architektur nicht gerade von einem sensiblen Umgang mit den Schnittstellen zwischen Alt- und Neubau.
Weit weniger exaltiert, ja fast schon europäisch in seiner subtilen Gestaltung des Übergangs vom öffentlichen Strassenraum zur abgestuften Fassade erweist sich demgegenüber das Gardiner Museum of Ceramic Arts, das sich gleich neben dem ROM erhebt. Entworfen haben den Neubau Kuwabara, Payne, McKenna, Blumberg aus Toronto. Vor rund zwanzig Jahren gegründet, zählt das Büro KPMB zu den derzeit interessantesten der kanadischen Architekturszene. Wie Libeskind beim ROM gingen auch KPMB beim Gardiner Museum vom Motiv des Kubus aus, doch im Endergebnis unterscheiden sich die beiden Architekturen grundlegend: Die geometrischen Formen des Gardiner sind nicht wie bei Libeskinds ROM-Erweiterung wild ineinander verschachtelt. Vielmehr ragen die mit hellbraunem Kalkstein verkleideten Volumen unterschiedlich weit – aber wohlgeordnet – in den Stadtraum hinein. So entsteht eine angenehme Empfangssituation für die Museumsbesucher. Vor allem im Dämmerlicht bieten die grossen Glasflächen reizvolle Einblicke in das ansprechende Museum, das kürzlich mit einem internationalen Preis des Royal Institute of British Architects (RIBA) ausgezeichnet wurde.
Kulturelle Vielfalt
Wie sehr der architektonische Aufbruch Torontos vom vielfältigen kulturellen Angebot der Metropole bestimmt wird, zeigt sich nicht nur an den zahlreichen Museumserweiterungen. Deutlich wird dies auch an der neuen Oper Torontos, dem Four Seasons Centre for the Performing Arts, das von Diamond & Schmitt Architects entworfen wurde. Es ist ebenfalls ein ruhiger, aber keineswegs langweiliger Bau. Mit seinem Materialdialog aus geschlossenen dunklen Ziegelflächen und weiten Glasöffnungen fügt er sich klug in das städtische Gefüge ein. Zugleich lädt er zum Blick von aussen in das grosszügige Foyer ein. Dort bietet sich eine wohlinszenierte Komposition aus umlaufenden Galerien, die mit einer spektakulären «Himmelsleiter»-Treppe verbunden werden. Als zusätzlicher Blickfang und gleichzeitig als Sichtschutz für die Zugänge zu den Besucherrängen dient eine leicht geschwungene Wand aus horizontalen Holzlamellen, die in ihrem Duktus an Arbeiten Alvar Aaltos denken lässt. Diese wirkungsvolle Kombination von Elementen der Moderne verweist auf die Wurzeln von Jack Diamond, der zu Beginn seiner Karriere im Büro von Louis Kahn gearbeitet hat.
Unweit der neuen Oper entsteht derzeit in der King Street West das neue Festivalcenter des jährlich Anfang September stattfindenden Filmfests von Toronto, das gerne als Auftakt zur Filmpreis-Saison Hollywoods bezeichnet wird. Der Bau der «Bell Lightbox» (Fertigstellung 2009) soll zu einer «senkrechten Stadt des Films» werden, wie es Bruce Kuwabara von KPMB formuliert. Das Konzept sieht einen im unteren Bereich stark gegliederten Baukörper vor, der dem Filmfestival eine architektonische Visitenkarte liefern und zudem von einem insgesamt 46-geschossigen Wohngebäude (Fertigstellung 2010) bekrönt werden soll. Während sich das im Bau befindliche Festivalcenter konsequent in die neuen innerstädtischen Hochhausprojekte einfügt, trifft man im ehemaligen Distillery District auf ein ganz anderes Toronto und zugleich auf eine ganz andere Architektursprache von KPMB.
Keine fünfzehn Minuten zu Fuss von der lärmenden Betriebsamkeit der Yonge Street entfernt, die Toronto wie eine Pulsader der Länge nach durchläuft, werden die Häuser niedriger und die Lücken zwischen ihnen grösser. Der Takt der Grossstadt verlangsamt sich merklich, und die vom legendären CN Tower, dem Wahrzeichen der Stadt, überragten Hochhäuser rücken ein Stück zurück. Doch selbst hier, am Rand der Old Town, hat der neue Bauboom seine Spuren hinterlassen, überragt ein eben fertiggestellter Wohnturm den erfolgreich wiederbelebten Distillery District. Doch der Turm hält den ziegelroten Backsteinbauten der einstigen Fabrikanlage nicht stand und entschwindet schnell aus dem Blick.
Der Distillery District ist ein abgeschlossener kleiner Bezirk, in dessen stimmungsvollem Ambiente sich in den letzten Jahren eine Kunst- und Kulturszene angesiedelt hat. Dabei wurden die historischen Backsteinhallen mit einer vorbildlich zurückhaltenden Architektur ergänzt und bieten nun viel Raum für Galerien und Designerläden. So ist ein für Kanada eher ungewöhnliches Areal entstanden, das – zumal in den Sommermonaten – zahlreiche Touristen anzieht. Mit übersichtlichen Lageplänen logistisch bestens ausgestattet, flanieren sie durch die Läden und Backsteingassen oder lassen sich in einem der Restaurants nieder. Am Rand des Distillery District haben KPMB das «Young Centre for Performing Arts» verwirklicht, ein Low-Budget-Projekt, das zu einem grossen Teil aus Spenden finanziert wurde. Dank den sensiblen Um- und Einbauten hat das Fabrikgebäude seinen Denkmalcharakter und vor allem seinen Charme bewahrt. Die roten Ziegel der Fassade werden im anheimelnden Foyer, das auch ein Café beherbergt, durch Einbauten aus warmen Holztönen ergänzt, ohne dass dabei der industrielle Charakter des Hauses verschleiert würde. Zur gelungenen Wirkung des Umbaus trägt auch die offene Dachkonstruktion mit ihren Holzbindern bei, die die alten Mauern leicht überragt. Verglichen mit den neuen innerstädtischen Millionenprojekten erweist sich das Young Centre zwar als eher unspektakulär – aber dank seiner stimmungsvollen Intimität ist es dennoch eines der schönsten und überzeugendsten Kulturzentren des neuen Toronto.
Mikado-Pixel
Dass der Umgang mit vorhandener Bausubstanz auch eine ganz andere Gestalt als beim Young Centre annehmen kann, hat der Brite Will Alsop mit seiner bereits 2004 fertiggestellten Erweiterung des Sharp Centre des Ontario College of Art and Design (OCAD) bewiesen, das gleich hinter der Ontario Art Gallery liegt. Neben dem altbekannten Postkartenmotiv des CN Tower ist der spektakuläre Alsop-Bau bereits zu einem der neuen architektonischen Wahrzeichen der Stadt aufgestiegen. Wie die auseinanderpurzelnden Stäbe eines Mikadospiels hat Alsop zwölf farbige Stahlstützen vor dem Altbau verteilt. Zusammen mit einem schwarzgestrichenen Erschliessungsturm aus Beton und einem schrägen Fluchttreppenhaus in knalligem Rot tragen sie die doppelgeschossige Box des neuen «Sharp Centre for Design». Der Neubau mit seiner schwarz-weiss gepixelten Fassade, über welche die Fenster unregelmässig verteilt sind, schwebt wie eine Bildstörung über dem Backsteinbau.
Auch beim zweiten Blick bleibt diese «Bildstörung» bestehen und verdichtet sich zur atemberaubenden Architekturikone. Sie spielt mit dem Erbe der Moderne und den Ideen der freischwebenden Wolkenbügelvisionen der russischen Konstruktivisten ebenso wie mit den Luftgeschossen eines Le Corbusier. Dabei gelingt es Alsop, unter dem weit auskragenden Baukörper einen einzigartigen öffentlichen Raum zu gestalten, der an den Grange Park anschliesst. In dem für Toronto typischen, aus niedrigen alten Backsteinbauten und neuen, höheren Wohnhäusern bestehenden Gebäudemix des Viertels setzt das Sharp Centre einen aussergewöhnlichen Akzent. Dieses freundliche Raumschiff vermittelt eine klare Botschaft: Design bietet mehr als das konventionelle Fortspinnen des Gewohnten. So wird es zu einem wirkungsvollen Markenzeichen für das OCAD. Eine ganze Stadt aus solchen Bauten wäre wohl ein Albtraum, aber ein einzelnes derartiges Zeichen in der Stadt kann zum Blickfang werden – und eine inspirierend kritische Sicht des gebauten Mainstreams fördern.
Wer in die Genese von Alsops Sharp Centre eintauchen will, der kann das bis zum 5. Oktober in Torontos ungleicher Schwesterstadt Montreal tun. Dort zeigt das Centre Canadien d'Architecture (CCA) in der Ausstellung «Will Alsop – OCAD, an Urban Manifesto» neben Entwurfszeichnungen und Collagen auch mehrere Filme, in denen man die Konstruktion und Entstehung des Gebäudes nachvollziehen kann.
Transformationsprozess
Ganz so spektakulär wie nach aussen gibt sich das Sharp Centre im Inneren nicht. Dort bleibt es eine vergleichsweise konventionelle Metall-Box, deren Stahlkonstruktion betont industriell wirkt. Das passt zwar zum Werkstattcharakter der Ausbildung, fällt aber gegenüber der Aussenwirkung ästhetisch etwas ab. Gerade Alsops Sharp Centre macht deutlich, dass der architektonische Aufbruch Torontos keineswegs allein auf die Ankurbelung des Tourismus schielt. Eine ebenso deutliche Sprache sprechen auch die zahlreichen neuen Wohntürme, die an der Hafenfront entstehen: Toronto ist als Wohnort attraktiv. Am Ufer des Ontariosees, der sich wie ein gewaltiges Binnenmeer vor der Stadt ausdehnt, liegt auch das grösste Entwicklungsgebiet der Agglomeration. Denn für die Stadt wäre es fatal, wenn das attraktive architektonische Amalgam verschwände, das das geschäftige Zentrum der Stadt rechts und links der Yonge Street rahmt – jene inspirierende Mischung, in der die Ziegelfassaden und Türmchen der kleinteiligen, manchmal etwas miefigen älteren Bebauung der Zeit um 1900 in einen krassen Dialog mit den betongrauen Bauten der Nachkriegszeit und den gläsernen Architekturen der Gegenwart treten. Dazwischen breiten sich unvermittelt Parkplätze, aber auch malerische Parks aus. Doch eine schmerzhafte Narbe zieht sich durch das Weichbild der Stadt: der Gardiner Expressway, eine breite Hochstrasse, die Toronto vom Ufer des Ontariosees abschneidet. Ein Blick hinab von den schwindelnden Höhen des CN Tower macht schnell deutlich, welche städtebauliche Katastrophe dieser breite Expressway darstellt. Ihn als Fussgänger zu unterqueren, kommt einem lärmenden Gang durch die Hölle gleich.
Im preisgekrönten Entwurf zur Neugestaltung der Hafenfront des Rotterdamer Büros West 8 findet man wohl einige putzige künstliche Inseln in Ahornblattform, die der Stadt im Ontariosee vorgelagert werden sollen – den Gardiner Expressway aber sucht man zum Glück vergebens. Dessen Zukunft wird in Toronto allerdings weiterhin kontrovers diskutiert. Der Ausgang ist offen, auch wenn man sich wünschen würde, dass der Expressway in einen Tunnel unter der Erde verlegt wird. Doch wie auch immer die Zukunft dieser Hochstrasse aussieht – die weitere Entwicklung des Hafenareals bildet den nächsten Schritt im Transformationsprozess der Stadt. Denn: Torontos Aufbruch dauert an.
[ Dr. Jürgen Tietz ist Architekturhistoriker und Publizist in Berlin ]