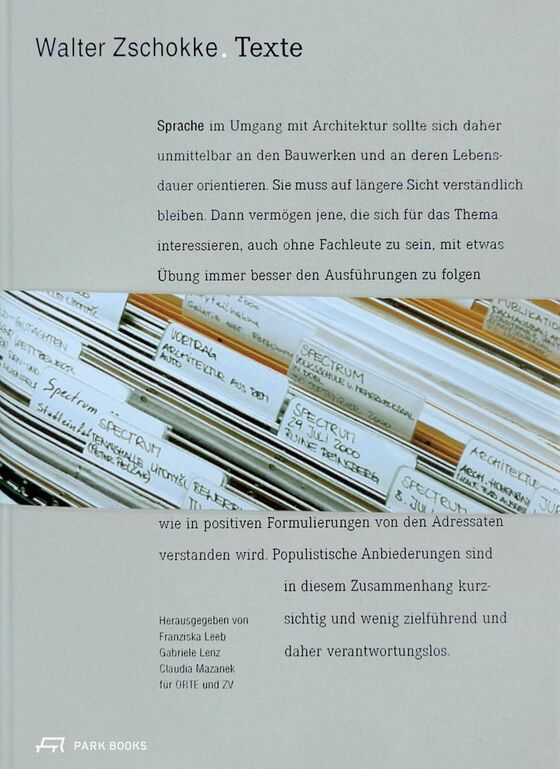Seit 2010 baut die Stadt Wien eine Reihe neuer Geriatriezentren.1 Sie sollen die medikalisierte Pflege in einem Umfeld erlauben, in dem die Patienten so wenig Spitalambiente wie möglich vorfinden. Man orientierte sich an Komfortkriterien des Wohnbaus, und wohl deshalb kamen Architekturbüros zum Zug, die sich im Geschosswohnungsbau profiliert haben. Die Gleichzeitigkeit der Entstehung und der Pilotcharakter des Bauprogrammes, für das es auch international kaum Referenzprojekte gab, sorgte für einen regen Erfahrungsaustausch zwischen den einzelnen Projektteams. Die drei bereits fertiggestellten Häuser Leopoldstadt, Simmering und Liesing zeigen, wie unterschiedlich die Architekten das enge Korsett an Vorgaben interpretierten.
Das als Stadt im Grünen konzipierte «Versorgungsheim Lainz» am westlichen Stadtrand von Wien galt bei seiner Erbauung zu Beginn des 20. Jahrhunderts als internationales Vorzeigeprojekt (Abb. 1). Im Vergleich zu allen vorher bestehenden Einrichtungen zur Betreuung alter und armer Menschen boten die ansehnlichen Bauten mit gut belüfteten und belichteten Schlafräumen, Etagenbädern, Balkonen und Tagräumen einen bis dahin unüblichen Komfort. Andererseits wurde der abgelegene Standort wohl nicht nur wegen der guten Luft gewählt, sondern auch, um die Klientel aus dem Stadtzentrum fernzuhalten. Der inhaltliche Wandel der institutionellen Altenpflege lässt sich auch an der Namensgebung ablesen: In den 1960er-Jahren wurde das Versorgungsheim zum «Pflegeheim» und in den 1990er-Jahren zum «Geriatriezentrum am Wienerwald» umgebaut.
2015 wird das Wiener Flaggschiff der Altenpflege geschlossen und neu als Wohnquartier genutzt.2 Die rund 1200 Pflegeplätze werden dann in insgesamt neun neuen Häusern – teils an schon bestehenden Standorten – untergebracht sein, die nicht mehr im Westen der Stadt konzentriert sind, sondern dezentral über das Stadtgebiet verteilt werden. So wird den zukünftigen Patienten der Verbleib in der vertrauten Wohnumgebung ermöglicht. Die Klientel besteht aus betagten Menschen, die einen Pflegebedarf von mehr als 160 Stunden pro Monat haben und für die eine Pflege zu Hause oder in einem Seniorenwohnheim aufgrund der medizinischen Indikationen nicht zu bewerkstelligen ist. Die Wiener Pflegeplätze – sowohl jene in den kommunalen wie auch jene in Institutionen von privaten Trägern – werden über eine Clearingstelle nach pflegerischer und medizinischer Notwendigkeit vergeben und entweder aus dem Vermögen der Betroffenen oder über die Sozialhilfe finanziert.
Wohnlichkeit trotz Krankenhausinfrastruktur
Die Grössenordnung der neu errichteten Geriatriezentren, die nur an bestehenden Standorten weiterhin so heissen, an neuen Standorten aber «Pflegewohnhäuser» genannt werden, bewegt sich um je 300 Betten. Das Wiener Wohn- und Pflegeheimgesetz vom März 2005 gibt mit 350 Betten die Grenze nach oben vor, mit 240 Betten wurde eine wirtschaftlich sinnvolle Untergrenze definiert. Im Schnitt bleiben die Menschen zwei bis drei Jahre in den Einrichtungen, manche auch Jahrzehnte, jedenfalls so gut wie alle bis an das Ende ihres Lebens.
Um ihnen eine wohnliche Atmosphäre zu bieten und die Maschinerie des Krankenhauses in den Hintergrund zu drängen, gibt es Vorgaben: In den Pflegewohnbereichen, wie die Stationen nun genannt werden, soll der Aspekt des Wohnens im Vordergrund stehen. Die Zimmer sind überwiegend Einzelzimmer, etwa zu einem Viertel werden Doppelzimmer angeboten. Eine private Loggia für jedes Zimmer ist Pflicht und muss so ausgebildet sein, dass die Schwellen zwischen Zimmer und Freiraum auch mit Pflegebetten leicht überwunden werden können. Neben den Anforderungen an die Wohnlichkeit gelten für alle Häuser einheitliche strukturelle Vorgaben: So sind pro Geschoss mindestens zwei Pflegewohnbereiche unterzubringen, damit Therapieräume von mehreren Stationen nutzbar sind. Die Konstruktion soll eine hohe Flexibilität zum einfachen Umbau auch in der Betriebsphase gewährleisten. So sind zwischen allen Zimmern «Sollbruchstellen» vorzusehen, um den späteren Einbau von Verbindungstüren zu ermöglichen. Die maximal 28 Plätze pro Wohnbereich werden in zwei bis drei Wohngruppen gegliedert, denen gemeinsame Wohnzimmer zugeordnet sind.
Pro Haus sind überdies zwei Demenzstationen (mit insgesamt max. 56 Plätzen) für schwer Demenzkranke vorgesehen. Zudem sind Überschaubarkeit und kommunikations- und kontaktfördernde Strukturen sowie Inszenierungen gefordert (in Form künstlerischer Interventionen oder Aquarien), die zum passiven Beobachten animieren. Da etwa 80 % der Bewohnerinnen und Bewohner als Zusatzdiagnose Demenz aufweisen, muss auf den Bewegungsdrang dementer Menschen Rücksicht genommen werden. Wegführungen sollen als «Demenzschleifen» ausgebildet werden – also als Rundgänge ohne Sackgassen, damit die alten Leute ihre Runden drehen können.
Ein einheitliches visuelles Leitsystem für alle Häuser, für das die Grafikerin Gabriele Lenz und die Architektin Anja Mönkemöller (beide aus Wien) verantwortlich zeichnen, hilft zudem bei der Orientierung. Es variiert in einzelnen Aspekten wie in der pro Haus unterschiedlichen Farbigkeit oder in den Symbolfamilien zur Kennzeichnung der verschiedenen Stationen. Die Gartengestaltung soll abwechslungsreiche Spazierwege und Rückzugsorte anbieten, mit Duftkräutern, Blumen und Gräsern die Sinne stimulieren und ergotherapeutische Arbeitsplätze sowie Strecken für Gehtrainings zur Verfügung stellen. Sie ist verpflichtend an Landschaftsarchitekten zu vergeben. Die Bewohnerinnen und Bewohner der Häuser sollen – auch wenn sie nicht mehr mobil genug sind, um die Anlage zu verlassen – so viel wie möglich vom Leben rundherum mitbekommen. Daher sollen die Häuser gut in den Stadtquartieren verankert werden und keine Monostrukturen sein. Sie beherbergen weitere Nutzungen wie geriatrische Tageszentren, betreutes Wohnen, Mietwohnungen, Mehrzwecksäle auch für externe Veranstaltungen und allgemein zugängliche Cafeterias.
Pflegewohnhaus Leopoldstadt: Eine Stadt in einem Haus
Das Wohn- und Pflegehaus Leopoldstadt des Wiener Architekten Helmut Wimmer entstand auf dem Areal einer ehemaligen Buseinstellhalle im Stadtentwicklungsgebiet am ehemaligen Nordbahnhof. Die mächtige U-Form folgt den Vorgaben des Masterplans für das Quartier. Neben zwei Demenzstationen im ersten Obergeschoss und zehn Pflegestationen in den fünf Geschossen darüber beherbergt sie im zurückspringenden obersten Geschoss ein Heim für betreutes Wohnen sowie 22 geförderte Mietwohnungen in den Kopfbauteilen. Die Eingangshalle ist als zur Umgebung offene, multifunktionale Zone ausgebildet. Eine schleifenförmige Erweiterung in den Park birgt das Mitarbeiterrestaurant mit fernöstlich anmutendem Innenhof und einem Garten auf dem Dach, der es den Bewohnerinnen und Bewohnern der Demenzbereiche im ersten Stock erlaubt, ohne Begleitperson sicher ins Freie zu kommen.
Der Architekt überführte etliche seiner konzeptuellen Ansätze aus dem Wohnbau in das Pflegewohnhaus – zum Beispiel die Betrachtung der einzelnen Geschossebenen als übereinandergestapelten Baulands, auf dem innerhalb eines schlichten konstruktiven Systems aus Platten und Stützen Zwischenwände und Einbauten weitgehend frei disponiert werden können. Indem Zimmer und Funktionseinheiten zu kleinen «Häusern im Haus» (Abb. 6) zusammengefasst sind, schuf der Architekt eine vertikale Stadtlandschaft, innerhalb der den Bewohnerinnen und Bewohnern ein überschaubares, identifikationsstiftendes Umfeld geboten wird. Nach einem Farbkonzept des Wiener Künstlers Oskar Putz, der auch für die farbige Gestaltung in der Erdgeschosszone verantwortlich zeichnet, sind die einzelnen Hausgruppen unterschiedlich gefärbt und zeichnen sich so auch in der Fassade nach aussen ab. Dazwischen bildete Wimmer Gassen, Plätze und Sichtachsen.
Die Zimmer sind über die gesamte Breite mit Faltschiebetüren zum Loggienband hin zu öffnen, wodurch der Freiraum als Teil des Zimmers erfahren werden kann und der Wahrnehmungsradius der Bewohner über das Zimmer hinausgeht (Abb. 4). Kleine Fenster zu den Gängen hin gestatten die Teilnahme am Stationsleben, umgekehrt aber auch den Einblick von aussen, sofern die Jalousien nicht geschlossen sind. In jedem Fall tragen sie dazu bei, Isolation zu vermeiden. Die Materialisierung des Inneren ist stark von den für Krankenhäuser geltenden Hygienevorschriften und den für die Betreuung stark Pflegebedürftiger notwendigen Einrichtungen geprägt. Mit der hellen Grundfarbigkeit und den pastellfarbigen Fassaden der internen Häuser, den Markisen und dem Holzbelag auf den Loggien strahlt das Haus insgesamt dennoch das heitere Flair eines Erholungsheimes aus.
Pflegewohnhaus Simmering: Unkonventionelle Grundrisse
Ebenfalls in einem städtebaulichen Entwicklungsgebiet auf dem Areal einer ehemaligen Senf- und Essigfabrik liegt das Pflegewohnhaus Simmering des Wiener Architekten Josef Weichenberger. Die Umsetzung unterscheidet sich in Bezug auf Grundriss und Materialisierung dennoch stark von derjenigen in Leopoldstadt. Der Bauplatz grenzt an einen bewaldeten Park, der nach einem Konzept der Wiener Landschaftsarchitekten Auböck & Kárasz sowie den 3:0 Landschaftsarchitekten für die speziellen Anforderungen der betagten Klientel gerüstet wurde. Weichenbergers Entwurf trachtet danach, trotz dem grossen Gebäudevolumen Eintönigkeit zu vermeiden. Für eine optische Verkürzung sorgen die Gliederung in einen Mitteltrakt und zwei Seitenflügel sowie die leichten Knicke nach innen (Abb. 9). Die weiss verputzten Mäander an der Fassade gliedern im Wechselspiel mit der anthrazitfarbigen vorge- hängten Ziegelfassade und den Loggienöffnungen die Grossstruktur (Abb. 7). Die Brüche in der Linearität des Baukörpers kommen vor allem den offenen Raumsequenzen in den Pflegewohnbereichen zugute. Über eine geschosshohe Verglasung und vorgelagerte Terrassen öffnen sich die Tagräume zum Park hin. Die Nebenräume sind pro Station zu kompakten Inseln mit amorphem Grundriss gebündelt (Abb. 11), gliedern den weiten Raum zwischen den Zimmerfolgen und ermöglichen die Bildung von Wegschleifen. Mit einer offenen Küche samt Bar werden diese Binnenbauten auch zu sozialen Mittelpunkten jedes Wohnbereichs.
Bei den Zimmergrundrissen entschied sich der Architekt gegen die übliche Variante, das Badezimmer gangseitig anzubringen, sondern setzte es an die Aussenwand, um eine natürliche Belichtung zu ermöglichen. Auf diese Weise entstehen zwischen den Bädern an den Aussenfassaden Loggienpaare, die die Kommunikation zwischen jeweils zwei Nachbarn gestatten. Einige der Zimmer sind mit grossen Blumenfenstern zu den gemeinsamen Flächen in den Wohnbereichen versehen, bequeme Sitzbänke in den Zimmern machen Besucherinnen auch den längeren Aufenthalt angenehm (Abb. 8). Im Halbatrium, das die drei Gebäudeflügel zum Garten hin umschliessen, liegt als solitäre skulpturale Form der Andachtsraum aus Sichtbeton. Während auf seinem Dach zum Park hin ein beschaulicher Garten ausgebildet wurde, entstand über der Vorfahrt eine von beiden Demenzstationen zugängliche Terrasse, von der aus auch schwer desorientierte Menschen das Leben draussen ungefährdet beobachten können.
Geriatriezentrum Liesing: Sorgfältige Materialisierung
Auch bestehende Standorte sind Teil des Bauprogramms. Im Schlosspark Liesing im Südwesten von Wien ist seit 1876 ein Pflegeheim der Stadt in Betrieb. Bestehend aus einem Schloss aus dem 18. Jahrhundert und dem 1878 nebenan errichteten Versorgungsgebäude, entsprach es längst nicht mehr den heutigen Erfordernissen. Ein Neubau am Nordrand des Parks ersetzt nun das Versorgungsgebäude, das abgerissen wird. Das denkmalgeschützte Schloss wird instand gesetzt und wird die örtliche Musikschule beherbergen. Damit schufen die Architekten Riepl Kaufmann Bammer (Wien) zugleich eine Neuorganisation des Parkareals, in das nun auch das bestehende Parkbad im Süden des Geländes eingebunden ist. Der Neubau selbst zielt darauf ab, möglichst viele Schnittstellen und Durchdringungen zwischen Park und Gebäude zu ermöglichen.
Die Fassadenverkleidung aus Messingtrapezlochblech erdet das Gebäude farblich in der Parklandschaft und bildet für die benachbarten Amtsgebäude und Villen aus der Zeit um 1900 ein wertiges Gegenüber. Das Material setzt sich im Erdgeschoss als Deckenverkleidung fort. In Kombination mit dem Bodenbelag aus schwarz-weissem Terrazzo mit einer Gesteinskörnung aus Carraramarmor und mit den mit Ulmenfurnier belegten Wandverkleidungen wurde ein elegantes Ambiente geschaffen.
In den drei Obergeschossen des Karrees sind jeweils vier Lw-förmige Pflegewohnbereiche angesiedelt (Abb. 16). Zwei gläserne Spangen, die den internen Freibereich in drei Höfe unterteilen, sorgen für kurze Wege innerhalb der Geschosse. Zudem ermöglichen sie Rundgänge, die jeweils über zwei Pflegewohnbereiche führen. Die Orientierung wird durch subtile, aber wirksame Massnahmen unterstützt: Alle Gänge führen zum Licht hin, die abgehängten quadratischen Leuchten in den Tagräumen wurden in den Gangbereich erweitert und zeigen so schon von weitem die Lage der gemeinschaftlichen Flächen an. In die mit braunem Linoleum belegten Gänge wurden die je nach Station unterschiedlich farbigen Zimmerböden unter den Türen ein Stück hinausgezogen und dienen nun als dezente Markierungen der Zimmer. Die überwiegende Zahl der Zimmer ist nach Süden – zum Park oder Hof hin – orientiert. Messingverkleidete Schiebepaneele, die trotz massiver Optik leicht zu bedienen sind, gestatten die Beschattung der jedem Zimmer zugeordneten Freiräume (Abb. 17). Parkseitig blieb das zum Garten hin verglaste Erdgeschoss etwa zur Hälfte unbebaut, wodurch unter dem Gebäude hindurch ein Freiraumkontinuum vom Vorplatz über die Innenhöfe mit dem altem Baumbestand über die als «hortus conclusus» gestalteten, gedeckten Sitzbereiche unter dem Gebäude in den öffentlichen Park geschaffen wurde.
Im Grundriss erscheint das Gebäude nüchtern, vor Ort erweist es sich durch die sorgfältige und handwerklich präzise ausgeführte Materialisierung jedoch enorm wohnlich und von einer Hochwertigkeit, die Wertschätzung gegenüber den Bewohnerinnen und Bewohnern und den übrigen Nutzerinnen und Nutzern ausdrückt.
Ambitioniertes Bauprogramm
Im Zeitraum von 2010 bis 2012 sind insgesamt sechs neue Pflegewohnhäuser fertiggestellt worden. Ab 2015 soll kein einziger der stationären Langzeitpflegeplätze in einem alten Gebäude untergebracht sein. Abgesehen von den unterschiedlichen städtebaulichen Gegebenheiten waren die Qualitätsdefinitionen sowie das Raum- und Funktionsprogramm bei allen Häusern annähernd gleich. Aus den Mitteln der Wohnbauförderung wird für 1800 Euro pro m² ein Basisgebäude hergestellt, weitere 1500 Euro sind für die über das Wohnen hinausgehenden Anforderungen kalkuliert. Umgerechnet auf einen einzelnen Bewohnerplatz schlägt dieser etwa mit den Kosten einer 70 m² grossen Wohnung im geförderten Wohnbau zu Buche. Bemerkenswert ist, dass die Architekten, vor allem was die Ausbildung der inneren Strukturen betrifft – z. B. bei den Zimmergrundrissen und der Anlage der Gemeinschaftsbereiche –, variantenreiche Lösungen entwickelten. Auch die Grundstimmung variiert – von der cleanen Sanatoriumsatmosphäre über eher auf Gemütlichkeit abzielende Gestaltungen bis zu elegantem Hotelambiente. Welches Konzept für die Bewohnerinnen und Bewohner das bessere ist, hängt sicher von individuellen Vorlieben ab. Nach der relativ kurzen Betriebszeit gibt es noch keine evaluierten Erfahrungswerte. Die Nutzerzufriedenheit scheint jedoch hoch zu sein und aus architektonisch-gestalterischer Sicht sind die städtischen Häuser ähnlich dimensionierten Pflegeheimen privater Betreiber um Längen voraus.
Anmerkungen:
[01] Die Stadt Wien stellte 2004 ihr Geriatriekonzept vor, dass sich mit der erhöhten Lebenserwartung der Menschen und damit auch mit einer Zunahme der nötigen Pflegeplätze befasst. Es sieht vor, die Pflegeplätze bis 2015 dezentral über insgesamt 13 Standorte (vier davon als Wohn- und Pflegehäuser) im ganzen Stadtgebiet zu verteilen. Dafür ist ein Gesamtbudget von 400 Mio. Euro vorgesehen. Weitere Informationen: www.wienkav.at/kav/ZeigeText.asp?ID=37307
[02] Das 25 ha grosse Areal des Geriatriezentrums Am Wienerwald soll ab 2015 zu einem Wohnstandort im Grünen umgestaltet werden. Den Ideenwettbewerb gewann Ende Oktober 2009 das Wiener Büro Veit Aschenbrenner