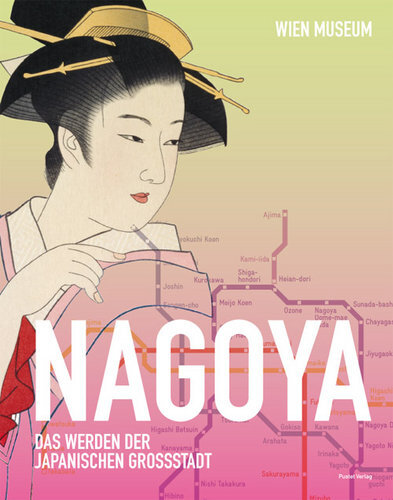Artikel
Schauplatz Alpen
Überlegungen zur Gestaltung der alpinen Freizeitarena
Am Airport von Zürich betreibt das Schweizer Heimatwerk einen Souvenir-Shop. Neben dem Üblichen, Fonduepfannen, Kuhglocken und Spieluhren sieht man auch Extravaganteres: eine hölzerne Sparbüchse in Form eines Käsestücks, einen Hubschrauber aus grün bemaltem Holz, Rucksäcke in Sämischleder oder Trinkbecher mit Fleckviehmuster. Seilbahn findet sich keine, weder in Holz, Blech oder Hartkäse. Auch im Geschäft nebenan, bei den Süßwaren, fehlt das einstige Paradeimage der Alpensehnsucht. Zwar finde ich Ausflugsdampfer auf den Schokoladenschleifen, ja sogar einen Drachenflieger vor blauem Schweizerhimmel – aber keine einzige Seilbahn.
Luftige Höhen
Die Erhabenheit des kühnen Emporschwebens zu luftigen Höhen, dieses widersprüchliche Zentralmotiv des alpinen Eroberungspathos, das die Wahrnehmung der Berglandschaft grundlegend veränderte, ist in der Epoche von Mountainbike, Rafting und fortschreitender Kräuteralchemie offenbar zum alten Eisen gewandert.1 Riesige Masten auf Felsklippen und Stahlseile, die durch den Nebel zum Himmel zu führen scheinen: Vielleicht symbolisierten solche seit der Zwischenkriegszeit vertrauten Images allzu deutlich die harte Kraft&Macht-Technik und das Funktional-Konstruktive. Heute zeigen Alpenorte, die über die obligate Armada von Seilschwebebahnen, 3er- bis 6er-Sesselbahnen, Schleppliften und Snowcats verfügen, in ihren Werbematerialien alles lieber als derlei infrastrukturelle Leistungsträger: duftige Biotope statt Eisenmasten, pittoresk verwitterte Holzschindelwände statt im Gegenlicht glitzernde Aluminiumgondeln, Leichtigkeit statt Sicherheit, „unverdorbene“ Urigkeit statt metallverarbeitende Tüchtigkeit.
Die große Zeit der in der Seilbahnfahrt kulminierenden Gipfelsehnsucht scheint mit dem – vor allem im Winter – veränderten Freizeitverhalten zu Ende gegangen zu sein. Für den Ski-Abfahrer vor der Pistenwalz-Ära war die Bergauffahrt ein „großes“ Erlebnis, das meist nur einmal pro Tag stattfand. Für Bergwanderer, Gipfelpanoramatiker und Sonnenfanatiker ist dieses Besonderheitsgefühl teilweise heute noch gegeben. Seit die Alpensportler jedoch statt dem Einfachticket (bzw. der Punktekarte, mit der man eine Woche lang sparsam die Aufwärtspunkte investierte) Pauschalpässe erwerben, hat die Einzelfahrt ihren Nimbus verloren. Man benützt ein System von tendenziell überall und jederzeit zur Verfügung stehenden Aufstiegshilfen: Aus einer Linie, die von unten nach oben führt, ist ein Netz von Wegen geworden, die in alle Richtungen zu führen scheinen. Im Zuge der Perfektionierung der Liftsysteme sind zunehmend auch Seilbahnen und Lifts entstanden, deren Sinn gar nicht mehr im Höhengewinn liegt, sondern die bloß als Zubringer zu anderen Bahnen zu dienen haben bzw. als Reserven für Tage mit besonderer Staubildung. Die Bergbahn hat also im Regelfall aufgehört, etwas Solitäres zu sein. Und selbst Kids betrachten es nicht mehr als Weltwunder, in einer Seilbahnkabine zur Zugspitze oder zum Piz Corvatsch zu schweben. Eher sind es abenteuerliche Arten des Herunterkommens wie Snowboarden im steilen Pulver, Drachenfliegen, Downhill-Radeln, die als erstaunlich und abenteuerlich empfunden werden. Bereits beim Anstehen in der Talstation laufen Videos, die gführige Snowboard-Fahrten zeigen, unterbrochen von Spots für Bräunungssysteme und Energy Drinks. Das Hinaufkommen ist eine nebenbei erlebte Selbstverständlichkeit, das Obensein ist Routine.
Panoramablick
Die Betreiber der heroischen Strecken in den Hochalpen wissen das offenbar und versuchen, neue Wahrnehmungskicks zu provozieren. Beim Warten am Gate, immer noch am Airport Zürich, lese ich dann im „Travel Text“ auf dem Infomonitor: „Neue Montblanc-Seilbahn. Eine neue Seilbahn führt zur 3.842 m hohen Aguille du Midi im Montblanc-Massiv. Die neue verglaste Seilbahn löst die alte Bahn ab, die 30 Jahre lang im Betrieb war. Die Glaskabine ermöglicht jetzt während der gesamten Fahrt einen Panoramablick in die Bergwelt am höchsten Gipfel der Alpen“.
Das Panoramatische, ermöglicht durch weit heruntergezogene Aussichtsfenster in den Kabinen, in denen die Blechhaut nur mehr bis in die Kniehöhe bzw. den oberen Skischuhrand der Passagiere reicht, wurde in den letzten Jahren zu einem Schlüsselwort in den Werbetexten von innovativen Kabinenherstellern wie Gangloff (z. B. die vom französischen Industriedesigner Yann Misson gestalteten Panoramakabinen auf das als „Magic Mountain des Berner Oberlandes“ vermarktete Schilthorn, 1995) oder CWA Olten („Xtra Design mit großzügiger Panoramaverglasung“, z. B. bei der neuen Pfänderbahn von Doppelmayr,1995). CWA Olten baute auch die ersten runden Rundumsicht-Kabinen mit drehbarem Boden, die seit 1981 bei der Titlisbahn in Engelberg im Einsatz sind und an die Aussichtsgeschoße von Fernsehtürmen erinnern. Bei Kleingondeln ist die Rundumverglasung, die auch den Direktblick in die Tiefe ermöglicht, schon seit Jahrzehnten üblich, wobei etwa die „neue“ Stubnerkogelbahn in Badgastein schon 1972 mit vollverglasten „Panoramagondeln“ ausgestattet worden ist. Diese „Miniräume mit optimaler Beziehung zur Landschaft“ (Friedrich Achleitner) waren mit Sonnenschutz-Acrylglas versehen und Teil eines Gasteiner Gesamtdesigns durch den Architekten Gerhard Garstenauer, der von „Superellipsen nach drei Raumachsen“ sprach.2 Auch die transparenten Wetterschutzhauben, die an 4er- oder 6er-Sesselbahnen angebracht sind und bei Schlechtwetter heruntergeklappt werden, schalten zwischen Liftbenützer und Landschaft eine Art Panoramafilter, der zu einer Intensivierung der Wahrnehmung beiträgt.
Die These vom Verschwinden der Hardware im Seilbahn-Erscheinungsbild bei gleichzeitiger Perfektionierung einer hyperrealen Landschaftswahrnehmung bestätigt sich also. Man könnte geradezu von einer Immaterialisierung der Transportwirklichkeit sprechen, von einem Wegzaubern aller technischen Schranken. In gewisser Weise wird damit der Erlebnisdreiklang „Schweben, Schauen, Staunen“, der in den frühen Jahren der Seilbahntechnik die Fahrtbeschreibungen bestimmte, reaktualisiert. In seiner mentalitätsgeschichtlichen Untersuchung „Die Seilbahnfahrt“ stellte Bernhard Tschofen für die heroische Epoche der 20er- bis 50er Jahre fest: „Neben der Luftfahrt wird die Seilbahnfahrt als die am meisten entmaterialisierte Form der Fortbewegung aufgefaßt. Das Gefühl des lautlosen, ferngeleiteten Schwebens, wie es in der französischen Bezeichnung der Seilbahn, „Téléphérique“, am eindrucksvollsten verbildlicht ist, rückt die Seilbahn wieder in die Nähe der medialen Reisesurrogate des 19. Jahrhunderts.“3 Es gibt heute also Bemühungen, das Spektakuläre in die Bergtechnik zurückzubringen – und gleichzeitig eine kühle Routine im Umgang mit Aufstiegshilfen.
Auch das Fluggefühl der Drachenflieger und Paraglider kennt dieses angesprochene Moment der Entwirklichung, erweitert allerdings um den Thrill des Alleinseins: hantiert man vor dem Start noch mit komplizierten Präzisionsgeräten mit ausgeklügelten Gurten und Verschlüssen, läßt man nach dem Absprung all das „Zeug“ hinter sich und gleitet scheinbar befreit von allem Realen durch die Lüfte. Das Allmachtsgefühl der Alpenerschließung hat also eine neue Qualität erreicht: Wir schweben über alle Hindernisse hinweg und bestehen darauf, nur unbehinderte Rundumschönheit vor unsere Sinne zu lassen.
Es hat sich in den letzten Jahren gestalterisch allerlei getan jenseits der Baumgrenze, von den an abstrakte Bodenskulpturen erinnernden Half Pipes der Snowboarder bis zu den redesignten Bergrestaurants, die – vielleicht aus Angst, ein jüngeres Publikum nicht mehr länger für den traditionellen Pisten- und Hüttenzauber faszinieren zu können – die rustikale Hütten-Deftigkeit zunehmend hinter sich lassen und so tun, als wären sie städtische In-Lokale. Doch bleiben wir vorerst bei der Gestaltung von Aufstiegssystemen, bei denen es in den letzten Jahren einen Innovationsschub gegeben hat, der mit der Umrüstung vieler Einzelsessellifte auf leistungsfähigere einkoppelbare Gondelbahnen bzw. Mehrpersonen-Sesselbahnen ursächlich zusammenhängt (wobei der banalste Aufzugstypus, der Schlepplift, zunehmend an Bedeutung verliert).4 Dabei scheinen zwei widersprüchliche Trends einander zu befruchten.
Architektonische Kultobjekte
Zum einen gibt es, vor allem bei Architektur-Afficionados und in der intellektuellen Diskussion in den Alpenländern, eine angesichts der seriellen Einfalt des jahrzehntelang dominanten „Lederhosenstils“ eine geradezu sehnsüchtige Rückbesinnung auf den kurzen Dialog zwischen Moderne und dem Bauen im Gebirge, zwischen urbaner Haltung und Gebirgstopographie.5 Diesem verdankt der Seilbahn- und Hotelbau einige „Kultobjekte“ der skulpturalen Expressivität – man denke an Franz Baumanns Stationen der Innsbrucker Nordkettenbahn, an das runde Turmhotel in Cervinia oder an die futuristisch anmutenden „Gipfelnester“ vieler Seilbahnen (z. B. Schilthorn, Valluga, Mont Blanc). Typisch für diese mit markanter Geste an verwegenen Bauplätzen placierten Bauten ist eine gewisse Trutzigkeit in der Semantik bei gleichzeitiger subtiler Anschmiegung an das Gelände. Die Spannung zwischen einem archaischen alpinen Kraftlackeltum und der swingenden Eleganz des modern style gab Sporthotels eines Gio Ponti (Valmartello, 1936) oder Franz Baumann (Hochfirst in Obergurgl, 1933) ihre besondere Note. Oft boten sich, etwa beim Doppelhotel Alpina und Edelweiß in Mürren oder bei Emil Fahrenkamps Hotel auf dem Monte Verità, Assoziationen mit Schiffen oder Flugzeugen an. Für die Wiederentdecker war solchen – inzwischen zumeist durch Umbauten zerstörten – Solitärbauten einer alpinen Moderne eine quasi moralische Haltung eingeschrieben. Im Vorwort zum Ausstellungskatalog „Hotelarchitektur in den Alpen 1920–1940“ in Sexten in Südtirol, wo inzwischen auch ein Preis für alpines Bauen verliehen wird, heißt es etwa: „Wir sind an einem Punkt der Überreizung und Orientierungslosigkeit angelangt und sehnen uns nach Klarheit und Echtheit von Formen ohne jegliche Klischeevorstellungen“6. Als der Hochgebirgspension Silvrettahaus (Planung: Untertrifaller/Hörburger) 1994 der erstmals verliehene Österreichische Staatspreis für Tourismus und Architektur zuerkannt wurde, wurde von der Jury betont, daß mit diesem auratischen Bau „eine lange verschüttete Tradition kongenial“ aufgegriffen wurde – durch die elegante Rundung und das präzise Spiel mit der Topographie, durch seine „kultivierte Gediegenheit“ und seinen Gestus von „Würde und Stolz“7.
Wichtiger als ein Wiederbeleben eines bestimmten formalen Repertoires – etwa das Spiel mit vertikalen Kuben und dynamisierenden Rundungen – ist für die aktuelle Situation die Erinnerung an eine gestalterische Haltung, die auch im hochalpinen Raum klare Sprachen jenseits der rustikalen Maskierung und der Tarnung großer Volumina (Liftstationen, Selbstbedienungsrestaurants etc.) mit Attributen wie etwa der Almhütte riskiert. Daraus ergibt sich ein Comeback der spektakulären Inszenierung, in der mit Blicken offensiv gespielt wird: Einmal mehr wird das Einfangen der Aussicht und das Hereinholen des Panoramas in das Innere von exzentrisch situierten Gebäuden zum Thema8, andererseits werben markant gestaltete Objekte gerade im baumlosen Gelände wie visuelle „Logos“ für bestimmte Skigebiete. Daß der Anlaß für diesen Text eine mit sehr klaren Mitteln arbeitende Kunstintervention im öffentlichen Freizeit-Raum ist, deutet an, daß es bei diesem Spiel mit Erlebnisqualität und Visibility keineswegs nur um den Bereich der traditionellen Baugestaltung geht.
High Tech verändert Architektur
Andererseits gibt es im hochalpinen Gelände einen unübersehbaren Trend zu High Tech, allerdings in der Gewichtsklasse „light“. Ob Masten, Laufräder oder Gondelform: Statt Wucht und Masse dominiert verspielt anmutende Feinmechanik. Selbst die Sicherheitsleiter auf der Liftstütze bekommt dabei eine geradezu graphische Qualität. Das Gefühl von „Leichtigkeit“ und „Transparenz“ – kaum eine Projektbeschreibung in den Fachmedien der Bergbahnenbranche kommt ohne diese Begriffe aus – hat vorwiegend mit dem forcierten Einsatz von Materialien wie Aluminium und Glas zu tun – bei gleichzeitigem Verzicht auf mächtige Tarnanzüge aus Holz, Satteldach und weißem Putz. „Auf optischen Samtpfoten' nähert sich der Gangloff-Riese der Talstation“. So heißt es in einer Bildunterschrift in einem Fachzeitschriften-Artikel über die in der Branche vielbestaunte neue Doppelstockkabinenbahn „Twinliner“ in Samnaun, die immerhin Jumbo-Dimensionen hat und 180 Personen pro Kabine befördern kann.9 Obwohl es bei dem Projekt um massive Effizienzsteigerung ging – Samnaun wollte sein „Wartezeiten-Image“ gegenüber dem Skizirkus von Ischgl auf der gegenüberliegenden Bergseite loswerden – wird in der Projektbeschreibung die „fast zierliche“ Bauweise der Karosserie betont. Die Einfahrtsbereiche und Stationsfassaden präsentieren sich im obligaten „modernen hellen Stahl/Glas-Look“, wo Beton vorherrscht - etwa in den Technik-Etagen - wird er mit dem Prädikat „nüchtern“ versehen. Bei einer neuen kuppelbaren Vierer-Sesselbahn in Corvara-Pedraces wird betont, daß es sich um „eine fast zierliche Talstation auf drei kompakten Ständern“ handelt – das Bild zeigt eine gläserne Hufeisen-Konstruktion (Firmendesign Seilbahnbau Leitner), die von einem grauen Steher hochgestemmt wird und die, neben dem hausbackenen Pultdach-Häuschen der alten Anlage geradezu futuristisch wirkt.10 Auch die Architekturkritik schätzt das Cool-Technoide eines Anlagenbaues, der die an der Transportfunktion orientierte Formen- und Materialsprache nicht verleugnet. „Die Hochbrixen-Bahn wird als architektonisch verfeinerter Industriebau aufgefaßt“, schrieb etwa Walter M. Chramosta über eine 1986/87 in Brixen im Thale errichtete Gondelbahn (Entwurf der Stationsgebäude: Karl Heinz, Dieter Mathoi, Jörg Streli), deren obere Sektion sich „von den regionalen Traditionen weitgehend unberührt und als durchgeformte Konstruktion auf der Höhe der Zeit (zeigt) – sachlich expressiv, gestalterisch verknappt, kühl instrumentiert“.11 Eine Zwischenstation ist etwa als fast frei schwebendes Tonnendach in Aluminium ausgeführt.
Eine Stichprobe anhand der wichtigsten Architekturzeitschriften Deutschlands, Österreichs und der Schweiz zeigt allerdings, daß Seilbahnen und alpine Freizeitbauten nur sehr selten kritisch gewürdigt werden. Wenn eine Anlage auf so positives Echo in der Architekturpublizistik stößt wie die 1989/90 errichtete Festkogelbahn in Obergurgl, handelt es sich also um einen Ausnahmefall. Bei dieser Gondelbahn sind beide oben beschriebenen Trends ablesbar: Die wuchtige Talstation läßt in ihrer skulpturalen Rundturm-Gestaltung die Bautradition der Zwischenkriegs-Moderne ebenso anklingen wie regionale Motive (allerdings mit Glas anstelle von Holz), die Bergstation dagegen erscheint als pure technoide Skulptur aus Metall, Glas und Wellblech, die, auf einem Stahlbetonsockel ruhend, ziemlich beschwingt und selbstbewußt ins baumlose Gelände gesetzt ist. In einer Projektbeschreibung deutet der Architekt Peter Thurner an, daß seine Überlegungen sehr eng mit den funktionalen Erfordernissen der neuen Seilbahn-Technologie verzahnt waren. Zum Beispiel benötigt der zur Zeit vorherrschende Typus der einkuppelbaren Kleingondelbahn relativ große Baukörper, weil in den Bahnhöfen 105 Gondeln untergebracht werden müssen (und zusätzlich etliche Pistengeräte): „Die Bewältigung dieser Volumen in bezug zu Landschaft und zum Gelände war das Thema der Bauaufgabe.“12 Zugleich wollten Thurner und seine Mitarbeiter das „Erlebnis Berg“ aktuell thematisieren und mit ihrer Material- und Formenwahl andeuten, daß unser Dasein „spannend, freudvoll und lebenswert“ sein soll.
Damit ist eine Dimension angesprochen, die der Hauptgrund für die auffällige Abstinenz der „ernsthaften“ Architektur- und Designkritik zu sein scheint: In der Freizeitgestaltung geht es vor allem um „fun“, das Skigelände ist längst zu einem hochalpinen Vergnügungspark geworden, dem mit dem Einsamkeits- und Ergriffenheitsvokabular aus der Frühzeit des alpinen Bauens längst nicht mehr beizukommen ist. Wer mit sündteuren Tages- oder Wochenkarten einen Skizirkus betritt, erwartet Spektakel und Effizienz - zugleich aber auch, und darin liegt natürlich eine tendenzielle Verlogenheit, einen Mindeststandard von Naturverträglichkeit, zumindest auf rhetorischer Ebene. Die Bergtechnik-Industrie hat diesen Wunsch nach Harmonie bei gleichzeitiger Gier nach extremen Erlebnissen längst internalisiert. Der Satz, daß eine neue Bahn sich „harmonisch in die Landschaft einfügt“, ist längst zum Stehsatz der Werbetexter geworden.
Zunehmende Gestaltungsqualität
Wie ambivalent das Gegensatzpaar „Umweltschutz“ und „Alpenerschließung“ miteinander in Verbindung steht, kann hier nur angedeutet werden. Seit Bergbahnprojekte mit Fundamentalopposition rechnen müssen, kann etwa die objektiv durchaus zunehmende Gestaltungsqualität in der massenmedialen Diskussion kaum mit Echo rechnen. Die Betreiber belassen es zumeist dabei, eher still und heimlich ihre enorm gesteigerten Beförderungskapazitäten bekannt zu machen und ihre Hardware ansonsten eher hinter verniedlichenden Metaphern wie der von den „optischen Samtpfoten“ und der „naturnahen Harmonie“ zu verbergen. Daß sich ein Bergbahnmanagement wie das der Montafoner Golmerbahn auf das durchaus radikale und „auffällige“ Farbkonzept eines Künstlers einläßt (wobei Karl-Heinz Ströhles Farbprogramm die unterschiedlichen Konstruktionselemente der Stationsgebäude als reduktiven Kontext akzeptiert), zeigt einen möglichen Befreiungsschritt aus einem Verhalten der Halbherzigkeit.13 Andererseits haben Seilbahnmoratorien wie etwa in Nordtirol, die zu einem vorübergehenden Stop von neuen Bergbahnprojekten führten, zu einer Verdichtung bestehender Skigebiete geführt, etwa durch den Bau von parallel geführten Zweitliften oder die Umrüstung auf leistungsstärkere Systeme. Diese Konzentration auf relativ wenige hochgerüstete Top-Gebiete macht ökologisch durchaus Sinn (wenn auch zahlreiche kleine Liftbetreiber in tieferen Regionen die unmittelbaren Opfer sind), zwingt allerdings zu einem mentalen Quantensprung: Ein Skigebiet wie St.Moritz/Corviglia/Piz Nair, Davos/Parsenn/ Weißfluh oder St.Anton/Galzig/Valluga ist eben nicht länger ein Stück Natur, in der tapfere Sportler vordringen, sondern nichts anderes als ein hochgelegener Sportplatz und Freizeitpark mit besonders imposanten Rahmenbedingungen. Interpretiert man das Fit & Fun-Gelände auf diese Weise, so erscheint ein gestalterisches Komplettensemble vor unseren Augen, das wir alle kennen (und teilweise auch schätzen), für das aber noch das Beschreibungsvokabular zu fehlen scheint. Sicher, man kann die einander in verschiedener Höhe kreuzenden Seile unterschiedlicher Bergbahnen (wie etwa auf dem Davoser Weißfluhjoch) mit den wahnwitzigen Straßenüberführungen von Los Angeles vergleichen, doch verfehlt dieses allzu polemische Bild die tatsächliche Absurdidät einer Situation, in der sich der Wunsch nach Freiheit mit dem der totalen Domestizierung mannigfach überkreuzt. Die Pistenbegrenzungs-Markierungen, stets in Leuchtfarbe und oft exzentrisch geformt, fallen ebenso unter einen erweiterten Design-Begriff wie künstlich angelegte Buckelpisten, die opulente Farbenvielfalt der nach neuester Sportmode gekleideten Skisportler (bzw. Wanderer) ebenso wie die düsteren Schlabber-Outfits der Funboard-Subkultur, die ins Nichts ragende riesige Landerampe der Bergstation der 4er-Sesselbahn ebenso wie die durch elektronische Skipaß-Lesung völlig neue Zugangs-Logistik bei der Talstation.
Zunehmend setzt auch die Werbung raffiniertere Akzente, etwa durch graphisch gestaltete Heißluftballons neben der Talstation oder durch aufblasbare Riesen-Bierflaschen, mit denen weithin sichtbare Zeichen für Gletscherbars in Toplage gesetzt werden. Noch ist nicht abzusehen, welche Folgen die aufblasbare Milka-Kuh, die seit letzter Saison den Zuschauern von TV-Übertragungen von Skirennen ins Haus geliefert wird und
die zu durchaus amüsanten Umdeutungen der realen Größen- und Naturverhältnisse einlädt, auf die künftige Landschaftswahrnehmung und alpine Bautätigkeit haben wird. Möglicherweise wird man, frei nach Robert Venturis „Learning from Las Vegas“, sagen müssen: „the Milka cow is just alright“.
Und die hochalpinen Freizeitterrains sind nichts anderes als riesige kinetische Skulpturen, die wechselnden Moden unterworfen sind.
Fußnoten:
1 Widersprüchlich war das Eroberungspathos der Seilbahnfahrt vor allem deshalb, weil es sich um einen Anstieg ohne Anstrengung handelte. Damit erschien sie den Ideologen des muskelstrammen Alpinismus, der auf individueller Heroik begründet war, als Verrat. Nicht allein aus Gründen des Naturschutzes wurde etwa in den zwanziger Jahren von den Alpinvereinen der Bau von Seilbahnen bekämpft, sondern vor allem, weil nun ein Massenpublikum bequem auf die Gipfel gelangen konnte. Die Seilbahnkritik der Pionierjahre des Seilbahnbaues „stellte meist die um den Preis des Verlustes eines individuellen Erlebnisses erkaufte Popularisierung in den Mittelpunkt“. Vgl. Bernhard
Tschofen, Aufstiege - Auswege. Skizzen zu einer Symbolgeschichte des Berges im 20. Jahrhunderts. In: Zeitschrift für Volkskunde, 89. Jg., 1993/II, S. 225.
2 Friedrich Achleitner (1980), Österreichische Architektur im 20. Jahrhundert, Band 1. Salzburg/Wien 1980, S. 224
3 Bernhard Tschofen, Die Seilbahnfahrt. Gebirgswahrnehmung zwischen klassischer Alpenbegeisterung und moderner Ästhetik. In: Burkhard Pöttler/Ulrike Kammerhofer-Aggermann (Hg.). Tourismus und Regionalkultur. Referate der österreichischen Volkskundetagung 1992 in Salzburg. Wien, S. 117.
4 Die Schweizer Liftkontrollstelle IKSS in Thun konnte im Winter 1995/96 nur mehr drei neue Schlepplifte technisch abnehmen. Zugleich wurden sechs bestehende Schlepper durch Sessel- oder Kabinenbahnen ersetzt und 24 abgebrochen. In: Motor im Schnee. Zeitschrift für Berg- und Wintertechnik und bergtouristisches Management, 27. Jg., Januar/Februar 1996, S. 7 („Das Schleppliftsterben geht weiter“.).
5 Vgl. Kos, Wolfgang (1995), Das Alpine schlug zurück. Kulturgeschichtliche Anmerkungen zur verschollenen Urbanität im alpinen Tourismusbau. In: Architektur im 20. Jahrhundert – Österreich. München/New York 1995, S. 66ff.
6 Hotelarchitektur in den Alpen/Architettura alberghiera nelle alpi 1920 - 1940. Ausstellungskatalog der Veranstaltungsreihe Sexten Kultur, Sexten/Sesto 1989, S. 5. Alle genannten Hotelbeispiele stammen aus diesem Buch, dem inzwischen zahlreiche ähnliche Versuche folgten, die verschollene Moderne in den Alpen zu dokumentieren.
7 Hektographierter Jurytext, verfaßt von Dietmar Steiner.
8 Wie widersprüchlich die aktuelle Situation ist, zeigt sich allerdings daran, daß einerseits räumliche Großzügigkeit forciert wird – Stichwort Panoramaerlebnis –, daß aber andererseits die großen Hallen der Bergrestaurants zunehmend „gemütlichen“ Stuben bzw. einer Kojenarchitektur weichen müssen.
9 Einzigartige Zwillingsbahn. Garaventa eröffnet Nadelöhr zum Berg. Neue Dimensionen im Seilbahnbau. In: Motor im Schnee, 27. Jg, Januar/Februar 1996, S.15ff.
10 Ebd., S. 26
11 Tirol-Werbung (Hg.) (1994): Bauen für Gäste.
Beispiele alpiner Freizeitarchitektur in Tirol, Innsbruck 1994, S. 36.
12 Erlebnis Bergbahn. Festkogelbahn Obergurgl. In: Architektur aktuell 168, Wien 1994, S. 56ff.
13 Allerdings kommt auch die Golmerbahn nicht ohne die Floskel, daß sich die modern konzipierten Stationsgebäude „harmonisch in die Landschaft (einfügen)“, nicht aus. Vgl. Luger, Gerhart J. (1995), Die neue Golmerbahn - eine bedeutende Investition für den Tourismus im Montafon. In: VIW Werkzeitschrift 2-3, S. 12 ff.
Dr. Wolfgang Kos ist Radioredakteur beim ORF (Diagonal, Musicbox, Popmuseum) und Historiker