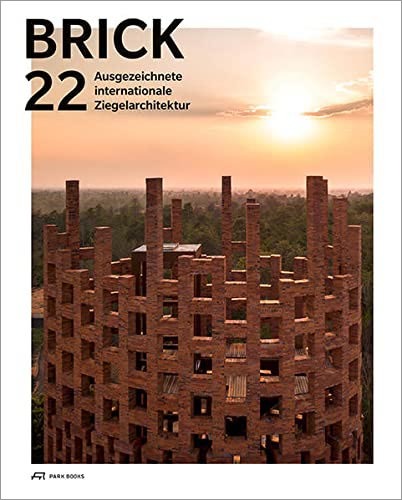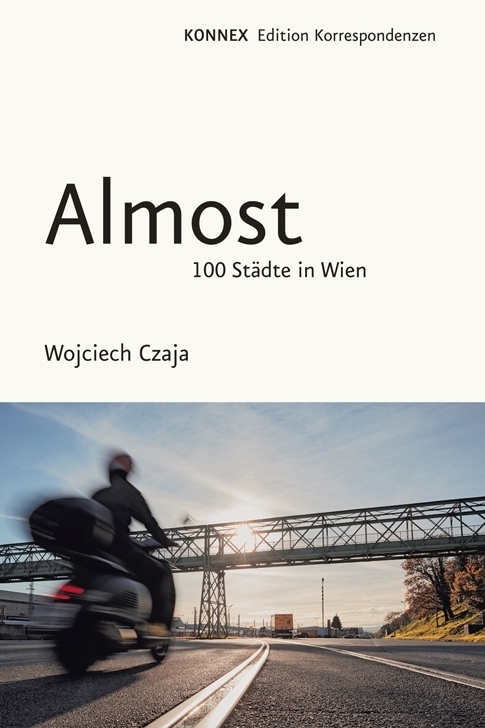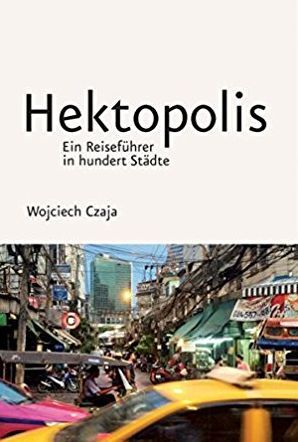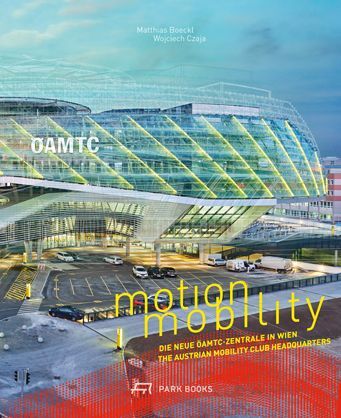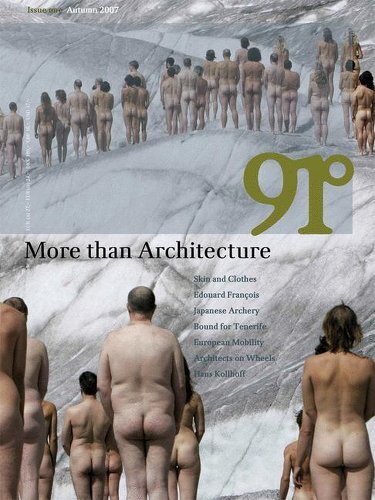Einfach schön
Wohnbau ist teuer, aufwendig und Resultat vieler, oftmals überzogener Normen. Die Initiative „Gebäudetyp E“ in Bayern beweist, dass man auf viele Baustandards verzichten kann. Zu Besuch im ersten realisierten Pilotprojekt in Ingolstadt.
Das Haus hat keinen Keller, keine vollwertige Heizung, keine draufgeklatschte Styropordämmung. Und auch sonst ist alles ein bisschen anders: In den Wohnungen gibt es einen robusten Terrakottaboden, ein bisschen Toskana-Feeling fürs kleine Portemonnaie, „qualcosa speciale, meno male“, dafür aber rohe Betondecken, weniger Steckdosen in den Wänden, keine Trittschalldämmung am Gang, eine Reduktion auf genau einen Fenster- und einen Terrassentür-Typ im ganzen Haus, Gärten und Gehwege aus Secondhand-Baustoffen – und überhaupt ziemlich wenig technischen Schnickschnack.
„Das ist unser Leuchtturmprojekt für einfaches Bauen“, sagt Joerg Koch, Abteilungsleiter Technik bei der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft Ingolstadt. „Das heißt: Wir umgehen viele Normen und technische Baustandards, indem wir sie einfach nicht erfüllen. Auf diese Weise können wir die Baukosten um rund zehn bis 15 Prozent reduzieren und den Menschen entsprechend günstigere Mieten anbieten. Die Mieter und Mieterinnen müssen nur bereit sein zu akzeptieren, dass sie in einem technischen Pionierprojekt wohnen und in diesem Haus manche Dinge ein wenig anders funktionieren, als sie es aus bisherigen Wohnsituationen vielleicht gewohnt sind.“
Das Umdenken bezieht sich einerseits auf die Ausstattung, andererseits auf die Bereitschaft, dass die Temperatur in den Wohnräumen an manchen klirrend kalten Wintertagen wie jetzt vielleicht einen Hauch zu kühl und an den paar unerträglichen Hitzetagen im Hochsommer womöglich ein, zwei Grad zu warm ist. Statt klassischer, im Wohnbau längst etablierter Dämm- und Heizungsstandards hat die gemeinnützige Baugenossenschaft nämlich eine Hohlblock-Ziegelfassade mit werksmäßig eingefüllter Holzzellulose-Dämmung sowie – um die eiskalten Temperaturspitzen abzufedern – unter den Terrakottaplatten eine Heizfolie mit 24-Volt-Elektroheizung eingebaut.
Bloß keinen Irrsinn bauen
„Mit seinen dicken, massiven Außenwänden und den wertvollen thermischen Emissionen der Menschen und Haushaltsgeräte ist das Haus in der Lage, die Abwärme zu speichern und im Jahresschnitt eine angenehme Innenraumtemperatur zu halten“, sagt Koch, der das Projekt in Anlehnung an das vom Vorarlberger Architekturbüro Baumschlager Eberle entwickelte Haustechnikkonzept „2226“ ohne klassischen sole- oder wassergefüllten Heizkreislauf realisierte. „Wozu bitte soll ich zwölf Monate lang mehr Miete zahlen, bedingt durch viel höhere Baukosten, nur um ein paar wenige ungemütliche Tage im Jahr zu umgehen? Wirtschaftlich und ressourcentechnisch betrachtet ist das völliger Irrsinn.“
Die Idee zur technischen Abspeckung, zu einer norm- und rechtsreduzierten Baupraxis im Wohnbau ist kein Einzelfall, sondern Resultat einer Initiative der Bayerischen Architektenkammer, des Bundesministeriums für Justiz und Verbraucherschutz sowie des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Das Modell, seit 2020 in Entwicklung, hört auf den Namen „Gebäudetyp E“, wobei das E für „Einfach“ steht, und sagt den rund 3500 DIN-Normen den Kampf an, die für das Bauen relevant sind und bei denen es sich de iure lediglich um Empfehlungen handelt, die erst durch Verträge und Verordnungen verbindlich werden.
Das „Haus fast ohne Heizung“, so der offizielle Titel, im Westen von Ingolstadt, geplant von nbundm* Architekten, ist das erste, bereits realisierte Pilotprojekt nach den Prinzipien des Gebäudetyps E. Drei Häuser befinden sich gerade in Bau, 15 weitere Wohn-, Büro- und Schulbauten, verstreut auf ganz Bayern, sind in Entwicklung. In Österreich arbeitet die Salzburger Zukunftsagentur Bau (ZAB) unter dem Titel „Bauen außerhalb der Norm“ an einer Art Ableger dieses Konzepts. Allein, die Behörden zeigen sich zurückhaltend, von Pilotprojekten keine Spur.
„Wir wollen mit diesem Projekt beweisen, dass Einfachheit rein gar nichts mit irgendeinem Verzicht auf Qualität und Ästhetik zu tun hat“, sagt Architekt Chris Neuburger, Gründungspartner bei nbundm*. „Durch das Weglassen von kostspieligen Material- und Haustechniklösungen können wir uns auf das konzentrieren, was fürs Wohnen wirklich relevant ist: Fläche, Ausblick, Schönheit, Leistbarkeit, Funktionalität, Bequemlichkeit und Raum zur persönlichen Entfaltung.“
Das „Haus fast ohne Heizung“ mit seinen massiven Ziegelwänden, seiner heu- und salbeigrün lasierten Lärchenfassade und seinen korallenrot lackierten Details an der Fassade ist ein ernstzunehmender Konkurrent zum sozialen Wiener Wohnbau, auf den die ganze Welt ob seiner sozialen Qualitäten neidisch ist, der architektonisch aber immer mehr zu einer programmatisch überladenen Stahlbetonkiste mit Styroporplatten und Plastikputz verkommt. In vielen Wohnhäusern, die in Österreich heute hingeklotzt werden, erkennt man kaum noch einen Unterschied zu den Plattenbauten der 1960er- und 1970er-Jahre.
Normengehorsam? Nein!
„Vorauseilender Rechts- und Normengehorsam verhindert Innovation“, sagt Technikleiter Koch in scharfen Worten. „Wir stellen keinen einzigen miet- oder sicherheitstechnischen Standard infrage, da gibt es keinerlei Kompromiss! Wir hinterfragen nur, was normativer Schwachsinn ist, wo die Industrielobby aus ökonomischen Eigeninteressen heraus völlig überzogene Standards hineinreklamiert hat, die immer schärfer werden – und da sagen wir Nein.“ Wer trägt die Verantwortung, falls irgendwas passiert, falls irgendwer auf die Barrikaden steigen sollte? „Wir. Aber das ist bislang nur eine hypothetische Frage.“
Einer der ersten Mieter im Haus ist Sergiy Baldzer. Gemeinsam mit seiner Familie wohnt er in einer geförderten Erdgeschoßwohnung mit Garten und Terrasse. „Meine Frau ist im Internet über das Projekt gestolpert. Ich bin ein Technik-Freak, mich hat das Konzept sofort neugierig gemacht. Wozu soll man überall das Maximum einbauen, wenn man auch mit weniger auskommen kann? Also haben wir uns gedacht: Das probieren wir aus! Draußen liegen Schnee und Eis. Und ja, es funktioniert.“