Artikel
Bunte Tourismuswelt
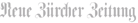
Architektonische und gestalterische Aspekte der Expo 2005 in Japan
Die neuste Weltausstellung, die derzeit in der japanischen Präfektur Aichi stattfindet, ist eine skurrile Mischung aus Jahrmarkt und ernsthaften Anliegen. Dabei wurde das Thema der Expo, «die Weisheit der Natur», von fast allen Teilnehmern ignoriert.
7. Juni 2005 - Ulf Meyer
Mit dem Ausruf «Sugoi!» (etwa: super!) reagieren Japaner auf alles, was ihre Aufmerksamkeit erregt. Diesen «Sugoi-Faktor» möglichst oft zu erzeugen, ist Ziel der internationalen Aussteller auf der neusten Weltausstellung, die Ende März in der nahe Nagoya auf halbem Weg zwischen Tokio und Osaka gelegenen japanischen Präfektur Aichi eröffnet wurde. Wie ihre Vorgängerinnen ist auch diese Expo eine Mischung aus Jahrmarkt und ernsthaften Anliegen. Das Thema der Expo, «die Weisheit der Natur», wurde von fast allen Teilnehmern hartnäckig ignoriert. Der «Menschenzoo» der Nationalpavillons, der vor Anbruch des Zeitalters des Massentourismus traditionell die Hauptattraktion einer Weltausstellung war, ist auch in Aichi noch zentral: Die 120 Länderpräsentationen sollten nach Wunsch der Veranstalter eine «interkulturelle Symphonie» ergeben, kommen tatsächlich jedoch kaum über das Niveau einer Tourismusmesse hinaus. Der nordische Gemeinschaftspavillon zum Beispiel entspricht den Erwartungen der Besucher, indem er mit Wasser, hellem Holz und skandinavischem Design eine unaufdringliche, aber dennoch unverkennbar nordische Atmosphäre verbreitet. Die Niederlande haben ihren Pavillon mit riesigen blau-weissen Fliesen und orangefarbenen Blumen geschmückt. Da fehlen nur noch Holzschuh und «Kaaskunst» als nationale Stereotypen.
Dekorierte Schuppen
Das Zeitalter der Weltausstellungen als beendet zu erklären, wäre dennoch voreilig, auch wenn die Expo 2000 in Hannover gemessen an den Erwartungen der Veranstalter ein Flop war und daraufhin die für 2004 in Paris geplante Weltausstellung kurzerhand abgesagt wurde. Die wichtigste Attraktion der Expo in Hannover vor fünf Jahren, die nationale Selbstdarstellung durch Architektur, kommt in Aichi jedoch zu kurz, denn die «Nationenpavillons» sind bei kleineren, thematischen Weltausstellungen, zu denen Aichi zählt, jeweils nicht mehr als «dekorierte Schuppen». Das liegt daran, dass hier - wie etwa 1998 in Lissabon - die einzelnen Länder sich in vorfabrizierten Hallen einrichten mussten. Diese konnten sie lediglich innen und aussen gestalten. Dadurch wurden manche Aussteller dazu verleitet, die Besucher rein medialen Reizen auszusetzen.
So präsentiert die Schweiz eine Bergwelt, in deren Innerem die mit Taschenlampen ausgestatteten Besucher auf Entdeckungsreise durch die Mythenwelt gehen und schliesslich einen Blick aufs Matterhorn erhaschen können. Zeitgenössische Schweizer Gestaltungskunst findet sich nur im Café, einem Musterbeispiel für den weltweit anerkannten Schweizer Minimalismus. Auch Österreich dienen hohe Berge als Erkennungszeichen. Trecolore Architects haben einen hölzernen Rodelberg gebaut mit Walzertanzsaal und Wiener Kaffeehaus. Deutschland demonstriert zusammen mit Frankreich in einem grossen Doppelpavillon deutsch-französische Freundschaft, wobei im französischen Teil mittels eines Haus- im-Haus-Konzepts mit Fassaden aus hinterleuchteten Salztafeln ein eindrucksvoller Raum präsentiert wird. Andere Nationen setzten stärker auf Architektur: So hat Alejandro Zaera-Polo den spanischen Pavillon mit einer farbenfrohen und geometrisch raffinierten Fassade aus Keramik- Hexagonen fotogen verkleidet. Denn das Wichtigste für die Japaner sind möglichst exotisch wirkende Fotosujets. Die Besucher lassen sich denn auch gerne mit grossen Sombreros vor dem mexikanischen Pavillon oder neben Vertretern der kanadischen Gendarmerie in ihren schmucken, roten Uniformen ablichten.
Das Privileg, eigene Pavillons bauen zu dürfen, blieb den japanischen Konzernen und Gebietskörperschaften vorbehalten, und die haben regen Gebrauch davon gemacht: Der japanische Nationalpavillon wurde in Form einer halben Erdnussschale vollständig aus kompostierbaren Materialien - Bausteinen aus Biomasse und Bambusgras - gebaut. Überdacht ist der Pavillon von einfachen Bambusmatten. Der Turm, den die Stadt Nagoya nebenan errichtet hat, will hingegen nicht als ökologisches Vorzeigeprojekt, sondern als Spielerei punkten: In ihm befindet sich ein riesiges Kaleidoskop, das mit optischen Effekten verführt.
Neue Roboter
Richtig «sugoi» sind für das japanische Publikum die omnipräsenten Roboter. Bereits arbeitet man an Maschinen, die zukünftig in der schnell alternden japanischen Gesellschaft die Betagten pflegen sollen. Noch aber verursachen die Roboter mehr Arbeit, als sie dem Menschen abnehmen: Die überall auf dem Expogelände herumschwirrenden Menschmaschinen werden von Hostessen begleitet, die zwischen ihnen und den Neugierigen vermitteln. Der Traum von den bienenfleissigen und anspruchslosen Helfern wird in Japan allerdings schon seit Generationen geträumt: Bereits auf der ersten japanischen Expo, die 1970 in Osaka stattfand, waren sie ein grosses Thema. Eine klare Aussage wie damals, als Japan zur wirtschaftlichen Supermacht aufstieg, fehlt der Weltausstellung von Aichi. Bis zum Ende der Expo am 25. September werden dennoch 15 Millionen Besucher in Aichi erwartet, die hier Technik, Design und Architektur bewundern werden.
Nach Osaka waren 1970 allerdings 65 Millionen Neugierige geströmt. Die Expo 70 war nicht nur die erste ausserhalb der westlichen Welt. Sie war darüber hinaus auch für die Entwicklung einer eigenständigen japanischen Architekturmoderne zentral. Auch die Auftritte der Schweiz und anderer europäischer Länder konnten damals weit ambitionierter gestaltet werden, da es sich um eine grosse, umfassende Weltausstellung handelte. Die nächste Gelegenheit zu einer wirklichen architektonischen Selbstdarstellung werden die Länder der Welt erst wieder in fünf Jahren haben. Dann wird in Schanghai eine Weltausstellung «erster Klasse» eröffnet. Und die aufstrebende chinesische Wirtschaftskapitale ist heute schon «sugoi» - nicht nur in Japan.
Dekorierte Schuppen
Das Zeitalter der Weltausstellungen als beendet zu erklären, wäre dennoch voreilig, auch wenn die Expo 2000 in Hannover gemessen an den Erwartungen der Veranstalter ein Flop war und daraufhin die für 2004 in Paris geplante Weltausstellung kurzerhand abgesagt wurde. Die wichtigste Attraktion der Expo in Hannover vor fünf Jahren, die nationale Selbstdarstellung durch Architektur, kommt in Aichi jedoch zu kurz, denn die «Nationenpavillons» sind bei kleineren, thematischen Weltausstellungen, zu denen Aichi zählt, jeweils nicht mehr als «dekorierte Schuppen». Das liegt daran, dass hier - wie etwa 1998 in Lissabon - die einzelnen Länder sich in vorfabrizierten Hallen einrichten mussten. Diese konnten sie lediglich innen und aussen gestalten. Dadurch wurden manche Aussteller dazu verleitet, die Besucher rein medialen Reizen auszusetzen.
So präsentiert die Schweiz eine Bergwelt, in deren Innerem die mit Taschenlampen ausgestatteten Besucher auf Entdeckungsreise durch die Mythenwelt gehen und schliesslich einen Blick aufs Matterhorn erhaschen können. Zeitgenössische Schweizer Gestaltungskunst findet sich nur im Café, einem Musterbeispiel für den weltweit anerkannten Schweizer Minimalismus. Auch Österreich dienen hohe Berge als Erkennungszeichen. Trecolore Architects haben einen hölzernen Rodelberg gebaut mit Walzertanzsaal und Wiener Kaffeehaus. Deutschland demonstriert zusammen mit Frankreich in einem grossen Doppelpavillon deutsch-französische Freundschaft, wobei im französischen Teil mittels eines Haus- im-Haus-Konzepts mit Fassaden aus hinterleuchteten Salztafeln ein eindrucksvoller Raum präsentiert wird. Andere Nationen setzten stärker auf Architektur: So hat Alejandro Zaera-Polo den spanischen Pavillon mit einer farbenfrohen und geometrisch raffinierten Fassade aus Keramik- Hexagonen fotogen verkleidet. Denn das Wichtigste für die Japaner sind möglichst exotisch wirkende Fotosujets. Die Besucher lassen sich denn auch gerne mit grossen Sombreros vor dem mexikanischen Pavillon oder neben Vertretern der kanadischen Gendarmerie in ihren schmucken, roten Uniformen ablichten.
Das Privileg, eigene Pavillons bauen zu dürfen, blieb den japanischen Konzernen und Gebietskörperschaften vorbehalten, und die haben regen Gebrauch davon gemacht: Der japanische Nationalpavillon wurde in Form einer halben Erdnussschale vollständig aus kompostierbaren Materialien - Bausteinen aus Biomasse und Bambusgras - gebaut. Überdacht ist der Pavillon von einfachen Bambusmatten. Der Turm, den die Stadt Nagoya nebenan errichtet hat, will hingegen nicht als ökologisches Vorzeigeprojekt, sondern als Spielerei punkten: In ihm befindet sich ein riesiges Kaleidoskop, das mit optischen Effekten verführt.
Neue Roboter
Richtig «sugoi» sind für das japanische Publikum die omnipräsenten Roboter. Bereits arbeitet man an Maschinen, die zukünftig in der schnell alternden japanischen Gesellschaft die Betagten pflegen sollen. Noch aber verursachen die Roboter mehr Arbeit, als sie dem Menschen abnehmen: Die überall auf dem Expogelände herumschwirrenden Menschmaschinen werden von Hostessen begleitet, die zwischen ihnen und den Neugierigen vermitteln. Der Traum von den bienenfleissigen und anspruchslosen Helfern wird in Japan allerdings schon seit Generationen geträumt: Bereits auf der ersten japanischen Expo, die 1970 in Osaka stattfand, waren sie ein grosses Thema. Eine klare Aussage wie damals, als Japan zur wirtschaftlichen Supermacht aufstieg, fehlt der Weltausstellung von Aichi. Bis zum Ende der Expo am 25. September werden dennoch 15 Millionen Besucher in Aichi erwartet, die hier Technik, Design und Architektur bewundern werden.
Nach Osaka waren 1970 allerdings 65 Millionen Neugierige geströmt. Die Expo 70 war nicht nur die erste ausserhalb der westlichen Welt. Sie war darüber hinaus auch für die Entwicklung einer eigenständigen japanischen Architekturmoderne zentral. Auch die Auftritte der Schweiz und anderer europäischer Länder konnten damals weit ambitionierter gestaltet werden, da es sich um eine grosse, umfassende Weltausstellung handelte. Die nächste Gelegenheit zu einer wirklichen architektonischen Selbstdarstellung werden die Länder der Welt erst wieder in fünf Jahren haben. Dann wird in Schanghai eine Weltausstellung «erster Klasse» eröffnet. Und die aufstrebende chinesische Wirtschaftskapitale ist heute schon «sugoi» - nicht nur in Japan.
Für den Beitrag verantwortlich: Neue Zürcher Zeitung
Ansprechpartner:in für diese Seite: nextroom






