Artikel
Architekturspektakel im Heiligen Land
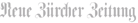
Baukünstler aus aller Welt entdecken Israel
Nach der Cymbalista-Synagoge von Mario Botta und dem Palmach-Museum von Zvi Hecker beweist Tel Aviv mit zwei formal ambitionierten Neubauten einmal mehr, dass qualitätvolle Architektur in Israel auf Interesse stösst. Es handelt sich dabei um Daniel Libeskinds Wohl Center der Bar-Ilan-Universität und Moshe Safdies Rabin Center.
15. Dezember 2005 - Ulf Meyer
Mit der für das Jahr 2008 geplanten Eröffnung von Frank O. Gehrys Museum der Toleranz in Jerusalem soll der «Bilbao-Effekt» auch in Israel zur Wirkung kommen. Aber bereits heute ist das Heilige Land ein beliebtes Tätigkeitsfeld für Baukünstler aus aller Welt. Das beweisen nach der Cymbalista-Synagoge von Mario Botta und dem Palmach-Museum von Zvi Hecker zwei weitere Projekte in Tel Aviv, die jüngst fertiggestellt worden sind: das Rabin Center von Moshe Safdie und das Wohl Center von Daniel Libeskind.
Ausländische Mäzene
Das Ende Oktober feierlich eingeweihte Wohl Center ist Libeskinds erstes Gebäude in Israel. Es steht auf dem neuen Nord-Campus der religiösen Bar-Ilan-Universität in Ramat Gan, einem längst mit Tel Aviv zusammengewachsenen Vorort der Mittelmeermetropole. Mit seinem «Stimmen und ihre Echos» genannten Entwurfskonzept wollte Libeskind die beiden Komponenten der als Bauherrin auftretenden Universität verbinden: das Säkulare und das Religiöse. Zugleich sollten mit architektonischen Mitteln «die Dynamik des Wissens und die vereinheitlichende Rolle des Glaubens ausgedrückt werden», wie es der Architekt mit der für ihn typischen Eloquenz nennt. Das 900 Sitze bietende Auditorium kragt weit über den Eingang des wie zersplittert erscheinenden Wohl Center aus. Ebenso spektakulär wie die dramatischen Bauformen sind die Fassaden mit ihren golden schimmernden Metallstreifen und expressiv gezackten Fenstern. Damit erinnert das von der Maurice and Vivienne Wohl Charitable Foundation gestiftete Gebäude unweigerlich an Libeskinds Jüdisches Museum Berlin, das bis anhin - nach seinem Misserfolg bei der Wiederaufbauplanung für Ground Zero in New York - das bedeutendste Werk des Architekten darstellt.
Ebenfalls ausländischem Mäzenatentum ist der zurzeit am hitzigsten diskutierte Neubau in Israel zu verdanken: das Yitzhak Rabin Center for Israel Studies, das unlängst anlässlich des 10. Jahrestags der Ermordung des einstigen israelischen Premierministers in Tel Aviv eingeweiht werden konnte. Entworfen wurde es von dem in Boston tätigen Moshe Safdie, der lange schon zu den einflussreichsten Architekten in Israel zählt. Als ehemaliger Freund Rabins wurde er von dessen Witwe mit der Planung und dem Bau des Zentrums beauftragt, nachdem er zuvor schon das Doppelgrab der Rabins entworfen hatte.
Safdies Neubau befindet sich am Rande eines Militärgeländes im nördlich der Innenstadt gelegenen Vorort Ramat Aviv. Durch seine Lage an Israels wichtigster Autobahn kann er täglich von Hunderttausenden von Verkehrsteilnehmern gesehen werden. Unter dem Hanggrundstück im Ha-Yarkon-Park, wo er sich erhebt, war in den fünfziger Jahren ein geheimes Notkraftwerk gebaut worden. Dieses lange schon aufgegebene unterirdische Kraftwerk liess Safdie nun mit einer monumentalen Sandsteinwand verkleiden. Das Rabin Center selbst besteht aus zwei Seitentrakten, die von weissen, organisch geformten Dächern bekrönt werden, und einer zweistöckigen Arkade, hinter der sich das Museum und das Forschungszentrum befinden. Die Schalendächer erinnern an die Flügel einer Friedenstaube und bestehen aus Schaumstoff, der durch einen mit Glasfasern verstärkten Überzug aus Polyester verkleidet wurde. Zu Füssen der Seitentrakte liegen der Clinton- und der Hussein-Garten.
Mit der Lea-Rabin-Halle auf der einen und der Bibliothek auf der anderen Seite verbindet das Zentrum «Erinnerung und historische Aufarbeitung, um Leben und Vermächtnis von Rabin als Soldat, Staatsmann, Sozialreformer und Visionär darzustellen». Im unteren Teil des Baus kommt Rabin als Kämpfer, im oberen aber als Diplomat und Vermittler zu Ehren. Räumlich am interessantesten ist das Rabin-Museum, das in der Form einer spiralförmigen Rampe konzipiert wurde. Mehrere Galerien gruppieren sich wie ein Schneckenhaus um diese Spirale und führen den Besucher fast wie im New Yorker Guggenheim Museum in die Tiefe, wo eine archaisch-schwere, säkulare «Klagemauer» an den grossen Politiker erinnert.
Fehlende Architekturtradition
Anlässlich der Eröffnung des Rabin Center kritisierte Safdie, dass es in Israel keinen respektvollen Umgang mit wichtigen Bauwerken gebe und diese auch nicht gepflegt würden. Das liege daran, dass die israelische Nation noch jung sei und den meisten Leuten ein Interesse an Denkmalschutz fehle. Er hoffe aber, dass sich Israel auf die Zeiten zurückbesinnen werde, als das Land ein blühendes Zentrum der mediterranen Moderne gewesen sei. Gute Bauherren sind Safdies Meinung nach in Israel schwer zu finden. Umso wichtiger sei daher das Engagement von ausländischen Gönnern und Stiftungen. Zu diesen zählt das Simon Wiesenthal Center in Los Angeles: Das von ihm in Auftrag gegebene Museum der Toleranz wird von Gehry nahe der Altstadt von Jerusalem aus lokal vorkommendem Kalkstein und blauen Titanplatten errichtet - mit spektakulär geschwungenen Bauteilen, in denen Theater, Konferenzzentrum und Bildungsräume ineinander verkeilt werden. Für das umstrittene Projekt ist allerdings bis jetzt erst ein Drittel der Baukosten gespendet worden.
Ausländische Mäzene
Das Ende Oktober feierlich eingeweihte Wohl Center ist Libeskinds erstes Gebäude in Israel. Es steht auf dem neuen Nord-Campus der religiösen Bar-Ilan-Universität in Ramat Gan, einem längst mit Tel Aviv zusammengewachsenen Vorort der Mittelmeermetropole. Mit seinem «Stimmen und ihre Echos» genannten Entwurfskonzept wollte Libeskind die beiden Komponenten der als Bauherrin auftretenden Universität verbinden: das Säkulare und das Religiöse. Zugleich sollten mit architektonischen Mitteln «die Dynamik des Wissens und die vereinheitlichende Rolle des Glaubens ausgedrückt werden», wie es der Architekt mit der für ihn typischen Eloquenz nennt. Das 900 Sitze bietende Auditorium kragt weit über den Eingang des wie zersplittert erscheinenden Wohl Center aus. Ebenso spektakulär wie die dramatischen Bauformen sind die Fassaden mit ihren golden schimmernden Metallstreifen und expressiv gezackten Fenstern. Damit erinnert das von der Maurice and Vivienne Wohl Charitable Foundation gestiftete Gebäude unweigerlich an Libeskinds Jüdisches Museum Berlin, das bis anhin - nach seinem Misserfolg bei der Wiederaufbauplanung für Ground Zero in New York - das bedeutendste Werk des Architekten darstellt.
Ebenfalls ausländischem Mäzenatentum ist der zurzeit am hitzigsten diskutierte Neubau in Israel zu verdanken: das Yitzhak Rabin Center for Israel Studies, das unlängst anlässlich des 10. Jahrestags der Ermordung des einstigen israelischen Premierministers in Tel Aviv eingeweiht werden konnte. Entworfen wurde es von dem in Boston tätigen Moshe Safdie, der lange schon zu den einflussreichsten Architekten in Israel zählt. Als ehemaliger Freund Rabins wurde er von dessen Witwe mit der Planung und dem Bau des Zentrums beauftragt, nachdem er zuvor schon das Doppelgrab der Rabins entworfen hatte.
Safdies Neubau befindet sich am Rande eines Militärgeländes im nördlich der Innenstadt gelegenen Vorort Ramat Aviv. Durch seine Lage an Israels wichtigster Autobahn kann er täglich von Hunderttausenden von Verkehrsteilnehmern gesehen werden. Unter dem Hanggrundstück im Ha-Yarkon-Park, wo er sich erhebt, war in den fünfziger Jahren ein geheimes Notkraftwerk gebaut worden. Dieses lange schon aufgegebene unterirdische Kraftwerk liess Safdie nun mit einer monumentalen Sandsteinwand verkleiden. Das Rabin Center selbst besteht aus zwei Seitentrakten, die von weissen, organisch geformten Dächern bekrönt werden, und einer zweistöckigen Arkade, hinter der sich das Museum und das Forschungszentrum befinden. Die Schalendächer erinnern an die Flügel einer Friedenstaube und bestehen aus Schaumstoff, der durch einen mit Glasfasern verstärkten Überzug aus Polyester verkleidet wurde. Zu Füssen der Seitentrakte liegen der Clinton- und der Hussein-Garten.
Mit der Lea-Rabin-Halle auf der einen und der Bibliothek auf der anderen Seite verbindet das Zentrum «Erinnerung und historische Aufarbeitung, um Leben und Vermächtnis von Rabin als Soldat, Staatsmann, Sozialreformer und Visionär darzustellen». Im unteren Teil des Baus kommt Rabin als Kämpfer, im oberen aber als Diplomat und Vermittler zu Ehren. Räumlich am interessantesten ist das Rabin-Museum, das in der Form einer spiralförmigen Rampe konzipiert wurde. Mehrere Galerien gruppieren sich wie ein Schneckenhaus um diese Spirale und führen den Besucher fast wie im New Yorker Guggenheim Museum in die Tiefe, wo eine archaisch-schwere, säkulare «Klagemauer» an den grossen Politiker erinnert.
Fehlende Architekturtradition
Anlässlich der Eröffnung des Rabin Center kritisierte Safdie, dass es in Israel keinen respektvollen Umgang mit wichtigen Bauwerken gebe und diese auch nicht gepflegt würden. Das liege daran, dass die israelische Nation noch jung sei und den meisten Leuten ein Interesse an Denkmalschutz fehle. Er hoffe aber, dass sich Israel auf die Zeiten zurückbesinnen werde, als das Land ein blühendes Zentrum der mediterranen Moderne gewesen sei. Gute Bauherren sind Safdies Meinung nach in Israel schwer zu finden. Umso wichtiger sei daher das Engagement von ausländischen Gönnern und Stiftungen. Zu diesen zählt das Simon Wiesenthal Center in Los Angeles: Das von ihm in Auftrag gegebene Museum der Toleranz wird von Gehry nahe der Altstadt von Jerusalem aus lokal vorkommendem Kalkstein und blauen Titanplatten errichtet - mit spektakulär geschwungenen Bauteilen, in denen Theater, Konferenzzentrum und Bildungsräume ineinander verkeilt werden. Für das umstrittene Projekt ist allerdings bis jetzt erst ein Drittel der Baukosten gespendet worden.
Für den Beitrag verantwortlich: Neue Zürcher Zeitung
Ansprechpartner:in für diese Seite: nextroom






