Artikel
Umbau und Selbstfindung
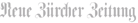
Städtebauliche Erneuerung im Zeichen des Sports - und darüber hinaus
Der 800 Millionen teure Umbau Turins soll dabei helfen, der Grossstadt - die mehr ist als eine Industriestadt - ein neues Selbstverständnis zu geben. Die Fabrikgelände werden nun urbanisiert, Zugpferd der Strukturänderung ist die Architektur.
30. Januar 2006 - Ulf Meyer
Von der Krise der italienischen Autoindustrie ist Turin, wo Fiat seinen Hauptsitz hat, unmittelbar betroffen. Das verstärkt den Minderwertigkeitskomplex, an dem die erste Hauptstadt des italienischen Königreichs leidet: Mailand ist wirtschaftlich, Rom politisch bedeutender, und Venedig ist schöner. Viele Touristen machten bisher einen Bogen um die «Industriestadt». Doch das könnte sich dank den Olympischen Winterspielen ändern. Denn für das sportliche Grossereignis ist ein 800 Millionen Euro teurer, nachhaltiger Stadtumbau in Gang gesetzt worden. Die Stadtverwaltung von Turin orientierte sich an Barcelona, wo 1992 vorgeführt wurde, wie man Olympische Spiele für urbanistische Interventionen nutzen kann, die sich bis in die Wohnviertel auswirken. Als südeuropäische Mittelstädte mit grossen Jugendstilvierteln und strengem Strassenraster ähneln sich die beiden Städte. Doch während die katalanische Kapitale durch ihr Städtebauprogramm «zurück ans Meer» wollte, möchte die piemontesische Metropole ihre Fabrikgelände urbanisieren und das Image der Industriestadt abschütteln.
Die kalte Pracht der Sportstätten
Zugpferd der Strukturänderung ist die Architektur. Ähnlich wie in Barcelona sind auch in Turin dezentrale Sportprojekte realisiert worden. Für die nichtalpinen Wettkämpfe wurden zwei Sporthallen renoviert: die Giovanni-Agnelli-Halle von Pier Luigi Nervi und das Stadio Communale. Der japanische Architekt Arata Isozaki hat den runden Betonbau von 1934 um eine eckige Halle erweitert. Deren eisige, horizontal geschlitzte Stahlfassade verweist auf die kalte Pracht im Inneren. Gleichwohl ist die Halle nicht so spektakulär ausgefallen wie Isozakis Sant-Jordi-Sportpalast in Barcelona. Den Turiner Bauherren ging es weniger um auffällige Bauten als vielmehr um chirurgische Eingriffe in das städtische Gewebe. Neu gebaut wurden nur der ovale «Palasport Velocità» für den Eisschnelllauf von HOK aus London und der Sportpalast im Industriegebiet Mirafiori. Die Eröffnungs- und die Schlusszeremonie der Spiele finden im Alpenstadion, der Heimat von «Juventus», statt. Das wichtigste Stadion der Stadt ist jedoch der hexagonale «Palazzo Vela» von Annibale und Giorgio Rigotti, in welchem die Eiskunstlauf- und Short-Track-Wettbewerbe abgehalten werden. Die Betonhalle mit über 150 Meter Spannweite am linken Ufer des Po wurde von Gae Aulenti und Arnaldo de Bernardi für die Spiele umgebaut.
Auch das alte Lingotto-Werk von Fiat erfuhr eine Aufwertung. Das 600 Meter lange Gebäude, auf dessen Dach Giacomo Matte Trucco die berühmte Versuchspiste anlegte, ist das Symbol des italienischen Industriebaus. Schon vor Jahren wurde es von Renzo Piano zum Hochschul-, Hotel-, Büro- und Einkaufszentrum umgebaut. Der Bolla genannte kugelförmige Konferenzraum auf dem Dach und die Pinakothek, in der Kunstwerke aus der Agnelli-Sammlung gezeigt werden, sind der sichtbarste Ausdruck der neuen Nutzung. Für die Spiele wird im Lingotto das grosse Pressezentrum eingerichtet, denn den 2600 Athleten stehen 9600 Journalisten gegenüber!
Vom Lingotto aus fällt der Blick auf die Betondächer der benachbarten «Mercati Generali». Die 25 000 Quadratmeter grosse Halle, Umberto Cuzzis rationalistisches Meisterwerk von 1934, ist zum Zentrum für die Akkreditierung, Logistik und medizinische Versorgung, aber auf für Konferenzen umgebaut und mit Läden und Restaurant versehen worden. Die eleganten, parabolischen Betonformen dienten Hugh Dutton als Inspiration für seine riesige rote Hängebrücke, die sofort zum architektonischen Symbol der Spiele avancierte. Für den Bau des olympischen Dorfs nebenan wurde eine wahre «europäische Architektur-Olympiade» veranstaltet. Der Masterplan stammte von Otto Steidle aus München; an der Realisierung aber waren Architekten aus Basel, Berlin, London, Lyon, Mailand, München, Paris, Turin und Wien beteiligt.
Das bunte Ergebnis einer europäischen Koproduktion bietet 750 Wohnungen für 2500 Sportler, die nach den Spielen zu Studentenheimen sowie Miethäusern werden. Insgesamt 39 Bauten mit fünf bis acht Stockwerken wurden in einem Schachbrettmuster errichtet. Alle öffentlichen Räume, Plätze, Höfe und Gärten sind miteinander verbunden. Neben verschiedenen italienischen Baukünstlern haben auch international bekannte Architekten wie Roger Diener aus Basel, Adolf Krischanitz und Manfred Ortner aus Wien einzelne Wohnhäuser der ökologischen Modellsiedlung entworfen. Das Farbschema, das der Berliner Künstler Erich Wiesner für das olympische Dorf entwickelt hat, fasst die unterschiedlichen architektonischen Handschriften zu einem einprägsamen, farbigen Katalog der europäischen Wohnarchitektur zusammen.
Eisenbahn statt Autos
Eine der wichtigsten städtebaulichen Veränderungen in Turin war der Bau von zwei neuen U-Bahn-Linien. Der Hauptbahnhof, die Stazione Porta Nuova, wird zugunsten des Bahnhofs Porta Susa geschlossen. An seiner Stelle entsteht ein Stadterweiterungsgebiet, das künftig das Zentrum mit den riesigen Industrieflächen im Süden verbinden soll. Über dem «Passante» genannten 15 Kilometer langen Tunnel, der die Hauptbahnlinie von Turin aufnimmt, entstand eine neue «Spina Centrale», eine grosse Allee, die die beiden bisher getrennten Stadthälften verbindet und zur wichtigsten Nord-Süd-Verbindung der Stadt wurde. Die anliegenden Grundstücke werden nun sukzessive umgewidmet: Eine alte Stahlfabrik wurde zum Umwelttechnologiepark und die Reparaturhallen der italienischen Staatsbahn zum Polytechnikum.
Seitdem die Stadt 1997 den «Progetto Speciale Periferie» verabschiedet hat, verfolgt die Planung das Ziel, Turin polyzentrisch zu entwickeln, und deshalb wurden auch die Bahnverbindungen zwischen Stadt und Umland verbessert. Der Familie Agnelli, der neben Fiat auch die grosse Tageszeitung in Turin und mehrere Banken gehören, dürfte es recht sein, denn sie ist auch in der Bahnindustrie aktiv. Die Schicksale der Stadt und des Konzerns sind eben traditionell eng verwoben. Nun bereitet sich Turin auf die postindustrielle Ära vor. Die Olympischen Winterspiele 2006 sind dafür nur ein Baustein.
Die kalte Pracht der Sportstätten
Zugpferd der Strukturänderung ist die Architektur. Ähnlich wie in Barcelona sind auch in Turin dezentrale Sportprojekte realisiert worden. Für die nichtalpinen Wettkämpfe wurden zwei Sporthallen renoviert: die Giovanni-Agnelli-Halle von Pier Luigi Nervi und das Stadio Communale. Der japanische Architekt Arata Isozaki hat den runden Betonbau von 1934 um eine eckige Halle erweitert. Deren eisige, horizontal geschlitzte Stahlfassade verweist auf die kalte Pracht im Inneren. Gleichwohl ist die Halle nicht so spektakulär ausgefallen wie Isozakis Sant-Jordi-Sportpalast in Barcelona. Den Turiner Bauherren ging es weniger um auffällige Bauten als vielmehr um chirurgische Eingriffe in das städtische Gewebe. Neu gebaut wurden nur der ovale «Palasport Velocità» für den Eisschnelllauf von HOK aus London und der Sportpalast im Industriegebiet Mirafiori. Die Eröffnungs- und die Schlusszeremonie der Spiele finden im Alpenstadion, der Heimat von «Juventus», statt. Das wichtigste Stadion der Stadt ist jedoch der hexagonale «Palazzo Vela» von Annibale und Giorgio Rigotti, in welchem die Eiskunstlauf- und Short-Track-Wettbewerbe abgehalten werden. Die Betonhalle mit über 150 Meter Spannweite am linken Ufer des Po wurde von Gae Aulenti und Arnaldo de Bernardi für die Spiele umgebaut.
Auch das alte Lingotto-Werk von Fiat erfuhr eine Aufwertung. Das 600 Meter lange Gebäude, auf dessen Dach Giacomo Matte Trucco die berühmte Versuchspiste anlegte, ist das Symbol des italienischen Industriebaus. Schon vor Jahren wurde es von Renzo Piano zum Hochschul-, Hotel-, Büro- und Einkaufszentrum umgebaut. Der Bolla genannte kugelförmige Konferenzraum auf dem Dach und die Pinakothek, in der Kunstwerke aus der Agnelli-Sammlung gezeigt werden, sind der sichtbarste Ausdruck der neuen Nutzung. Für die Spiele wird im Lingotto das grosse Pressezentrum eingerichtet, denn den 2600 Athleten stehen 9600 Journalisten gegenüber!
Vom Lingotto aus fällt der Blick auf die Betondächer der benachbarten «Mercati Generali». Die 25 000 Quadratmeter grosse Halle, Umberto Cuzzis rationalistisches Meisterwerk von 1934, ist zum Zentrum für die Akkreditierung, Logistik und medizinische Versorgung, aber auf für Konferenzen umgebaut und mit Läden und Restaurant versehen worden. Die eleganten, parabolischen Betonformen dienten Hugh Dutton als Inspiration für seine riesige rote Hängebrücke, die sofort zum architektonischen Symbol der Spiele avancierte. Für den Bau des olympischen Dorfs nebenan wurde eine wahre «europäische Architektur-Olympiade» veranstaltet. Der Masterplan stammte von Otto Steidle aus München; an der Realisierung aber waren Architekten aus Basel, Berlin, London, Lyon, Mailand, München, Paris, Turin und Wien beteiligt.
Das bunte Ergebnis einer europäischen Koproduktion bietet 750 Wohnungen für 2500 Sportler, die nach den Spielen zu Studentenheimen sowie Miethäusern werden. Insgesamt 39 Bauten mit fünf bis acht Stockwerken wurden in einem Schachbrettmuster errichtet. Alle öffentlichen Räume, Plätze, Höfe und Gärten sind miteinander verbunden. Neben verschiedenen italienischen Baukünstlern haben auch international bekannte Architekten wie Roger Diener aus Basel, Adolf Krischanitz und Manfred Ortner aus Wien einzelne Wohnhäuser der ökologischen Modellsiedlung entworfen. Das Farbschema, das der Berliner Künstler Erich Wiesner für das olympische Dorf entwickelt hat, fasst die unterschiedlichen architektonischen Handschriften zu einem einprägsamen, farbigen Katalog der europäischen Wohnarchitektur zusammen.
Eisenbahn statt Autos
Eine der wichtigsten städtebaulichen Veränderungen in Turin war der Bau von zwei neuen U-Bahn-Linien. Der Hauptbahnhof, die Stazione Porta Nuova, wird zugunsten des Bahnhofs Porta Susa geschlossen. An seiner Stelle entsteht ein Stadterweiterungsgebiet, das künftig das Zentrum mit den riesigen Industrieflächen im Süden verbinden soll. Über dem «Passante» genannten 15 Kilometer langen Tunnel, der die Hauptbahnlinie von Turin aufnimmt, entstand eine neue «Spina Centrale», eine grosse Allee, die die beiden bisher getrennten Stadthälften verbindet und zur wichtigsten Nord-Süd-Verbindung der Stadt wurde. Die anliegenden Grundstücke werden nun sukzessive umgewidmet: Eine alte Stahlfabrik wurde zum Umwelttechnologiepark und die Reparaturhallen der italienischen Staatsbahn zum Polytechnikum.
Seitdem die Stadt 1997 den «Progetto Speciale Periferie» verabschiedet hat, verfolgt die Planung das Ziel, Turin polyzentrisch zu entwickeln, und deshalb wurden auch die Bahnverbindungen zwischen Stadt und Umland verbessert. Der Familie Agnelli, der neben Fiat auch die grosse Tageszeitung in Turin und mehrere Banken gehören, dürfte es recht sein, denn sie ist auch in der Bahnindustrie aktiv. Die Schicksale der Stadt und des Konzerns sind eben traditionell eng verwoben. Nun bereitet sich Turin auf die postindustrielle Ära vor. Die Olympischen Winterspiele 2006 sind dafür nur ein Baustein.
Für den Beitrag verantwortlich: Neue Zürcher Zeitung
Ansprechpartner:in für diese Seite: nextroom






