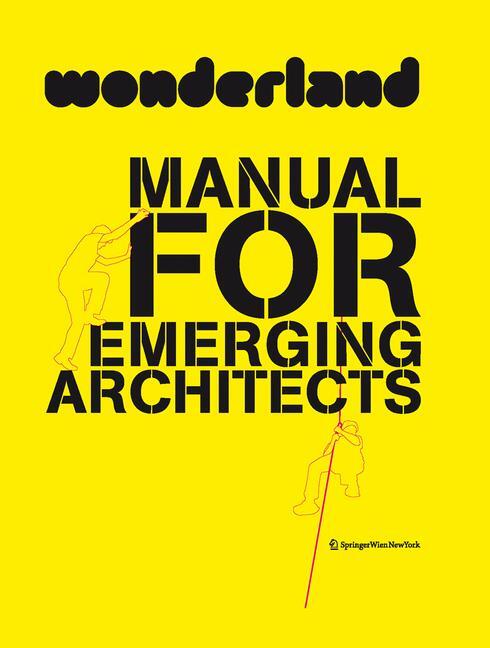Im Juni wurde der neu gestaltete Yppenplatz der Bevölkerung übergeben. Ein Lokalaugenschein in Wien-Ottakring über das Leben im öffentlichen Raum.
Über den Platz rollt ein gelber Tennisball. Ein schwarzer Hund fliegt ihm hinterher, schnappt ihn und will weiterspielen. Auf den Bänken im Schatten des Marktamtes hat sich ein Vater mit zwei Söhnen niedergelassen, dann eine Gruppe behinderter Männer mit ihren Betreuern. Der Hund macht keine Unterschiede - Hauptsache, das Gegenüber spielt mit. Es ist Vormittag und noch wenig los auf dem Yppenplatz in Wien-Otta-kring. Man hört das Rauschen der Blätter und Kinderstimmen. Vor knapp zwei Monaten, Mitte Juni, wurde der neugestaltete Yppenplatz feierlich der Bevölkerung übergeben.
„Der Platz war in die Jahre gekommen, der Nutzungsdruck ist enorm“, sagt Anita Voraberger, Vorsitzende des Umweltausschusses Ottakring und Mediensprecherin der Umweltstadträtin Ulli Sima. In Ottakring gibt es in der Nähe vom Gürtel kaum öffentliche Plätze; die Bebauung ist sehr dicht und damit der Bedarf nach Freiräumen und öffentlichem Grün groß. Wenn täglich viele Menschen auf so einem Platz zusammenkommen, dann nennt man das „einen hohen Nutzungsdruck“, und der habe eine Neugestaltung notwendig gemacht. Die Entscheidung, den Platz neu zu gestalten, hat der Bezirk getroffen. Den Entwurf und die Umsetzung haben dann die Wiener Stadtgärten, kurz MA 42, übernommen. Die Summe von 600.000 Euro wurde zu 50 Prozent von der EU kofinanziert.
Nicht alle waren und sind davon überzeugt, dass der Platz überhaupt eine neue Gestalt brauchte. Für die einen hat er gut funktioniert, für die anderen war er nur eine „Betonwüste“. Der Wunsch nach mehr Grün und mehr Schatten war aber bereits vor zehn Jahren einer der Hauptwünsche der Bevölkerung. Damals ging ein einjähriges Bürgerbeteiligungsverfahren der Neugestaltung durch die Landschaftsarchitekten Ursula Kose und Lilli Licka voraus. Doch da der Platz sich auf einem Luftschutzbunker aus dem Zweiten Weltkrieg befindet, wachsen die Bäume nicht so schnell und so hoch, wie gewünscht. Die Bäume, die vor zehn Jahren gepflanzt wurden, stecken noch in den Kinderschuhen. Nicht wenige von ihnen mussten nun ersetzt werden, da ihre Rinde von Hund und Mensch zu sehr beschädigt worden war.
„Wir haben dem quadratischen Platz eine lockere Form gegeben, ihn modernisiert und freundlicher gestaltet“, erzählt der Projektverantwortliche Stefan Streicher von der MA 42. Mandelförmige Hochbeete und eine Stahlpergola, an der Blauregen und Trompetenwinde hochranken sollen, gestalten nun die Platzmitte. Betonmauern umranden die Beete und dienen als Sitzfläche. Der Kinderspielplatz wurde mit neuen Spielgeräten und mit Kies statt mit Rindenmulch bestückt. An den Rändern des Platzes stehen Tische mit Bänken und sogenannte Wellenliegen, die sich laut Streicher auch schon in anderen Parks bewährt haben. Das Herzstück des Platzes aber ist - zumindest aus Jugendperspektive - der Fußballkäfig mit dem angrenzenden Basketball- und Volleyballplatz.
„Mir gefällt der Platz“, sagt Vessela Petrova. Sie wohnt in der Nähe und war diese Woche schon viermal mit ihren Söhnen hier. Die beiden laufen in Badehosen über einen ebenfalls mandelförmig hervorgehobenen Bodenbelag und warten darauf, dass endlich wieder Wasser herausspritzt. Mal ist es ein Strahl, mal zwei und mal drei, oft aber auch keiner. „Er ist viel schön als vorher“, sagt die Frau, „aber er wird nicht so bleiben“, fürchtet sie. Die Leute schätzten den Platz nicht. Wirklich beurteilen können, wird man das erst nach einiger Zeit - das sagt auch Florian Brand von der Gebietsbetreuung Ottakring. „Bei schönem Wetter ist der Platz immer voll, jetzt sowie vorher.“ Die Meinungen über den Platz sind unterschiedlich, das weiß die Gebietsbetreuung am besten. Dort laden viele Beschwerden und Wünsche ab. In den Planungsprozess aber seien sie diesmal nicht mit eingebunden gewesen. Trotzdem ist Brand froh, dass Geld in den öffentlichen Raum investiert wurde. Werden es die Rankpflanzen schaffen, wo schon die Baumstämme so beschädigt wurden, dass sie abgestorben sind? Wie werden die Hochbeete in ein paar Jahren ausschauen? Wie wird es den Bodenbelägen und den Sitzgelegenheiten gehen? Auch mit dem Schatten ist es so eine Sache: Pergola und Blumenbeete sorgen zwar für sichtbar mehr Grün, aber nicht unbedingt für mehr Beschattung der Sitzgelegenheiten.
Wie viel Freiraum ist notwendig?
Am Nachmittag und am frühen Abend ist hier eindeutig am meisten los. Nach und nach füllen sich Fußball-, Kinderspielplatz, auch alle Tische und Bänke, die ein wenig Schatten versprechen. Dort spielt eine Gruppe Männer Karten. Am Nachbartisch sitzen die Frauen, die Kinder pendeln zwischen Platzmitte, Kinderspielplatz und Müttern hin und her. „Früher war das wie eine große Bühne“, erinnert sich Regina Nitschke von den Wiener Kinderfreunden. Sie ist für die Parkbetreuung in Ottakring zuständig, mit der sie Kinder von sechs bis 13 Jahren ansprechen. Sie war gemeinsam mit der mobilen Jugendarbeit Back on Stage, die sich um die Jugendlichen kümmern, in den Planungsprozess eingebunden. „Es gab viel freie Fläche und wenige Sitzgelegenheiten.“ Vor allem die Mädchen hätten sich mehr Rückzugsmöglichkeiten gewünscht. Nitschke ist zufrieden mit der Neugestaltung. Vorher haben die Jugendlichen irgendwo gespielt, jetzt sei es klarer definiert.
Wie viel Planung braucht ein öffentlicher Platz? Wie viele Nutzungsmöglichkeiten sollten vorgegeben, und wie viel Freiraum den Benutzern geboten werden? Ein schwieriges Thema. Landschaftsarchitektin Kose: „Je mehr ein Platz kann, desto besser ist er für die unterschiedlichen Gruppen zu bespielen“. Damit ist die jetzige Gestaltung sicherlich der genaue Gegenentwurf zu dem von Koselicka von vor zehn Jahren. „In bin seit zehn Jahren hier auf dem Platz“, sagt der 19-jährige Yunus. Er findet es war früher besser. Die Jugendlichen haben sich ein Netz über dem Fußballkäfig gewünscht und bekommen. Die versprochenen Fußballtore gibt es noch immer nicht, und das ärgert sie. „Der Rest des Platzes interessiert mich wenig“, sagt er. Ein bisschen „bobo“ sei alles geworden, meint sein Freund.
Um der Gentrifizierung des Viertels gerecht zu werden, wollte man den Platz „schicker“ machen. „Aber was will der Platz sein?“, fragt sich Architektin Silvia Forlati, die wie so viele gerne am Samstagvormittag auf den Brunnenmarkt kommt. „Der Yppenplatz ist ein spannender Ort, der Entwurf aber spiegelt das nicht wider. Mir kommt das wie Kosmetik vor“, kritisiert sie.
In Wien fehle es an Tradition und an Sensibilität, einen Platz zu gestalten, sagt auch Boris Podrecca. Der Wiener Architekt liebt es, Plätze zu gestalten, weil er Menschen zusammenführen will. „Ein Platz ist das Passpartout, in dem unsere Handlungen stattfinden“, er denkt dabei an eine präzise formulierte Gestalt, an schöne Texturen und erfrischende Wasserelemente. Dann können Plätze die Interaktion fördern und stellen damit ein Gegenmodell zu Chat-rooms dar.
Für eine funktionierende Gesellschaft sind Platzgestaltungen ein Thema, über das differenzierter nachgedacht werden muss. Gelegenheit zum Diskutieren und Nachdenken gibt es etwa im November beim Architektursymposium im Architekturzentrum Wien zum Thema „Urban Public Space“.