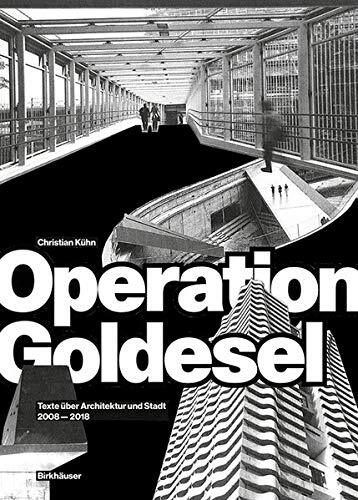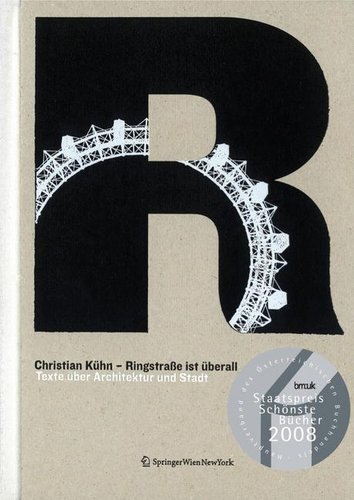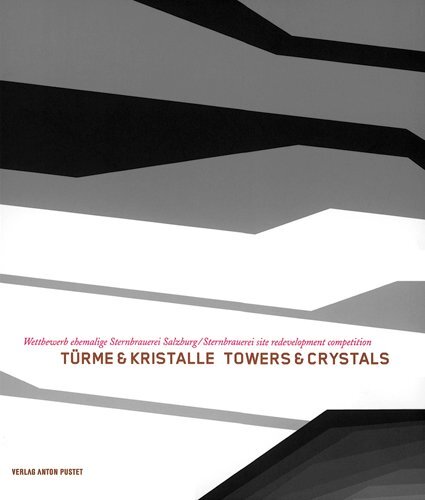Yona Friedman, geb. 1923, ist französischer Architekt, Architekturtheoretiker und Stadtplaner ungarischer Herkunft, wohnhaft in Paris. In den 1960er Jahren veröffentlichte er die Manifeste „Architecture Mobile“ und „La ville spatiale“. Diese visionären Megastrukturen über bestehenden Städten, in denen die BewohnerInnen ihre räumliche und soziale Welt flexibel gestalten sollten, sind bis heute viel diskutierte Klassiker der städtebaulichen Avantgarde. Friedman sprach in seinem Vortrag in Wien über das Prinzip der Unberechenbarkeit und Unkontrollierbarkeit in der Mathematik, Physik, aber auch von räumlichen und sozialen Entwicklungen. Er plädiert angesichts einer erratischen Realität für das Operieren mit offenen Systemen, für eine in die Praxis umgesetzte direkte Demokratie, nicht zuletzt in der Produktion von Raum.
dérive: Sie haben Systeme konzipiert, die kontinuierlich verändert werden können – auf Grund sich verändernder Bedürfnisse und Wünsche. Heute dienen Architektur und Stadtplanung oft der Etablierung von Marken – das impliziert ein fixiertes, wieder erkennbares Bild. ArchitektInnen entwickeln ihre eigene Marke, um als „Stars“ wahrgenommen zu werden. Gibt es noch Raum für Konzepte und Strategien?
Yona Friedman: Ich möchte nicht ungerecht sein. Aber das System der Stars ist eine lächerliche Angelegenheit. Ich denke, dass Kultur von Gewohnheiten und Stilen geprägt ist. Es gibt natürlich individuelle Positionen, die aber in eine Gesamtheit eingebettet sein sollten. Auch das „Star-System“ der Vergangenheit brachte negative Resultate. Gotische und mittelalterliche Architektur war großartig, gleichzeitig individuell und doch ein gemeinsamer Stil. Wenn man gewisse Tendenzen in der Renaissance betrachtet, findet man hingegen Schwächen. Ein Stil da, ein anderer dort und keine Kohärenz. Die Kohärenz beginnt auf einer unteren Ebene, nicht auf der „Star“-Ebene. Und es gibt wunderbare Barock-Architektur, aber nicht unbedingt als Folge eines „Star“-Systems.
dérive: Hat Le Corbusier Ihre ville spatiale kommentiert?
YF: Ja – positiv. 1957 war ich sehr unsicher. Ich dachte, ich entwickle mich weg von der Architektur-Gemeinschaft. Ich habe während des CIAM-Kongresses in Dubrovnik bemerkt, dass die ville spatiale etwas Neues für die Architekten war. Ich wusste erst nicht, ob ich hingehen sollte. Ich traf Le Corbusier, und wir sprachen zwei Stunden. Er sagte mir: „Ich würde so etwas nicht machen, aber Sie müssen es machen. Alle Architekten werden gegen Sie sein. Aber das macht nichts.“ Es war eine sehr starke Unterstützung und ich hatte keine Bedenken mehr, mich mit diesem Rückhalt an Alison und Peter Smithson zu wenden. Aber ich komme noch einmal auf Ihre allererste Frage zurück. Le Corbusier hatte eine sehr seltsame Einstellung. Sein Erfolg war ja, dass er kopiert wurde, und er wurde oft kopiert. Aber er war zornig auf die Leute, die ihn kopierten. Das ist sehr seltsam. Weil ja genau diese Kopien sein Erfolg waren.
dérive: In der ville spatiale erbauen die BewohnerInnen die Stadt nach ihren individuellen Präferenzen - der/die ArchitektIn ist nicht SchöpferIn einer finalen Form, sondern stellt ein Rahmenwerk zur Verfügung. Aber individuelle Wünsche werden oft manipuliert – etwa durch Werbung und Kommerz. Sind freundliche, aufgeklärte NutzerInnen nicht eine Illusion?
YF: Ja, freundliche, aufgeklärte NutzerInnen sind eine Illusion, aber das kümmert mich nicht. Es können dumme NutzerInnen sein. Wenn man Leute auf der Straße anschaut, sind diese nicht notwendigerweise geschmackvoll angezogen, aber der generelle Eindruck ist vielfältig. Viele dumme NutzerInnen würden eine facettenreiche Landschaft erzeugen. Einfach auf Grund ihrer Anzahl und auf Grund von Regeln. Ein anderes Beispiel: Auf der Straße schaut man als ArchitektIn auf die Gebäude, aber das tut sonst niemand. Die Straße wird von den Auslagen der Geschäfte gebildet. Die sind banal, und doch geben sie der Straße ihre Lebensqualität.
dérive: Aber etwas anzuschauen und etwas zu erfahren sind zwei unterschiedliche Dinge. Sind Ihre Konzepte in Bezug auf Partizipation und Wahlmöglichkeit der NutzerInnen und Offenheit der Struktur universelle Prinzipien oder sind diese vom Kontext abhängig?
YF: Für mich ist das ein universelles Prinzip. Nicht nur in der Architektur. In meinen letzten Büchern habe ich Unberechenbarkeit thematisiert, in der Physik, in der Mathematik. Die Mathematik wird oft auf Arithmetik reduziert, auf ein regu-läres System, aber das ist sie nicht, sie ist voll von unberechenbaren Elementen. Ich könnte mich auf Gödel beziehen, aber auch, auf einer einfacheren Ebene, auf Leibniz. Man nimmt eine Zahl, addiert eine weitere. Und so weiter. Erhält eine Primzahl, dann eine perfekte Zahl, auf einmal eine Quadratzahl. Das bedeutet, dass man nie weiß, was als nächstes kommt. Das ist die Definition von Unberechenbarkeit/Unkontrollierbarkeit. Von einer bestimmten Stufe aus weiß man nicht, was die nächste bringen wird. Auch im sozialen Verhalten ist es ein Prinzip. Man weiß nicht, wie sich Leute verhalten werden. Alles ist möglich, zu jedem Zeitpunkt. Das ist die erratische Struktur der Realität.
dérive: Gestern in Ihrem Vortrag nannten Sie Architektur ein Hindernis. Als solches steht sie gewissermaßen diesen erratischen Prozessen im Weg. Deshalb möchten Sie sie zur Seite schieben. Hannah Arendt hat über öffentlichen Raum geschrieben, dass er etwas ist wie ein Tisch, ein Objekt zwischen Menschen, das diese gleichzeitig trennt und verbindet. Aber ein Objekt wird benötigt. Das Objekt hat hier nicht nur die Rolle eines Hindernisses, sondern auch die eines Gegenstandes der Verhandlung.
YF: Sie kennen die Raumdefinition von Leibniz. Raum existiert nicht, außer es gibt mindestens ein Objekt. Das ist evident. Das zeigt eine gewisse Komplementarität. Hindernisse sind notwendig, aber ich mag die Idee nicht, dass sie vorherbestimmt sind.
dérive: Es gibt zu viele Hindernisse in der Architektur?
YF: Das hängt vom Kontext ab, deshalb betone ich immer, dass soziales Verhalten erratisch ist. Leute brauchen manchmal Hindernisse, und sie schaffen welche. Manchmal wollen sie sie loswerden. Aber ich denke nicht, dass die Architekten das alleine definieren.
dérive: Welche Form von Machtstruktur wäre Ihrer Meinung nach fähig, ein derart aufwändiges System wie die ville spatiale zu implementieren?
YF: Ich denke, die Machtstruktur wäre nicht geplant und wäre mehr und mehr reduziert. Es würde sehr stark von natürlichen Führungstalenten abhängen. Leute haben eine Idee und könnten eine Gruppe bilden. Das ist noch nicht sehr gefährlich.
dérive: Wie sehen Sie das Verhältnis von Privatheit, Öffentlichkeit und Politik? Was denken Sie über die Beziehung von Politik, Architektur und Urbanismus? Glauben Sie an große Politik, große Projekte?
YF: Ich denke, darin liegt meine Kritik an der Mainstream-Architektur. Sie ist unweigerlich ein politisches Werkzeug. Das Star-System ist typischerweise die Kreation einer bestimmten politischen Einstellung. Mein Denken ist nicht unpolitisch, aber auf andere Weise politisch. Sie könnten es direkte Demokratie nennen, wenn Sie wollen. Aber es geht nicht um große Worte. Sie entsteht im Handeln. Leute laufen über die Kärntnerstraße, das ist ursprüngliche, direkte Demokratie. Niemand stößt an den anderen an. Niemand tötet den anderen. Es funktioniert. Es hat seine eigene Regelhaftigkeit. Das ist für mich Gesellschaft: Individuen, die von Gepflogenheiten zusammengehalten werden. Die Routine ist das stärkste Element. Das ist niemals abstrakt, es passiert affektiv.
dérive: Sehen Sie Ihre Arbeit für die UNESCO als politisch an?
YF: Ja und Nein. Ich habe das nicht als politisch betrachtet, aber es hat Menschen beeinflusst. Sie hatten ein Problem und suchten nach Rat. Und Rat kann nicht nur gelehrt sein, man kann Anstöße geben. Sie machten es dann auch auf Ihre Weise. Ich weiß nicht, ob Sie Paolo Frere kennen. (Anm. d. Red.: Der Initiator einer Pädagogik der Unterdrückten) Er meinte, es wäre das Wichtigste, AnalphabetInnen zu unterrichten. Das war der Grund dafür, dass wir befreundet waren, weil ich das auf visuellem Gebiet versuchte. Als ich Zeichnungen und Poster mit Leuten im öffentlichen Raum in Indien machte, fingen die Leute an, es selbst zu tun, es wurde zu einer Form des Ausdrucks. So wie Rap politisch wurde. Ich denke, es geht immer um die Idee der eigenen Verantwortung in seinen Belangen. Du solltest maximale Information bekommen. Die Information mag parteiisch sein, das ist ihr Charakter. Aber du musst sie schälen und herausnehmen, was du brauchst. Mit der Architektur und der Gesellschaft oder auch der Mathematik ist es das gleiche. Es gibt dieses unausgesprochene Prinzip dahinter. Unausgesprochen, weil ich es nicht kenne.
dérive: Können wir in der Betrachtung des Phänomens von Zersiedelung und Suburbanisierung – trotz aller Kritik – etwas von diesen ungeplanten Territorien lernen? Und: Die Hierarchien zwischen Zentrum und Peripherie werden unscharf. Wird die Polarität verschwinden?
YF: Ich glaube nicht. Ich gebe ein Beispiel: Von Paris nach Tours braucht man 55 Minuten. Von einem Vorort ins Pariser Zentrum ist es mehr als eine Stunde. Aber Tours ist nicht eine Vorstadt von Paris, sondern ein eigenes Zentrum. Paris oder London zu besuchen, ist ein routinierter Akt. Die Peripherie wird nicht besichtigt.
Die Vorstädte wurden mit gutem Willen gebaut. Aber es existiert keine Routine. Sie haben ihre Rolle nicht gefunden.
Es ist nicht nur eine Frage der Ökonomie. Eine ärmliche Gegend innerhalb einer großen Stadt ist etwas wie eine unabhängige Einheit.
Einmal habe ich gesagt, dass das Land unsere letzte Kolonie ist. Aber es ist noch schlimmer. Die Vorstädte sind unsere letzten Kolonien. Und Kolonien explodieren. Denke Sie an die letzte Revolte in Paris. Es war eine sehr interessante Angelegenheit. Es war keine politische Revolte, und sie war nicht zentriert. Es hat angefangen, als die Leute wirklich verärgert waren. Ich glaube, soziale Entwicklungen können nicht gelenkt werden. Aber man kann Werkzeuge bereitstellen, und die Menschen machen etwas damit.
dérive: Gibt es für Sie eine kritische Größe einer Stadt?
YF: Sehen Sie – das ist interessant in Indien. Es ist ein überbevölkertes Land, aber die Städte sind nicht überbevölkert. Ich kannte Bombay in den siebziger Jahren. Heute sind 36 Jahre vergangen. Bombay ist gewachsen, aber nicht explodiert, wie man angenommen hatte.
Auch andere indische Städte sind gewachsen, ohne zu explodieren. Indien hat eine Kleinstadt-Struktur behalten. Ich denke, China auch, obwohl das Land so weitläufig ist – und obwohl Shanghai zu groß geworden ist.
Anders ist die Sache bei Istanbul: Als ich Istanbul kennen lernte, gab es 800.000 EinwohnerInnen. Istanbul für etwa zwei Millionen EinwohnerInnen wäre auch noch ok. Aber heute hat Istanbul 17 Millionen Einwohner. Die Großstadt ist zwar sehr attraktiv, aber dann gibt es auch ziemlich große Enttäuschungen und Probleme.
dérive: Implizieren Sie damit auch, dass – wenn neue Städte geschaffen werden sollten – ab einer gewissen Größe neue Zentren geplant werden sollten? In Asien planen Sie ja gegenwärtig neue Städte. Und auch andere europäische PlanerInnen bauen dort neue Städte.
YF: Ich weiß nicht, wo neue Städte hinführen. Unter Alexander dem Großen wurden 200 Alexandrias gegründet. Heute gibt es eines. Oder wenn Sie nach Amerika schauen: Die Zahl bedeutender Städte des 19. Jahrhunderts, die verschwunden sind, ist überraschend – es ist keine verschwunden. Es ist seltsam, aber so ist es, an vielen Orten. Und die Situation in Europa ist auch weit weniger dramatisch als überall anderswo. In Europa hat sich nie eine Konzentration im Sinne einer Mega--city ausgebildet. Brüssel ist die Hauptstadt Europas und scheint in der Größe beinahe konstant zu bleiben.
dérive: Wir haben eine andere Demografie. Sie nimmt ab.
YF: Außerdem haben wir eine andere ökonomische Realität. In Indien ist ein Grund dafür, dass es keine überbevölkerten Städte gibt, dass es viele Sprachen gibt. Es gibt keine indische Sprache. Es wird Marathi gesprochen, dann gehen Sie in ein Dorf zweihundert Kilometer entfernt, und da ist es komplett anders. Nicht völlig anders, aber anders genug.
dérive: Was denken Sie über den Boom der so genannten minimalistischen Architektur heute? Sie haben ja in den fünfziger und sechziger Jahren ein spezielles Konzept des Minimalen erarbeitet. Wir denken, dass Ihr Konzept des Minimalen eine sehr soziale Idee war und nicht eine rein ästhetische. Minimalismus heute ist dagegen sehr teuer geworden.
YF: Ich weiß. Das hat kommerzielle Gründe. Das ist eben das Star-System. Etwa vor zehn Jahren hat die Stadt nach Unterkünften für Obdachlose in Paris gesucht. Ich machte einen Vorschlag, den ich „2 Wände und 1 Dach“ nannte. Die Leute sollten diese einfachen Strukturen besetzen. Es war als eine Form organisiertes Besetzens gedacht. Das wurde abgelehnt.
dérive: Vielleicht mochte der Wohlfahrtsstaat ihr Modell nicht. „2 Wände und 1 Dach“ ist nicht genug für den Wohlfahrtsstaat, weil er einen minimalen Standard definiert und man nicht darunter gehen kann.
YF: Sicher. Und es gibt noch zwei Schwier-igkeiten: Die Firmen, die der Staat fragte, waren nicht interessiert, weil es nicht perfekt aussah. Und zweitens stellte der Staat Land zur Verfügung, was ja das teuerste Gut ist, und deshalb wollte er etwas Spek-takuläreres machen. Mein Ansatz war, dass nicht Land zur Verfügung gestellt werden sollte, sondern Luftraum genützt werden sollte wie etwa über den Rangierbahnhöfen.
dérive: Denken Sie, dass Ihre Ansätze auch in der Mainstream-Praxis Anwendung finden könnten?
YF: Wissen Sie, es ist in meinem Interesse, gewisse Prozesse in Gang zu bringen. Ich hatte nie die Illusion, dass der Prozess mir gehört oder dass ich ihn kontrollieren könne. Ich kann nicht sagen, was das Resultat sein wird, weil ich auch nicht an finale Resultate glaube. Ich kann nur Prozesse in Gang bringen und dann … ok ...
dérive: Architektur ist eine Einladung zu einem Spiel?
YF: Ich glaube, dass ArchitektInnen nicht verstehen, dass sie nur den Ausgangspunkt eines Prozesses gestalten. In den Siebzigern war ich in Hongkong. Die Regierung hatte einige Gebäude errichtet. Ein Jahr später sahen sie anders aus, weil die Leute Balkone anbauten und Vogelkäfige und Gott weiß was. Ich habe Fotografien von Häusern gemacht, wo man die ursprüngliche von Architekten entworfene Form nicht mehr ausmachen konnte. Als ich 1949 Le Corbusier kennenlernte, sagte er mir: „Schauen Sie sich nicht die Gebäude von mir an, die Leute haben sie verändert. Es ist eine Katastrophe, Sie können sich die cité universitaire anschauen gehen, aber alles andere wurde verändert.“ Aber das war genau das Schöne, dass die Gebäude verändert wurden.