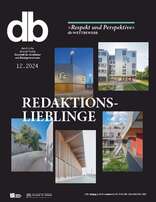Zeitschrift
db 2024|12
Redaktionslieblinge

Mehrzweckhalle in Radolfzell
Soziale Mitte
Wie eine dieser ortstypischen Holzscheunen steht die neue Mehrzweckhalle zwischen Bodensee und Obstbaumwiesen. Eine vertikal strukturierte Holzlamellenfassade über der eine filigrane Dachkonstruktion weit auskragt, zeigt ein homogenes Erscheinungsbild.
3. Dezember 2024 - Petra Ralle
Der Schock war riesig, als 2018 nach einer Fasnetsveranstaltung im katholisch geprägten Markelfingen, einem Ortsteil von Radolfzell, die Mehrzweckhalle aus dem Jahr 1973 abbrannte. Fortan fehlte ein Ort, an dem die Gemeinde für kulturellen Austausch und Feste zusammenkommen konnte. Sowohl die nahe gelegene Grundschule als auch die zahlreichen Vereine hatten den Bau als Sporthalle genutzt und mussten nun auf andere Quartiere ausweichen. Und die im Konglomerat verschiedener Gebäudeteile mitbeheimatete Feuerwehr hatte ebenfalls Räume in der alten Halle genutzt. Es galt also, am gleichen Standort eine Halle für Sport- und Kulturnutzungen zu errichten. Die Lage des Grundstücks am Ortsausgang Richtung Konstanz ist malerisch: Direkt am Bodenseeradweg nur wenige Meter vom nördlichen Ufer des Untersees entfernt, öffnet sich die Landschaft in der anderen Richtung leicht ansteigend zu Obstbaumwiesen hin. Schnell war klar, dass nun die Funktionen der Feuerwehr und der Hallennutzung räumlich getrennt werden sollten. Die Stadt Radolfzell als Bauherrin legte außerdem fest, dass der Neubau CO2-neutral ausgeführt werden und dem Passivhausstandard entsprechen musste.
STEIMLE ARCHITEKTEN entwarfen einen kubischen Holzbau über nahezu quadratischem Grundriss, dessen Fassaden von einer klaren vertikalen Holzlamellenstruktur geprägt sind. Das weit auskragende Dach mit seiner schmal zulaufenden Attika wird von sich verjüngenden Holzbalken getragen und zeigt einen regionaltypischen Charakter. Das ebenmäßige Erscheinungsbild setzt sich im Innern der Halle mit ihren schlichten Holzoberflächen fort.
Gemischte Nutzung
Auf der Westseite des Gebäudes gelangen Schulkinder und Sportler der Vereine ebenerdig und barrierefrei durch einen Eingang im EG direkt zu den Umkleiden und zur Sporthalle. Die Nebenräume sind entlang eines langen Flurs parallel zur Halle angeordnet. In einer tannengrün lasierten Box ordnen sich eine Küche, Sanitär-, Dusch-, Umkleide-, Geräte- und Lagerräume an. Eine breite, einläufige Treppe führt hinauf ins Foyer.
Die Bauherren hatten sich für eine 1,5-Feld-Sporthalle entschieden, die in ihren Abmessungen zwar nicht den DIN-Vorgaben für Wettkämpfe und Turniere entspricht, jedoch die größtmögliche Variabilität für die gewünschten Nutzungen bietet. Sie ist mit allen notwendigen Geräten ausgestattet, die für den Schulunterricht und von den Vereinen benötigt werden, und verfügt darüber hinaus über eine seitlich angeschlossene Kulissenbühne. Bei der Einrichtung legten die Architekt:innen besonderen Wert darauf, dass alle Utensilien wie Kletterwand, Sprossenwand, Basketballkörbe u. Ä. bei Veranstaltungen unsichtbar verstaut werden können und nichts den Blick zur Bühne stört. Lediglich der flächengedämpfte Linoleumboden mit Spielfeldmarkierungen erinnert dann noch an die sportliche Nutzung. Die Bühne selbst verschwindet im Sportbetrieb hinter Holzlamellen-Paneelen, kann aber auch als separater Übungs- und Gymnastikraum mit Tageslicht genutzt werden. Sieben flächenbündig in die Prallwand integrierte Türen lassen sich auf der Südseite öffnen und bieten direkten Zugang zum Bolzplatz oder erweitern die Veranstaltungsfläche in den Freibereich.
Für Veranstaltungen betritt der Besucher das Gebäude auf der Nordseite im OG. Durch die Hanglage des Grundstücks führen dort – ebenso barrierefrei – vier große verglaste Flügeltüren ins Foyer. Nach wenigen Schritten öffnet sich der Blick über eine Galerie von oben in die Halle. Eine kassettenartige Decke überspannt den gesamten Raum. Die Linie der Galeriekante führen die Planer:innen in der Halle mit ihrer Unterteilung in Prallwand und darüber liegender Verglasung fort.
Die klare Struktur der angeordneten Räume erlaubt es auch hier, sich schnell zu orientieren. In einem eingestellten, ebenfalls grün lasierten und vom Tragwerk losgelösten Kubus sind dienende Räume und ein Kiosk untergebracht. Er kann zur Bewirtung der Gäste bei Veranstaltungen im Foyer genutzt werden und erscheint als Fortführung der Funktionsbox aus dem EG.
Recycelbare Holzkonstruktion
Die Mehrzweckhalle brauchte ein robustes Tragwerk: im Sinne der Nutzung, aber natürlich auch in statischer Hinsicht, befindet sich der Standort doch in einer Erdbebenzone. Sie verfügt über ein einfaches, gerichtetes Tragwerk aus vorwiegend heimischem Fichtenholz, d. h. Brettschichtholzträger mit Abmessungen von 20 x 120 cm überspannen im Achsabstand von 2,50 m die Halle 21 m weit und leiten die Lasten des Daches in die Stützen ab. Diese wurden über Stahlwinkel auf der Ortbeton-Bodenplatte mit umlaufendem Stahlbeton-Fertigteilsockel befestigt. Dabei konnten auch Toleranzen aus dem Rohbau ausgeglichen werden. Leimholzbinder ergänzen die Tragkonstruktion im Dach optisch zu einer Kassettendecke, die Eingangsbereich und Halle miteinander verbindet. Massive Brettsperrholzelemente, sowohl in der Fassade im Wechsel mit Verglasungen angeordnet als auch in der Funktionsspange als durchgehende Wand und als Dachfläche, dienen der Aussteifung.
Drei unterschiedliche Holzbauelemente kamen dabei zum Einsatz: einfache Brettsperrholzwände als raumtrennendes Bauteil, in der Fassade integrierte Holzrahmenbau-Dämmelemente und Fassadenmodule mit den eingangs erwähnten Lamellen. Alles wurde für einen möglichst reibungslosen Bauablauf im Werk oder zum Teil vor Ort auf dem Hallenboden vorgefertigt und dann aufgestellt und montiert. Im Sinne der Kreislauffähigkeit kamen nur Schraubverbindungen zur Anwendung. Überall dort, wo ein ebenerdiger Zugang zu Festverglasungen möglich ist, hängte man die Lamellenmodule beweglich auf. Sie können für den Fall der Reinigung nach außen aufgeklappt werden.
Zur energetischen Versorgung erhielt der Neubau eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, ist aber für Spitzenzeiten auch an das Blockheizkraftwerk der benachbarten Feuerwehr angeschlossen. Photovoltaikelemente auf dem Dach versorgen die Wärmepumpe mit Strom, überschüssige Energie wird ins Netz eingespeist.
Auch wenn die Architekt:innen einiges an Überzeugungsarbeit bei den Bauherren leisten mussten, um einen Holzbau zu realisieren – schließlich fiel der massive Vorgängerbau einem Brand zum Opfer –, überwogen die positiven Argumente. Die feinen Holzoberflächen sind überall spürbar und die Nutzer sind glücklich über ihre neue »Markolfhalle« und stolz auf die Resonanz, die das Projekt hervorruft. Neben dem Materialpreis erhielt es auch den Hugo-Häring-Preis 2024 des BDA.
Standort: Pirminweg 5, 78315 Radolfzell
Bauherrin: Stadt Radolfzell, Dezernat III Nachhaltige Stadtentwicklung und Mobilität, Radolfzell
Architektur: STEIMLE ARCHITEKTEN, Stuttgart
Tragwerksplanung: Baustatik Relling, Singen
TGA-Planung (HLSK): Ingenieurbüro Jauch Versorgungstechnik HLS, Radolfzell
TGA-Planung (Elektro): Müller & Bleher Radolfzell GmbH & Co. KG, Radolfzell
Bauphysik: GSA Körner GmbH, Reichenau
Landschaftsarchitektur: Freiraumwerkstadt über Ramboll Studio Dreiseitl, Überlingen
Bauleitung: vt-Architektur, Konstanz
BGF: 2 660 m²
BRI: 13 160 m³
STEIMLE ARCHITEKTEN entwarfen einen kubischen Holzbau über nahezu quadratischem Grundriss, dessen Fassaden von einer klaren vertikalen Holzlamellenstruktur geprägt sind. Das weit auskragende Dach mit seiner schmal zulaufenden Attika wird von sich verjüngenden Holzbalken getragen und zeigt einen regionaltypischen Charakter. Das ebenmäßige Erscheinungsbild setzt sich im Innern der Halle mit ihren schlichten Holzoberflächen fort.
Gemischte Nutzung
Auf der Westseite des Gebäudes gelangen Schulkinder und Sportler der Vereine ebenerdig und barrierefrei durch einen Eingang im EG direkt zu den Umkleiden und zur Sporthalle. Die Nebenräume sind entlang eines langen Flurs parallel zur Halle angeordnet. In einer tannengrün lasierten Box ordnen sich eine Küche, Sanitär-, Dusch-, Umkleide-, Geräte- und Lagerräume an. Eine breite, einläufige Treppe führt hinauf ins Foyer.
Die Bauherren hatten sich für eine 1,5-Feld-Sporthalle entschieden, die in ihren Abmessungen zwar nicht den DIN-Vorgaben für Wettkämpfe und Turniere entspricht, jedoch die größtmögliche Variabilität für die gewünschten Nutzungen bietet. Sie ist mit allen notwendigen Geräten ausgestattet, die für den Schulunterricht und von den Vereinen benötigt werden, und verfügt darüber hinaus über eine seitlich angeschlossene Kulissenbühne. Bei der Einrichtung legten die Architekt:innen besonderen Wert darauf, dass alle Utensilien wie Kletterwand, Sprossenwand, Basketballkörbe u. Ä. bei Veranstaltungen unsichtbar verstaut werden können und nichts den Blick zur Bühne stört. Lediglich der flächengedämpfte Linoleumboden mit Spielfeldmarkierungen erinnert dann noch an die sportliche Nutzung. Die Bühne selbst verschwindet im Sportbetrieb hinter Holzlamellen-Paneelen, kann aber auch als separater Übungs- und Gymnastikraum mit Tageslicht genutzt werden. Sieben flächenbündig in die Prallwand integrierte Türen lassen sich auf der Südseite öffnen und bieten direkten Zugang zum Bolzplatz oder erweitern die Veranstaltungsfläche in den Freibereich.
Für Veranstaltungen betritt der Besucher das Gebäude auf der Nordseite im OG. Durch die Hanglage des Grundstücks führen dort – ebenso barrierefrei – vier große verglaste Flügeltüren ins Foyer. Nach wenigen Schritten öffnet sich der Blick über eine Galerie von oben in die Halle. Eine kassettenartige Decke überspannt den gesamten Raum. Die Linie der Galeriekante führen die Planer:innen in der Halle mit ihrer Unterteilung in Prallwand und darüber liegender Verglasung fort.
Die klare Struktur der angeordneten Räume erlaubt es auch hier, sich schnell zu orientieren. In einem eingestellten, ebenfalls grün lasierten und vom Tragwerk losgelösten Kubus sind dienende Räume und ein Kiosk untergebracht. Er kann zur Bewirtung der Gäste bei Veranstaltungen im Foyer genutzt werden und erscheint als Fortführung der Funktionsbox aus dem EG.
Recycelbare Holzkonstruktion
Die Mehrzweckhalle brauchte ein robustes Tragwerk: im Sinne der Nutzung, aber natürlich auch in statischer Hinsicht, befindet sich der Standort doch in einer Erdbebenzone. Sie verfügt über ein einfaches, gerichtetes Tragwerk aus vorwiegend heimischem Fichtenholz, d. h. Brettschichtholzträger mit Abmessungen von 20 x 120 cm überspannen im Achsabstand von 2,50 m die Halle 21 m weit und leiten die Lasten des Daches in die Stützen ab. Diese wurden über Stahlwinkel auf der Ortbeton-Bodenplatte mit umlaufendem Stahlbeton-Fertigteilsockel befestigt. Dabei konnten auch Toleranzen aus dem Rohbau ausgeglichen werden. Leimholzbinder ergänzen die Tragkonstruktion im Dach optisch zu einer Kassettendecke, die Eingangsbereich und Halle miteinander verbindet. Massive Brettsperrholzelemente, sowohl in der Fassade im Wechsel mit Verglasungen angeordnet als auch in der Funktionsspange als durchgehende Wand und als Dachfläche, dienen der Aussteifung.
Drei unterschiedliche Holzbauelemente kamen dabei zum Einsatz: einfache Brettsperrholzwände als raumtrennendes Bauteil, in der Fassade integrierte Holzrahmenbau-Dämmelemente und Fassadenmodule mit den eingangs erwähnten Lamellen. Alles wurde für einen möglichst reibungslosen Bauablauf im Werk oder zum Teil vor Ort auf dem Hallenboden vorgefertigt und dann aufgestellt und montiert. Im Sinne der Kreislauffähigkeit kamen nur Schraubverbindungen zur Anwendung. Überall dort, wo ein ebenerdiger Zugang zu Festverglasungen möglich ist, hängte man die Lamellenmodule beweglich auf. Sie können für den Fall der Reinigung nach außen aufgeklappt werden.
Zur energetischen Versorgung erhielt der Neubau eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, ist aber für Spitzenzeiten auch an das Blockheizkraftwerk der benachbarten Feuerwehr angeschlossen. Photovoltaikelemente auf dem Dach versorgen die Wärmepumpe mit Strom, überschüssige Energie wird ins Netz eingespeist.
Auch wenn die Architekt:innen einiges an Überzeugungsarbeit bei den Bauherren leisten mussten, um einen Holzbau zu realisieren – schließlich fiel der massive Vorgängerbau einem Brand zum Opfer –, überwogen die positiven Argumente. Die feinen Holzoberflächen sind überall spürbar und die Nutzer sind glücklich über ihre neue »Markolfhalle« und stolz auf die Resonanz, die das Projekt hervorruft. Neben dem Materialpreis erhielt es auch den Hugo-Häring-Preis 2024 des BDA.
Standort: Pirminweg 5, 78315 Radolfzell
Bauherrin: Stadt Radolfzell, Dezernat III Nachhaltige Stadtentwicklung und Mobilität, Radolfzell
Architektur: STEIMLE ARCHITEKTEN, Stuttgart
Tragwerksplanung: Baustatik Relling, Singen
TGA-Planung (HLSK): Ingenieurbüro Jauch Versorgungstechnik HLS, Radolfzell
TGA-Planung (Elektro): Müller & Bleher Radolfzell GmbH & Co. KG, Radolfzell
Bauphysik: GSA Körner GmbH, Reichenau
Landschaftsarchitektur: Freiraumwerkstadt über Ramboll Studio Dreiseitl, Überlingen
Bauleitung: vt-Architektur, Konstanz
BGF: 2 660 m²
BRI: 13 160 m³
Für den Beitrag verantwortlich: deutsche bauzeitung
Ansprechpartner:in für diese Seite: Emre Onur