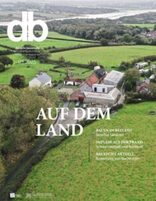Zeitschrift
db 2025|05
Auf dem Land

Bürgerzentrum in Niederwerrn
Die alten Ortslagen veröden rascher denn je, gerade auf dem Land. Gebaut wird dort immer noch bevorzugt am Rand, auf der »grünen Wiese«. Die viel sinnvollere und eigentlich auch wirtschaftlichere Innenentwicklung ist mühsam, aber sie ist machbar – wie eine unterfränkische Gemeinde eindrucksvoll zeigt.
2. Mai 2025 - Christoph Gunßer
Direkt neben der Industriestadt Schweinfurt gelegen, wuchs Niederwerrn mit dieser in den letzten Jahrzehnten de facto zusammen. Seine Einwohnerzahl hat sich seit der Nachkriegszeit mehr als verdoppelt auf heute 8 300. Wie ein zu schwacher Magnet liegt sein alter Dorfkern heute ganz im Westen der Gemeinde, während der Siedlungsbrei sich gen Osten ergießt, zum Oberzentrum Schweinfurt. »Wir sind eine Schlafstadt«, gibt die Bürgermeisterin unumwunden zu. Mit der Gesichtslosigkeit des Sprawl will sie sich indes nicht abfinden.
Als 2014 auch noch die Amerikaner ihre in dieser Zwischenzone gelegene Garnison räumten, begann die Gemeinde deshalb, ein Integriertes Stadtentwicklungskonzept zu erarbeiten. Das noch recht junge Schweinfurter Architekturbüro Schlicht Lamprecht Kern stand ihr dabei zur Seite. »Wir merkten bald, dass wir es mit einer sehr engagierten Verwaltung zu tun hatten«, erzählt Stefan Schlicht, der bereits 17 Kommunen bei ähnlichen Prozessen begleitet hat – und selbst aus einem fränkischen Dorf stammt. Tatsächlich setzte Bürgermeisterin Bettina Bärmann zielstrebig auf die Integration von Alt und Neu in ihrer Gemeinde. Nachdem in Bürgergesprächen deutlich geworden war, dass großer Bedarf an einem Treffpunkt für Feiern und Zusammenkünfte vorhanden war – typisch geselliges Franken – , konzentrierte sich die Planung auf ein neues Bürgerhaus.
Als Standort wählte man den Übergangsbereich vom alten Ortskern zur Nachkriegssiedlung, wo mit dem Schulzentrum, der Bücherei und einer Seniorenwohnanlage bereits Anknüpfungspunkte für einen neuen zentralen Ort vorhanden waren.
Nun aber begann das Puzzlespiel mit den verwinkelten Parzellen des alten Dorfkerns. Im persönlichen Gespräch konnte die Bürgermeisterin einige Eigentümer:innen dazu bewegen, Grundstücke zu verkaufen oder zu tauschen (oder selbst in eine Seniorenwohnung zu ziehen). Am Ende konnten ein alter Stall abgerissen, die benachbarte Scheune als Nahwärme-Zentrale umgenutzt und ein winziges Fachwerkhaus zu einem Museum werden.
Ein Haus aus Stein und eines aus Holz
Auf der Freifläche dazwischen erweiterte man einen vorhandenen Weg zu einer Abfolge aus Plätzen, die das das neue Bürgerhaus in die Mitte nehmen. Dieses Konzept nutzt geschickt den Höhenunterschied entlang des Wegs von rund 9 m, um die Plätze mittels Treppen als Bühne zu gestalten. Sowohl die Bücherei als auch die künftige Musikschule hatten den Wunsch geäußert, hier Freiluftveranstaltungen abhalten zu dürfen. Und auch der traditionelle Plantanz, eine Art Volkstanz zur Kirchweih, soll hier stattfinden.
Der städtebaulichen Körnung des Orts entsprechend, gliedert sich das Bürgerhaus in zwei miteinander verbundene, giebelständige Baukörper. »Ein Haus aus Stein und eines aus Holz,« nennt Stefan Schlicht als Motiv und verweist auf die fränkischen Hofformen der Umgebung, wo oft ein massives Haupthaus von hölzernen Nebengebäuden umgeben sei.
Dem Hangverlauf verdankt die Südseite die mächtigeren Giebelfronten: Hier liegen auf zwei Ebenen Säle (im steinernen Teil) sowie der Eingang mit Lobby (im hölzernen Teil). Auf der Bergseite im Norden befindet sich nur das ebenfalls von der Bürgerschaft gewünschte Café, das unabhängig vom Bürgerhaus betrieben wird.
Aus der gründlichen Analyse des Orts heraus ist diese Aufteilung schlüssig. Stefan Schlicht betont deshalb, wie wichtig es ist, dass Entwicklungskonzept und hochbauliche Ergänzungen aufeinander aufbauen. »Sonst wollen die Architekten nur etwas Schönes hinsetzen und gehen nicht auf den Ort ein«, meint er aus Erfahrung.
Bis ins Detail überzeugt diese Ergänzung der städtebaulichen Situation. Das großzügige räumliche Gefüge im Inneren mit einer bei gesellschaftlichen Anlässen rege genutzten hölzernen Sitztreppe an der Lobby sowie hohen, mehrseitig belichteten Sälen unter raumhaltigen Dächern zeichnet sich im Außenraum schlüssig ab: Vom Saal für Trauungen im OG führen vier Fenstertüren auf den Hauptplatz hinaus – ein beliebtes Fotomotiv bei Hochzeitsgesellschaften, aber auch für Festreden geeignet. Eine weitere Bühne für das bürgerliche Leben.
Bis ins Detail nachhaltig und prägnant
Konstruktiv geht das Ensemble beachtliche neue Wege: Der steinerne Part besteht auf Anregung der Architekten aus R-Beton, recycelt aus dem Abbruchmaterial einer nahen Talbrücke. »Das war sogar günstiger als konventioneller Beton«, berichtet Stefan Schlicht. Veredelt wird die kerngedämmte Konstruktion durch die Oberflächenbearbeitung eines Steinmetzen: Der monolithische, nur durch einzelne, sinnig platzierte Dehnfugen gegliederte Block bekam so eine neben den glatten Laibungen raue, haptische Textur. Vorspringende Stürze über den Fenstern, auf den ersten Blick vielleicht etwas eigenartig, dienen dem Schutz der Klappläden. Heiß dürfte es sommers auf dem (wegen der vielen Events und einer zentralen Zisterne für die Dachentwässerung) recht baumlosen Vorplatz werden.
Der hölzerne Part ist oberhalb des betonierten Sockels ein Holzmassivbau, aus geschosshohen Tafeln sichtbar gefügt. Statt der Lochfassaden wie im Steinbau gibt es hier in Foyer und Café große Glasflächen, die von Lärchenholzstützen gegliedert werden. Gleichartig ist auch das Schaufenster am kleinen Museumsladen vis-à-vis gestaltet, durch das man jederzeit in die Sammlung eines örtlichen Krämers gucken kann (sogar das Licht lässt sich von außen einschalten).
Auch die Ausstattung ist allenthalben handwerklich fein gearbeitet. Eschenparkett, Lamellendecken, farbig belegte Tresen, Schränke und Typografie rahmen die Räume zurückhaltend; das Mobiliar im Café stammt aus einer örtlichen Dorfwirtschaft. Während viele Läden und Lokale inzwischen geschlossen wurden, lebt hier das Dorfleben wieder auf, zu besonderen Anlässen, aber auch im Alltag.
So sollen in einem angrenzenden Altbau die Musikschule und die Kinderbücherei Platz finden. Die unten vorbeiführende Schweinfurter Straße wird verkehrsberuhigt, mehrere Häuser entlang der Straße werden unter Beteiligung der Gemeinde noch umgebaut. Eine solche öffentliche Investition ziehe in der Regel das Sechsfache an privaten Investitionen nach sich, berichtet Stefan Schlicht. Die Städtebauförderung des Freistaats in Höhe von 60 % sowie teilweise eine Leader-Förderung der EU dürften sich also auszahlen – vom praktischen und ästhetischen Gewinn für den Ort einmal ganz abgesehen.
Als 2014 auch noch die Amerikaner ihre in dieser Zwischenzone gelegene Garnison räumten, begann die Gemeinde deshalb, ein Integriertes Stadtentwicklungskonzept zu erarbeiten. Das noch recht junge Schweinfurter Architekturbüro Schlicht Lamprecht Kern stand ihr dabei zur Seite. »Wir merkten bald, dass wir es mit einer sehr engagierten Verwaltung zu tun hatten«, erzählt Stefan Schlicht, der bereits 17 Kommunen bei ähnlichen Prozessen begleitet hat – und selbst aus einem fränkischen Dorf stammt. Tatsächlich setzte Bürgermeisterin Bettina Bärmann zielstrebig auf die Integration von Alt und Neu in ihrer Gemeinde. Nachdem in Bürgergesprächen deutlich geworden war, dass großer Bedarf an einem Treffpunkt für Feiern und Zusammenkünfte vorhanden war – typisch geselliges Franken – , konzentrierte sich die Planung auf ein neues Bürgerhaus.
Als Standort wählte man den Übergangsbereich vom alten Ortskern zur Nachkriegssiedlung, wo mit dem Schulzentrum, der Bücherei und einer Seniorenwohnanlage bereits Anknüpfungspunkte für einen neuen zentralen Ort vorhanden waren.
Nun aber begann das Puzzlespiel mit den verwinkelten Parzellen des alten Dorfkerns. Im persönlichen Gespräch konnte die Bürgermeisterin einige Eigentümer:innen dazu bewegen, Grundstücke zu verkaufen oder zu tauschen (oder selbst in eine Seniorenwohnung zu ziehen). Am Ende konnten ein alter Stall abgerissen, die benachbarte Scheune als Nahwärme-Zentrale umgenutzt und ein winziges Fachwerkhaus zu einem Museum werden.
Ein Haus aus Stein und eines aus Holz
Auf der Freifläche dazwischen erweiterte man einen vorhandenen Weg zu einer Abfolge aus Plätzen, die das das neue Bürgerhaus in die Mitte nehmen. Dieses Konzept nutzt geschickt den Höhenunterschied entlang des Wegs von rund 9 m, um die Plätze mittels Treppen als Bühne zu gestalten. Sowohl die Bücherei als auch die künftige Musikschule hatten den Wunsch geäußert, hier Freiluftveranstaltungen abhalten zu dürfen. Und auch der traditionelle Plantanz, eine Art Volkstanz zur Kirchweih, soll hier stattfinden.
Der städtebaulichen Körnung des Orts entsprechend, gliedert sich das Bürgerhaus in zwei miteinander verbundene, giebelständige Baukörper. »Ein Haus aus Stein und eines aus Holz,« nennt Stefan Schlicht als Motiv und verweist auf die fränkischen Hofformen der Umgebung, wo oft ein massives Haupthaus von hölzernen Nebengebäuden umgeben sei.
Dem Hangverlauf verdankt die Südseite die mächtigeren Giebelfronten: Hier liegen auf zwei Ebenen Säle (im steinernen Teil) sowie der Eingang mit Lobby (im hölzernen Teil). Auf der Bergseite im Norden befindet sich nur das ebenfalls von der Bürgerschaft gewünschte Café, das unabhängig vom Bürgerhaus betrieben wird.
Aus der gründlichen Analyse des Orts heraus ist diese Aufteilung schlüssig. Stefan Schlicht betont deshalb, wie wichtig es ist, dass Entwicklungskonzept und hochbauliche Ergänzungen aufeinander aufbauen. »Sonst wollen die Architekten nur etwas Schönes hinsetzen und gehen nicht auf den Ort ein«, meint er aus Erfahrung.
Bis ins Detail überzeugt diese Ergänzung der städtebaulichen Situation. Das großzügige räumliche Gefüge im Inneren mit einer bei gesellschaftlichen Anlässen rege genutzten hölzernen Sitztreppe an der Lobby sowie hohen, mehrseitig belichteten Sälen unter raumhaltigen Dächern zeichnet sich im Außenraum schlüssig ab: Vom Saal für Trauungen im OG führen vier Fenstertüren auf den Hauptplatz hinaus – ein beliebtes Fotomotiv bei Hochzeitsgesellschaften, aber auch für Festreden geeignet. Eine weitere Bühne für das bürgerliche Leben.
Bis ins Detail nachhaltig und prägnant
Konstruktiv geht das Ensemble beachtliche neue Wege: Der steinerne Part besteht auf Anregung der Architekten aus R-Beton, recycelt aus dem Abbruchmaterial einer nahen Talbrücke. »Das war sogar günstiger als konventioneller Beton«, berichtet Stefan Schlicht. Veredelt wird die kerngedämmte Konstruktion durch die Oberflächenbearbeitung eines Steinmetzen: Der monolithische, nur durch einzelne, sinnig platzierte Dehnfugen gegliederte Block bekam so eine neben den glatten Laibungen raue, haptische Textur. Vorspringende Stürze über den Fenstern, auf den ersten Blick vielleicht etwas eigenartig, dienen dem Schutz der Klappläden. Heiß dürfte es sommers auf dem (wegen der vielen Events und einer zentralen Zisterne für die Dachentwässerung) recht baumlosen Vorplatz werden.
Der hölzerne Part ist oberhalb des betonierten Sockels ein Holzmassivbau, aus geschosshohen Tafeln sichtbar gefügt. Statt der Lochfassaden wie im Steinbau gibt es hier in Foyer und Café große Glasflächen, die von Lärchenholzstützen gegliedert werden. Gleichartig ist auch das Schaufenster am kleinen Museumsladen vis-à-vis gestaltet, durch das man jederzeit in die Sammlung eines örtlichen Krämers gucken kann (sogar das Licht lässt sich von außen einschalten).
Auch die Ausstattung ist allenthalben handwerklich fein gearbeitet. Eschenparkett, Lamellendecken, farbig belegte Tresen, Schränke und Typografie rahmen die Räume zurückhaltend; das Mobiliar im Café stammt aus einer örtlichen Dorfwirtschaft. Während viele Läden und Lokale inzwischen geschlossen wurden, lebt hier das Dorfleben wieder auf, zu besonderen Anlässen, aber auch im Alltag.
So sollen in einem angrenzenden Altbau die Musikschule und die Kinderbücherei Platz finden. Die unten vorbeiführende Schweinfurter Straße wird verkehrsberuhigt, mehrere Häuser entlang der Straße werden unter Beteiligung der Gemeinde noch umgebaut. Eine solche öffentliche Investition ziehe in der Regel das Sechsfache an privaten Investitionen nach sich, berichtet Stefan Schlicht. Die Städtebauförderung des Freistaats in Höhe von 60 % sowie teilweise eine Leader-Förderung der EU dürften sich also auszahlen – vom praktischen und ästhetischen Gewinn für den Ort einmal ganz abgesehen.
Für den Beitrag verantwortlich: deutsche bauzeitung
Ansprechpartner:in für diese Seite: Emre Onur