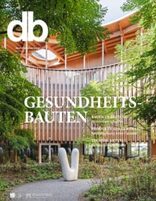Zeitschrift
db 2025|06
Gesundheitsbauten

Universitätsklinikum Münster
Genesender Patient
Sanierungen von Großkomplexen aus den 1970er und 1980er Jahren sind nicht unproblematisch. Insbesondere Krankenhausbauten stellen alle Beteiligten vor erhebliche Herausforderungen. Dem Team von wörner traxler richter gelingt beim UKM die Kür mit Bravour – und das im laufenden Betrieb.
30. Mai 2025 - Hartmut Möller
Das Universitätsklinikum Münster (UKM) zählt mit rund 12 000 Beschäftigten und über 1 500 Betten zu einem der am stärksten frequentierten Gesundheitszentren Deutschlands. Es blickt auf eine wechselvolle Geschichte zurück, die gut 250 Jahre lang eng mit der Medizinischen Fakultät verbunden ist. 1925 als Parkklinik in der westlichen Vorstadt errichtet, folgten nach dem Zweiten Weltkrieg zahlreiche Neubauten. Das gewaltige Zentralklinikum entstand 1972-83 nach den Plänen von Weber Brand & Partner, die zur selben Zeit auch mit der ungleich bekannteren Aachener Uniklinik beschäftigt waren.
Auf einem etwa 400 x 60 x 20 m messenden Quader thronen zwei über 60 m hohe Doppeltürme, die jeweils aus zwei Zylindern und einem diese übereck verbindenden Erschließungskern bestehen. Ihre ikonographische Erscheinung macht sie zum Symbol der Anlage und festem Bestandteil der münsterschen Stadtsilhouette. Die Kosten des geradezu gigantischen Bauwerks beliefen sich damals auf über 1 Milliarde D-Mark, doch keine 25 Jahre nach Fertigstellung stellte sich aufgrund ausufernder Sanierungs- und Energiekosten schon seine Existenzfrage. Überlegungen zu einem Neubau auf der grünen Wiese wurden jedoch nur halbherzig verfolgt, denn vermutlich hätte man den Münsteranern einen Abriss dieses Wahrzeichens nicht nahebringen können. So beschloss der Aufsichtsrat des UKM 2007 eine grundlegende Modernisierung und ließ einen städtebaulichen Masterplan entwickeln. Seit 2018 erstrahlen die vier Bettentürme in neuem Glanz. Kleihues+Kleihues schlugen den Zimmern die ehemals umlaufenden Fluchtbalkone zu, indem sie vor die vorhandenen Betonbrüstungselemente eine gebänderte Fassade hängten. Heute setzt sich der Wechsel von weiß beschichteten Aluminiumblechen und bündigen Glasflächen über die vormals vertikal strukturierten Ecktürme fort und stärkt somit deren Ensemblewirkung.
Münsters Vierzylinder
Das von DS-Plan (eine Ausgründung des Beratungsunternehmens Drees & Sommer) vorgeschlagene zweistufig getrennte Vorgehen ermöglicht für den Anschluss an die Fassadensanierung eine innere Entkernung der Bettentürme. Die an ihre Kapazitätsgrenze stoßenden Aufzüge sind bereits erneuert, doch gut Ding will Weile haben. Allein die Befreiung vom Asbest nahm über ein halbes Jahr Zeit in Anspruch. Demnächst steht die Freiziehung des östlichen Bettenturms an, 2027-29 soll es dann mit dem Ausbau losgehen. Den internen Wettbewerb hierzu konnte das für Krankenhausbauten renommierte Architekturbüro wörner traxler richter für sich entscheiden. Noch heute mutet die Ausstattung der identitätsstiftenden Form mit ihren runden Stationsgrundrissen futuristisch an. Während aber aktuell zwei völlig autarke Pflegestationen auf einer Ebene liegen, sollen die beiden Teller der Türme später zu einer Einheit zusammengeschaltet werden. Übrig bleibt ein eingerückter, zentraler Stützpunkt; dort, wo sich zuvor der zweite befand, entsteht eine Aufenthaltsfläche. Statt bisher 56 wird es lediglich 40 Patient:innen pro Ebene geben. Deren Zimmer mäandern dann als durchgehende Schlange an der Fassade entlang. Dank ihres tortenstückartigen Zuschnitts verfügt jedes über eine 5 m breite Glasfassade mit wintergartenähnlichem Bereich. Jede zweite Zimmertrennwand nimmt zwei Nasszellen auf, sodass jedes Zimmer über eine eigene Badeinheit verfügt. Vor dem Fenster und in der Nische zwischen den Nasszellen sind die Betten gegenüberliegend angeordnet. Schmunzelnd fühlt man sich an die Bettenkonstellation der Eheleute Schminke in Hans Scharouns berühmter Villa in Löbau erinnert. Hierdurch soll ein bevorteilter Platz vermieden, hingegen mehr Raum für Pflege und Besucher:innen geschaffen werden.
In Zusammenarbeit mit Haverkamp Interior Design entstand 2021 auf dem Ostturm als Ebene 21 ein vollverglastes Bistro. Aus dem Fahrstuhl kommend führt der Weg über ein kleines Foyer auf dem einen Zylinder zu einer Lounge mit angrenzendem üppigem Terrassenbereich. Sechs Kiefern neigen sich in ihren mit Bänken gefassten Kübeln, als hätte sie der Wind hier oben in unterschiedliche Richtungen gedrückt. Auf dem anderen Zylinder breitet sich kreisförmig das Café aus. Die jeweiligen lastabtragenden, monumentalen Säulen sind als Sitzlandschaften arrangiert; dank leichter Erhöhung bietet selbst der innere Bereich spektakuläre Aussichten über den Campus und die Weite des Münsterlandes. Ein besonderer Clou: Die Gastronomie ist auch für externe Personen geöffnet.
Luftige Fortschreibung
Der ebenfalls von wörner traxler richter entworfene »Interdisziplinäre Erweiterungsbau am Zentralklinikum« (IEZ) dockt im Westen an den kolossalen Bestand an und erweitert ihn in dessen Längsrichtung um 40 m. Gestalterisches Ziel war eine äußerlich wahrnehmbare formale Einheit von Türmen und Sockelbau, deshalb orientieren sich seine Fassaden in ihrer Lineatur und der Materialwahl – Glas und poliertes Aluminium – in Hochweiß und Braunschwarz an der neuen Optik der Doppelzylinder. Die dunkle Variante ist eine Reminiszenz an die entsprechende Fensterrahmung des in Sichtbeton ausgeführten Vorgängerbaus. Das elegant wirkende Aussehen soll dabei medizinische Präzision ausstrahlen. Hinter den geschlossenen Streifen, die zwar wie Brüstungen anmuten, befinden sich tatsächlich die zwischen den drei Nutzgeschossen eingeschobenen Technikgeschosse gleicher Anzahl. Nicht grundlos verweisen die Architekten auf die weitsichtige Planung ihrer Vorgänger, denn diese Schichtung erst ermöglichte eine Sanierung im laufenden Betrieb. Damit dies auch in Zukunft funktioniert, setzt sich jenes Gefüge im Inneren der Erweiterung fort, ebenso die Säulenstruktur mit Auflagern und die das Rückgrat bildende Magistrale. Deren eingeschnittene, geschossübergreifende Lichtschächte, mächtige Glasflächen, weiße Wände und Böden in Kombination mit Holz lassen den Raum hell, offen, großzügig und freundlich wirken. An der inneren Hauptverkehrsstraße liegen mit Kreißsaal, Wöchnerinnenstation und Neonatologie Wohl und Wehe direkt beieinander.
Auf den sechsgeschossigen Breitfuß setzten die Planenden zudem eine siebte Etage und vergrößern somit die Fläche der Behandlungsbereiche um satte 25 %. In der gemeinsam mit Haverkamp Interior Design gestalteten Privatstation verfügen die Zimmer über eigene, angrenzende Terrassen. Patienten:innen von heute sind »als Kunde eben auch König«. Aufenthalts-, Pflege- und Versorgungsräume greifen fließend ineinander, bepflanzte Lichthöfe, eine weitläufige Führung um die als Sitzbank und mit Lichtbändern inszenierten Pilzstützen erzeugen eine hotelähnliche Atmosphäre; Blickbeziehungen nach außen erleichtern die Orientierung. Im Zentrum der Etage ist ein großer Dachgarten, eine kleine Oase inmitten des Klinikbetriebs, als luftige Erholungsfläche und »gebaute Wertschätzung« für das Personal in Planung. Immerhin ist das UKM der größte Arbeitgeber der Stadt. Zudem verbringen die dort arbeitenden Menschen – im Gegensatz zu den Patientinnen und Patienten, die das Gebäude in der Regel nach ein paar Tagen wieder verlassen – über Jahre hinweg sehr viel Zeit vor Ort.
Zusammen mit dem Planungsteam des UKM wird im laufenden Betrieb der logistische Aufwand gemeistert, einzelne Stationen umzugruppieren und temporär teilweise mehrfach zu verlegen. In der inzwischen wieder über den gekürzten Verbindungsgang angeschlossenen Cafeteria (die wtr bereits 2007 realisiert haben) zeigt sich obendrein, dass die gewählte Architektur wunderbar zeitlos daherkommt: Beide Bauten wirken wie aus einem Guss.
Auf einem etwa 400 x 60 x 20 m messenden Quader thronen zwei über 60 m hohe Doppeltürme, die jeweils aus zwei Zylindern und einem diese übereck verbindenden Erschließungskern bestehen. Ihre ikonographische Erscheinung macht sie zum Symbol der Anlage und festem Bestandteil der münsterschen Stadtsilhouette. Die Kosten des geradezu gigantischen Bauwerks beliefen sich damals auf über 1 Milliarde D-Mark, doch keine 25 Jahre nach Fertigstellung stellte sich aufgrund ausufernder Sanierungs- und Energiekosten schon seine Existenzfrage. Überlegungen zu einem Neubau auf der grünen Wiese wurden jedoch nur halbherzig verfolgt, denn vermutlich hätte man den Münsteranern einen Abriss dieses Wahrzeichens nicht nahebringen können. So beschloss der Aufsichtsrat des UKM 2007 eine grundlegende Modernisierung und ließ einen städtebaulichen Masterplan entwickeln. Seit 2018 erstrahlen die vier Bettentürme in neuem Glanz. Kleihues+Kleihues schlugen den Zimmern die ehemals umlaufenden Fluchtbalkone zu, indem sie vor die vorhandenen Betonbrüstungselemente eine gebänderte Fassade hängten. Heute setzt sich der Wechsel von weiß beschichteten Aluminiumblechen und bündigen Glasflächen über die vormals vertikal strukturierten Ecktürme fort und stärkt somit deren Ensemblewirkung.
Münsters Vierzylinder
Das von DS-Plan (eine Ausgründung des Beratungsunternehmens Drees & Sommer) vorgeschlagene zweistufig getrennte Vorgehen ermöglicht für den Anschluss an die Fassadensanierung eine innere Entkernung der Bettentürme. Die an ihre Kapazitätsgrenze stoßenden Aufzüge sind bereits erneuert, doch gut Ding will Weile haben. Allein die Befreiung vom Asbest nahm über ein halbes Jahr Zeit in Anspruch. Demnächst steht die Freiziehung des östlichen Bettenturms an, 2027-29 soll es dann mit dem Ausbau losgehen. Den internen Wettbewerb hierzu konnte das für Krankenhausbauten renommierte Architekturbüro wörner traxler richter für sich entscheiden. Noch heute mutet die Ausstattung der identitätsstiftenden Form mit ihren runden Stationsgrundrissen futuristisch an. Während aber aktuell zwei völlig autarke Pflegestationen auf einer Ebene liegen, sollen die beiden Teller der Türme später zu einer Einheit zusammengeschaltet werden. Übrig bleibt ein eingerückter, zentraler Stützpunkt; dort, wo sich zuvor der zweite befand, entsteht eine Aufenthaltsfläche. Statt bisher 56 wird es lediglich 40 Patient:innen pro Ebene geben. Deren Zimmer mäandern dann als durchgehende Schlange an der Fassade entlang. Dank ihres tortenstückartigen Zuschnitts verfügt jedes über eine 5 m breite Glasfassade mit wintergartenähnlichem Bereich. Jede zweite Zimmertrennwand nimmt zwei Nasszellen auf, sodass jedes Zimmer über eine eigene Badeinheit verfügt. Vor dem Fenster und in der Nische zwischen den Nasszellen sind die Betten gegenüberliegend angeordnet. Schmunzelnd fühlt man sich an die Bettenkonstellation der Eheleute Schminke in Hans Scharouns berühmter Villa in Löbau erinnert. Hierdurch soll ein bevorteilter Platz vermieden, hingegen mehr Raum für Pflege und Besucher:innen geschaffen werden.
In Zusammenarbeit mit Haverkamp Interior Design entstand 2021 auf dem Ostturm als Ebene 21 ein vollverglastes Bistro. Aus dem Fahrstuhl kommend führt der Weg über ein kleines Foyer auf dem einen Zylinder zu einer Lounge mit angrenzendem üppigem Terrassenbereich. Sechs Kiefern neigen sich in ihren mit Bänken gefassten Kübeln, als hätte sie der Wind hier oben in unterschiedliche Richtungen gedrückt. Auf dem anderen Zylinder breitet sich kreisförmig das Café aus. Die jeweiligen lastabtragenden, monumentalen Säulen sind als Sitzlandschaften arrangiert; dank leichter Erhöhung bietet selbst der innere Bereich spektakuläre Aussichten über den Campus und die Weite des Münsterlandes. Ein besonderer Clou: Die Gastronomie ist auch für externe Personen geöffnet.
Luftige Fortschreibung
Der ebenfalls von wörner traxler richter entworfene »Interdisziplinäre Erweiterungsbau am Zentralklinikum« (IEZ) dockt im Westen an den kolossalen Bestand an und erweitert ihn in dessen Längsrichtung um 40 m. Gestalterisches Ziel war eine äußerlich wahrnehmbare formale Einheit von Türmen und Sockelbau, deshalb orientieren sich seine Fassaden in ihrer Lineatur und der Materialwahl – Glas und poliertes Aluminium – in Hochweiß und Braunschwarz an der neuen Optik der Doppelzylinder. Die dunkle Variante ist eine Reminiszenz an die entsprechende Fensterrahmung des in Sichtbeton ausgeführten Vorgängerbaus. Das elegant wirkende Aussehen soll dabei medizinische Präzision ausstrahlen. Hinter den geschlossenen Streifen, die zwar wie Brüstungen anmuten, befinden sich tatsächlich die zwischen den drei Nutzgeschossen eingeschobenen Technikgeschosse gleicher Anzahl. Nicht grundlos verweisen die Architekten auf die weitsichtige Planung ihrer Vorgänger, denn diese Schichtung erst ermöglichte eine Sanierung im laufenden Betrieb. Damit dies auch in Zukunft funktioniert, setzt sich jenes Gefüge im Inneren der Erweiterung fort, ebenso die Säulenstruktur mit Auflagern und die das Rückgrat bildende Magistrale. Deren eingeschnittene, geschossübergreifende Lichtschächte, mächtige Glasflächen, weiße Wände und Böden in Kombination mit Holz lassen den Raum hell, offen, großzügig und freundlich wirken. An der inneren Hauptverkehrsstraße liegen mit Kreißsaal, Wöchnerinnenstation und Neonatologie Wohl und Wehe direkt beieinander.
Auf den sechsgeschossigen Breitfuß setzten die Planenden zudem eine siebte Etage und vergrößern somit die Fläche der Behandlungsbereiche um satte 25 %. In der gemeinsam mit Haverkamp Interior Design gestalteten Privatstation verfügen die Zimmer über eigene, angrenzende Terrassen. Patienten:innen von heute sind »als Kunde eben auch König«. Aufenthalts-, Pflege- und Versorgungsräume greifen fließend ineinander, bepflanzte Lichthöfe, eine weitläufige Führung um die als Sitzbank und mit Lichtbändern inszenierten Pilzstützen erzeugen eine hotelähnliche Atmosphäre; Blickbeziehungen nach außen erleichtern die Orientierung. Im Zentrum der Etage ist ein großer Dachgarten, eine kleine Oase inmitten des Klinikbetriebs, als luftige Erholungsfläche und »gebaute Wertschätzung« für das Personal in Planung. Immerhin ist das UKM der größte Arbeitgeber der Stadt. Zudem verbringen die dort arbeitenden Menschen – im Gegensatz zu den Patientinnen und Patienten, die das Gebäude in der Regel nach ein paar Tagen wieder verlassen – über Jahre hinweg sehr viel Zeit vor Ort.
Zusammen mit dem Planungsteam des UKM wird im laufenden Betrieb der logistische Aufwand gemeistert, einzelne Stationen umzugruppieren und temporär teilweise mehrfach zu verlegen. In der inzwischen wieder über den gekürzten Verbindungsgang angeschlossenen Cafeteria (die wtr bereits 2007 realisiert haben) zeigt sich obendrein, dass die gewählte Architektur wunderbar zeitlos daherkommt: Beide Bauten wirken wie aus einem Guss.
Für den Beitrag verantwortlich: deutsche bauzeitung
Ansprechpartner:in für diese Seite: Emre Onur