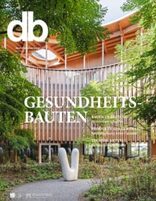Zeitschrift
db 2025|06
Gesundheitsbauten

Kinderspital in Zürich
Für die Kinder, für die Zukunft
Mit dem neuen Kinderspital in Zürich schaffen Herzog & de Meuron eine Krankenhausarchitektur, die Hoffnung weckt. Nach der bereits 2002 fertiggestellten Rehab-Klinik in Basel hat nun auch Zürich ein Klinikgebäude erhalten, das gänzlich – von der Struktur bis zur Materialität – auf das Wohlbefinden und die Heilung von Kindern ausgelegt ist.
30. Mai 2025 - Nele Rickmann
Den Wendepunkt im Verständnis einer neuartigen Krankenhaustypologie läuteten Herzog & de Meuron mit der 2002 in Basel fertiggestellten Rehab-Klinik ein. Merkmale der Gestaltung sind die horizontale Ausdehnung des Gebäudekörpers und eine Materialität, die durch Holz und haptische Oberflächen eine von Atmosphären geprägte Architektur schafft. Die Rehab-Klinik blickt auf eine bald 25-jährige Geschichte zurück und ist eines der bemerkenswertesten Gebäude der Gegenwart. Hinzu kam nun vergangenes Jahr das Kinderspital in Zürich, das sich in den Appell Herzog & de Meurons eingliedert, die Krankenhausarchitektur zu revolutionieren. Das Kinderspital in Zürich ist das erste Projekt seit der Rehab-Klinik in Basel, mit dem dieser Appell als zukunftsweisende Vision in die Realität umgesetzt wurde, gefolgt voraussichtlich 2026 mit der geplanten Fertigstellung vom Nyt Hospital Nordsjælland in Hillerød, Dänemark (von Herzog & de Meuron mit Vilhelm Lauritzen Arkitekter aus Kopenhagen).
Vorgeschichte und Wettbewerb
Das »Kispi« genannte Kinderhospital Zürich blickt auf eine über 150-jährige Geschichte zurück und ist das größte Spital für Kinder und Jugendliche in der Schweiz. Die private und gemeinnützige Eleonorenstiftung entschied sich als Trägerschaft, das Kinderspital auf das Klinikareal in Zürich-Lengg umzusiedeln, da der vorherige Standort im Quartier Hottingen nicht mehr genug Raum für aktuelle Anforderungen bot. Den daraufhin von der Stiftung ausgelobten selektiven und anonymen Wettbewerb gewannen 2012 Herzog & de Meuron. Die Trägerschaft lobte die Wirtschaftlichkeit des Projekts aufgrund seiner geringen Geschossfläche und seines geringen Volumens.
Das neue Klinikensemble in Zürich-Lengg umfasst nun zwei Neubauten: ein Gebäude für Forschung und Lehre auf dem Nord- sowie das Akutspital auf dem Südareal. Dass die unterschiedlichen Nutzungen in separaten Gebäuden untergebracht wurden, ist sinnvoll, da sie anderen Anforderungen gerecht werden müssen. Beide Gebäude funktionieren getrennt, sind allerdings durch einen unterirdischen Gang miteinander verbunden. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse sollen so effizient in die klinische Behandlung eingebracht werden können.
Das Gebäude für Forschung und Lehre ist von zylindrischer Form und umfasst ein zentral gelegenes fünfgeschossiges Atrium, um das sich Hörsäle, Labore sowie individuelle Bereiche für Forschungsgruppen, Seminarräume und Lernbereiche für Studierende anordnen. Mit seiner weiß verputzten Fassade steht es im starken Kontrast zum Akutspital. Dessen hölzerne Fassade verweist nach außen deutlich auf das, was Herzog & de Meuron mit am wichtigsten ist: Eine Materialität, die nicht nur schön anzusehen ist, sondern im weiteren Sinne eine »heilende Kraft« hat, in dem sie die sinnliche Erfahrung des Raums, über die eigentliche Form und Funktion hinaus, in den Mittelpunkt der Spitalarchitektur stellt.
Das Haus als Stadt
Mit seiner feinen Holzfassade gliedert sich das Akutspital als dreigeschossiger Betonskelettbau in die Umgebung des Klinik-Areals Lengg ein. Es funktioniert in seiner horizontalen Ausdehnung und mit einer Gebäudelänge von 200 m wie eine kleine Stadt – geprägt von Straßen, Plätzen und Häusern. Die Häuser, das sind insgesamt 114 Patient:innenzimmer, die sich im 2. OG gereiht und in leicht versetzter Anordnung mit geneigten Dächern von den darunterliegenden Geschossen absetzen. Sie verweisen auf die Individualität einer jeden Patientin und eines jeden Patienten und stellen eine Maßstäblichkeit her – v. a. für die Kleinen, die dort gemeinsam mit ihren Eltern untergebracht werden.
Ein großes Tor spannt sich an der Nordfassade zur Lenggstraße gegenüber der historischen und denkmalgeschützten Psychiatrischen Universitätsklinik von 1869 auf; hier befindet sich der Haupteingang zum Kinderspital. Durch die einladende Geste entsteht ein Vorplatz, der die Eingangssituationen beider Institutionen gleichermaßen betont. Das Kinderspital wird durch einen hinter dem Tor liegenden, offenen Hof betreten, von dem aus das EG erschlossen werden kann. Hier befinden sich öffentliche Nutzungen wie Restaurant und Café, aber auch Behandlungsbereiche wie Tagesklinik und Bilddiagnostik. Eine interne Straße führt an den einzelnen Klinikbereichen vorbei und endet an der Notfallstation, die durch einen an der westlichen Stirnseite gelegenen Eingang von Patient:innen und Personal separat erschlossen werden kann.
Vertikale Achsen bilden regelmäßig angeordnete, betonierte Erschließungskerne. Von der teils öffentlichen Nutzung im EG wird die Nutzung nach oben hin immer privater – bis zu den Zimmern für die jungen Patientinnen und Patienten, die als kleine »Kronen« auf dem festen Baukörper aufsitzen. Im mittleren Geschoss befinden sich weitere Teile der Polikliniken, eine Spitalschule, eine Apotheke und andere gemeinschaftliche Nutzungen. Diese werden von einer Bürozone gerahmt, die sich an den Fassaden entlangstreckt und insgesamt Platz für rund 600 Arbeitsplätze bietet. Neben den betonierten Stützen und Kernen ist im Inneren alles andere in Leichtbauweise ausgeführt. So soll im Kispi – trotz seiner markanten äußeren Form – auch zukünftig eine innere Flexibilität gewährleistet werden.
Die Natur nach innen bringen
Darüber hinaus durchdringen den horizontalen Gebäudekörper grüne Höfe, von den nicht alle bis ins EG reichen. Sie machen eine der größten Qualitäten der Architektur aus, bringen nicht nur Licht und Natur in das Spital, sondern eröffnen auch Blickbeziehungen und vermitteln Zugehörigkeit – auch über die Geschosse hinaus. Die Landschaftsarchitektur übernahmen die Basler Landschaftsarchitekten August + Margrith Künzel in Zusammenarbeit mit Andreas Geser (Zürich), denen eine individuelle Gestaltung der punktuell angeordneten Höfe von eckiger und runder Form durchweg gelungen ist. Die internen Straßen weiten sich zu den Höfen auf, welche auch der Orientierung dienen. Zusätzlich tragen einzelne Kunstwerke – wie die roten Kajaks des Schweizer Künstlers Roman Signer oder die Installation »My Sky« des Lichtkünstlers James Turrell – zur Verortung im Spital bei.
Eine Debatte um das Zürcher Kinderspital, die in den letzten Jahren in der Schweiz öffentlich ausgetragen wurde, drehte sich v. a. um die erhöhten Kosten, die erst den Stararchitekten zugeschrieben wurden, eigentlich aber durch gestiegene Materialpreise aufgrund von Pandemie und Ukrainekrieg begründet sind. Die Frage, ob einer Funktionsarchitektur wie der der Spitäler solch eine inhaltliche und finanzielle »Hürde« entgegengebracht werden müsse, befeuerte die Debatte. Wer das Kispi jedoch einmal besucht hat, weiß, dass diese Diskussion angesichts der zukunftsweisenden Qualitäten der Architektur hinfällig ist. Denn: Herzog & de Meuron beweisen, dass das gängige Bild einer sonst üblichen Krankenhaustypologie der Vergangenheit angehört.
Vorgeschichte und Wettbewerb
Das »Kispi« genannte Kinderhospital Zürich blickt auf eine über 150-jährige Geschichte zurück und ist das größte Spital für Kinder und Jugendliche in der Schweiz. Die private und gemeinnützige Eleonorenstiftung entschied sich als Trägerschaft, das Kinderspital auf das Klinikareal in Zürich-Lengg umzusiedeln, da der vorherige Standort im Quartier Hottingen nicht mehr genug Raum für aktuelle Anforderungen bot. Den daraufhin von der Stiftung ausgelobten selektiven und anonymen Wettbewerb gewannen 2012 Herzog & de Meuron. Die Trägerschaft lobte die Wirtschaftlichkeit des Projekts aufgrund seiner geringen Geschossfläche und seines geringen Volumens.
Das neue Klinikensemble in Zürich-Lengg umfasst nun zwei Neubauten: ein Gebäude für Forschung und Lehre auf dem Nord- sowie das Akutspital auf dem Südareal. Dass die unterschiedlichen Nutzungen in separaten Gebäuden untergebracht wurden, ist sinnvoll, da sie anderen Anforderungen gerecht werden müssen. Beide Gebäude funktionieren getrennt, sind allerdings durch einen unterirdischen Gang miteinander verbunden. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse sollen so effizient in die klinische Behandlung eingebracht werden können.
Das Gebäude für Forschung und Lehre ist von zylindrischer Form und umfasst ein zentral gelegenes fünfgeschossiges Atrium, um das sich Hörsäle, Labore sowie individuelle Bereiche für Forschungsgruppen, Seminarräume und Lernbereiche für Studierende anordnen. Mit seiner weiß verputzten Fassade steht es im starken Kontrast zum Akutspital. Dessen hölzerne Fassade verweist nach außen deutlich auf das, was Herzog & de Meuron mit am wichtigsten ist: Eine Materialität, die nicht nur schön anzusehen ist, sondern im weiteren Sinne eine »heilende Kraft« hat, in dem sie die sinnliche Erfahrung des Raums, über die eigentliche Form und Funktion hinaus, in den Mittelpunkt der Spitalarchitektur stellt.
Das Haus als Stadt
Mit seiner feinen Holzfassade gliedert sich das Akutspital als dreigeschossiger Betonskelettbau in die Umgebung des Klinik-Areals Lengg ein. Es funktioniert in seiner horizontalen Ausdehnung und mit einer Gebäudelänge von 200 m wie eine kleine Stadt – geprägt von Straßen, Plätzen und Häusern. Die Häuser, das sind insgesamt 114 Patient:innenzimmer, die sich im 2. OG gereiht und in leicht versetzter Anordnung mit geneigten Dächern von den darunterliegenden Geschossen absetzen. Sie verweisen auf die Individualität einer jeden Patientin und eines jeden Patienten und stellen eine Maßstäblichkeit her – v. a. für die Kleinen, die dort gemeinsam mit ihren Eltern untergebracht werden.
Ein großes Tor spannt sich an der Nordfassade zur Lenggstraße gegenüber der historischen und denkmalgeschützten Psychiatrischen Universitätsklinik von 1869 auf; hier befindet sich der Haupteingang zum Kinderspital. Durch die einladende Geste entsteht ein Vorplatz, der die Eingangssituationen beider Institutionen gleichermaßen betont. Das Kinderspital wird durch einen hinter dem Tor liegenden, offenen Hof betreten, von dem aus das EG erschlossen werden kann. Hier befinden sich öffentliche Nutzungen wie Restaurant und Café, aber auch Behandlungsbereiche wie Tagesklinik und Bilddiagnostik. Eine interne Straße führt an den einzelnen Klinikbereichen vorbei und endet an der Notfallstation, die durch einen an der westlichen Stirnseite gelegenen Eingang von Patient:innen und Personal separat erschlossen werden kann.
Vertikale Achsen bilden regelmäßig angeordnete, betonierte Erschließungskerne. Von der teils öffentlichen Nutzung im EG wird die Nutzung nach oben hin immer privater – bis zu den Zimmern für die jungen Patientinnen und Patienten, die als kleine »Kronen« auf dem festen Baukörper aufsitzen. Im mittleren Geschoss befinden sich weitere Teile der Polikliniken, eine Spitalschule, eine Apotheke und andere gemeinschaftliche Nutzungen. Diese werden von einer Bürozone gerahmt, die sich an den Fassaden entlangstreckt und insgesamt Platz für rund 600 Arbeitsplätze bietet. Neben den betonierten Stützen und Kernen ist im Inneren alles andere in Leichtbauweise ausgeführt. So soll im Kispi – trotz seiner markanten äußeren Form – auch zukünftig eine innere Flexibilität gewährleistet werden.
Die Natur nach innen bringen
Darüber hinaus durchdringen den horizontalen Gebäudekörper grüne Höfe, von den nicht alle bis ins EG reichen. Sie machen eine der größten Qualitäten der Architektur aus, bringen nicht nur Licht und Natur in das Spital, sondern eröffnen auch Blickbeziehungen und vermitteln Zugehörigkeit – auch über die Geschosse hinaus. Die Landschaftsarchitektur übernahmen die Basler Landschaftsarchitekten August + Margrith Künzel in Zusammenarbeit mit Andreas Geser (Zürich), denen eine individuelle Gestaltung der punktuell angeordneten Höfe von eckiger und runder Form durchweg gelungen ist. Die internen Straßen weiten sich zu den Höfen auf, welche auch der Orientierung dienen. Zusätzlich tragen einzelne Kunstwerke – wie die roten Kajaks des Schweizer Künstlers Roman Signer oder die Installation »My Sky« des Lichtkünstlers James Turrell – zur Verortung im Spital bei.
Eine Debatte um das Zürcher Kinderspital, die in den letzten Jahren in der Schweiz öffentlich ausgetragen wurde, drehte sich v. a. um die erhöhten Kosten, die erst den Stararchitekten zugeschrieben wurden, eigentlich aber durch gestiegene Materialpreise aufgrund von Pandemie und Ukrainekrieg begründet sind. Die Frage, ob einer Funktionsarchitektur wie der der Spitäler solch eine inhaltliche und finanzielle »Hürde« entgegengebracht werden müsse, befeuerte die Debatte. Wer das Kispi jedoch einmal besucht hat, weiß, dass diese Diskussion angesichts der zukunftsweisenden Qualitäten der Architektur hinfällig ist. Denn: Herzog & de Meuron beweisen, dass das gängige Bild einer sonst üblichen Krankenhaustypologie der Vergangenheit angehört.
Für den Beitrag verantwortlich: deutsche bauzeitung
Ansprechpartner:in für diese Seite: Emre Onur