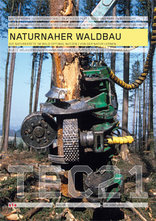Zeitschrift
TEC21 2009|25
Naturnaher Waldbau

Die Naturkräfte im Wald optimal nutzen
Mit dem naturnahen Waldbau sollen die Naturkräfte so gelenkt und in ihrer Wirkung gefördert werden, dass die angestrebten Ziele im bewirtschafteten Wald bestmöglich und effizient erreicht werden. Als Vorbild dienen die natürlichen Abläufe im Wald. Die Idee entstand im 19. Jahrhundert und veränderte das forstliche Denken entscheidend. Wie der Wald bewirtschaftet werden soll, ist jedoch bis heute Gegenstand kontroverser Diskussionen.
19. Juni 2009 - Lukas Denzler
Das Konzept des naturnahen Waldbaus wird in der Schweiz in erster Linie mit Hans Leibundgut in Verbindung gebracht. Leibundgut war Professor für Waldbau an der ETH Zürich von 1940 bis 1979 und eine der markantesten Persönlichkeiten der Schweizer Forstwirtschaft. In seiner langen akademischen Tätigkeit als Hochschullehrer prägte er das Denken und Handeln von zahlreichen Generationen von Forstleuten entscheidend.
Naturnaher Waldbau als umfassendes Konzept
Interessanterweise gibt es bis heute keine genaue Definition des naturnahen Waldbaus. Dessen ungeachtet haben die meisten Waldfachleute in der Schweiz jedoch eine relativ klare Vorstellung davon, was unter naturnahem Waldbau verstanden wird. So ist damit nicht eine spezifische Waldbehandlung gemeint, sondern vielmehr eine Denkhaltung oder ein umfassendes Gesamtkonzept der Waldnutzung. Es geht also um die grundsätzliche Frage, wie der Wald genutzt werden soll.
Jean-Philippe Schütz, der Nachfolger von Leibundgut an der ETH Zürich, zählt zu den Grundprinzipien der naturnahen Nutzung unter anderem naturkonforme Waldbestände mit verschiedenen Baumarten. Ziel ist es, die Produktionskräfte der jeweiligen Waldstandorte, die sehr unterschiedlich sein können, möglichst gut auszunützen. Grundsätzlich ist die Nutzung von Bäumen gleichzeitig auch ein pflegerischer Eingriff. Die Walderneuerung erfolgt zudem kontinuierlich und in der Regel auf natürlichem Weg. Eine erfolgreiche Naturverjüngung setzt allerdings voraus, dass genügend Samenbäume der gewünschten Baumarten vorhanden sind. Weil der naturnahe Waldbau sich auf die örtlichen Verhältnisse abstütze, könne er nicht präzis definiert werden, sagt Schütz. Klar sei hingegen, was nicht dazu gehöre, so zum Beispiel grosse Kahlschläge, Methoden und Eingriffe, die dem Boden schaden, ein grossflächiger Anbau von fremdländischen Baumarten oder der Einsatz von Chemikalien.[1]
Um den Wald in die gewünschte Richtung zu lenken, stehen dem Bewirtschafter ein ganze Palette von Eingriffsmöglichkeiten zur Verfügung. So kann er durch die Jungwaldpflege und das Fällen von bestimmten Bäumen (Durchforstungen) die Baumartenzusammensetzung sowie die Struktur eines Bestandes beeinflussen. Durch die Eingriffsstärke beziehungsweise die Grösse eines Schlages wird bestimmt, wie viel Licht auf den Boden gelangt, was beispielsweise entscheidend dafür ist, ob eher schattentolerante Arten wie die Buche eine Chance haben oder lichtbedürftige Arten wie etwa die Eiche. Jean-Philippe Schütz vergleicht die Methoden des Waldbaus mit einer Werkzeugkiste. Je nach Ausgangssituation und Zielsetzung kommen andere Werkzeuge zum Einsatz. Und es gibt Parallelen zum Ingenieurdenken. So ist nach Schütz zuerst immer der Waldbestand zu analysieren und anschliessend eine Lösung zu suchen, die der Individualität des Bestandes Rechnung trägt. Genau auf diesen Aspekt ist auch eines der am häufigsten zitierten Leitmotive Leibundguts gemünzt: «Jeder Bestand ist etwas Einziges und Einmaliges.»[2]
Karl Gayer und der Mischwald
Die Initialzündung für den naturnahen Waldbau kam jedoch nicht von Hans Leibundgut. Die entscheidenden Anstösse gab in erster Linie Karl Gayer, der von 1878 bis 1893 als Professor für forstliche Produktionslehre an der Universität München wirkte. 1886 veröffentlichte Gayer sein berühmtes Buch «Der gemischte Wald»[3], in dem er die damals üblichen Reinbestände, vorwiegend Fichtenmonokulturen, kritisierte und stattdessen für Mischwälder plädierte. Seine Schrift ist auch heute noch lesenswert, und man nimmt mit Staunen zur Kenntnis, mit welcher Klarheit Gayer vor mehr als 100 Jahren die Probleme erkannt hat. So schrieb er etwa: «Wollte man, wie es ja von vereinzelten Stimmen verlangt wird, einigen wenigen Nadelholzarten die Alleinherrschaft im zukünftigen Walde einräumen, so wäre das jener allgemeine Wälderzustand, in welchem nicht mehr der Eigentümer die Wirtschaft im Walde führt, sondern der Sturm, die Insekten und die übrigen ihn bedrohenden Gefahren und Angriffe, wie es leider an vielen Orten schon heute der Fall ist.» Und weiter: «Es ist ein alterkanntes Gesetz, dass mit jeder Störung des Gleichgewichtes in der natürlichen Ordnung der Dinge, ein verstärktes Heraufwachsen der Gefahren für das Bestehende verknüpft ist.» Diese Äusserungen verdeutlichen, weshalb Gayer zu Recht als Vater des naturnahen Waldbaus betrachtet wird.
In einer Zeit, in der die Forstwirtschaft durch ein flächiges und schematisches Vorgehen geprägt war, schlug der Gelehrte aus München einen völlig neuen Weg ein. Karl Gayer habe das forstliche Denken paradigmatisch verändert, sagt Schütz. Wichtig seien aber auch die Ideen von Adolphe Gurnaud gewesen, der zur selben Zeit in Frankreich die sogenannte Kontrollmethode entwickelt und diese 1878 an der Weltausstellung in Paris vorgestellt habe. Die damals übliche grossflächige Schlagwirtschaft mit ihren gleichförmigen Waldbeständen wurde unter anderem praktiziert, weil dieses Vorgehen einen besseren Überblick ermöglichte und damit die forstliche Planung sehr erleichterte. Aufgrund des Raubbaus am Wald war man bestrebt, nur so viel Holz zu nutzen, wie jeweils auch nachwächst. Den Holzvorrat und den Zuwachs in gemischten und ungleichaltrigen Beständen zuverlässig zu erfassen, war jedoch schwierig. Deshalb teilte man den Wald in gleich grosse Flächen ein, die dann im Turnus genutzt werden sollten. Gurnaud lieferte mit seiner Methode, die auf periodischen Inventuren im Wald beruht, das Werkzeug, um die relevanten Wachstumsgrössen auch in heterogenen Waldbeständen relativ einfach bestimmen zu können.
Durchbruch in der Schweiz
Gayer stiess bei seinen Zeitgenossen auf ein unterschiedliches Echo. Die einen befürworteten seine Ideen, während andere seine Methoden als «Ausbund an Unordnung» charakterisierten. Sein Vorgehen, Löcher in den Wald zu schlagen, um die Walderneuerung einzuleiten, war so ziemlich das Gegenteil von einer klaren räumlichen Ordnung und damit eine Provokation für die klassisch denkenden Forstbeamten. Gurnaud wiederum publizierte zwar viel, seine Kontrollmethode fand im zentralistischen Frankreich aber keine Gnade – als Einzelkämpfer wurde er schliesslich auf eine andere Stelle versetzt.
In der Schweiz hingegen wurden die neuen Ideen aus Deutschland und Frankreich relativ rasch aufgenommen – und auch umgesetzt. An der ETH Zürich war es Arnold Engler, der um 1900 die Gedanken von Gayer übernahm und lehrte. Dazu zählte auch die Idee der Naturverjüngung, wonach der Wald über den Weg der natürlichen Ansamung kontinuierlich erneuert wird und nicht abrupt mittels Kahlschlägen und anschliessender Pflanzungen. Henry Biolley, der als Kreisförster im neuenburgischen Val de Travers wirkte, wandte die von Gurnaud entwickelte Kontrollmethode 1890 in Couvet (NE) zum ersten Mal an. Diese ermöglichte ihm, seine Vision eines ungleichförmigen Waldes, in dem junge und alte Bäume auf engstem Raum zusammenstehen, umzusetzen. Biolley nannte diese Art der Bewirtschaftung «jardinage cultural». Er legte damit den Grundstein für die berühmten Plenterwälder in Couvet, die – obwohl sehr stark durch den Menschen geprägt – als Inbegriff für einen naturnahen Wald gelten. Plenterwälder kommen in der Schweiz traditionellerweise auch im bäuerlich geprägten Emmental vor.
Der Waldbau hat sich somit endgültig von einer schematischen Planung emanzipiert. In seinem 1951 erschienenen Buch «Der Wald»[4] schreibt Leibundgut, einst habe der Förster versucht, die Natur zu beherrschen und ausschliesslich nach seinem Sinn und Geist Wälder zu schaffen und zu formen. Heute aber begnüge sich der Waldbauer damit, als neuer, zusätzlicher Faktor in das unübersichtliche Räderwerk der Natur einzugreifen, um den Lebensablauf des Waldes derart zu lenken, dass der nachhaltig grösstmögliche Nutzen unter geringstem Aufwand erzielt werde. So ist es auch folgerichtig, dass Leibundgut die Urwälder und die dort ablaufenden Prozesse intensiv studierte (vgl. Artikel Seite 26 ff.).
Dennoch bekannte sich Leibundgut zu einer grundsätzlich sehr liberalen Interpretation des naturnahen Waldbaus. So akzeptierte er beispielsweise kleinere Kahlschläge, sofern diese fachlich begründet waren. Seine Überzeugung brachte er auf folgende Kurzformel: «Das wesentliche Merkmal unseres Waldbaus liegt in der Freiheit von jedem Dogma und jeder Schablone.» Diese Unverbindlichkeit wurde verschiedentlich auch kritisiert. Tatsächlich stellt sich die Frage, ob einfach alles erlaubt ist. Natürlich nicht. Und auf gar keinen Fall bedeute dies die komplette Narrenfreiheit des Bewirtschafters, erläutert Schütz. Das Handeln im Wald habe sich primär an den Gegebenheiten der Natur und deren Reaktion zu orientieren.
Beginn des internationalen Umweltschutzes
Leibundgut hatte ein feines Gespür für neue Entwicklungen. So erkannte er sehr früh die Bedeutung einer multifunktional ausgerichteten Waldwirtschaft. «Die waldwirtschaftliche Aufgabe besteht überall namentlich darin, ununterbrochen möglichst viel und möglichst wertvolles Holz zu erzeugen und dabei den Wald in einem Zustand zu erhalten, in welchem er gleichzeitig auch die zahlreichen Wohlfahrts- und Schutzwirkungen in bester Weise auszuüben vermag», schreibt er in seinem Buch 1951. Bereits 1970 organisierte Leibundgut ein sehr gut besuchtes Symposium zum Thema «Schutz unseres Lebensraumes». In jener Zeit formierte sich der Umweltschutz. Der Club of Rome publizierte seinen Bericht zu den «Grenzen des Wachstums». 1972 fand in Stockholm die erste Uno-Konferenz zum Umweltschutz statt, die unter anderem zur Gründung des Umweltprogramms (UNEP) der Vereinten Nationen führte. Ein weiterer Meilenstein der internationalen Bemühungen zum Schutz der Lebensgrundlagen war 1992 die Uno-Konferenz für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro. Seither ist die nachhaltige Entwicklung als allgemein anerkannte Leitlinie in aller Munde. In Rio wurden damals zwei Rahmenkonventionen verabschiedet: die Klima- und die Biodiversitätskonvention. Ursprünglich war auch eine Konvention zum Schutz der Wälder vorgesehen. Sie scheiterte aber am Widerstand der Entwicklungsländer. Stattdessen einigte man sich auf sogenannte Rahmenprinzipien für den Schutz der Wälder.[5]
Das Ziel einer nachhaltigen Nutzung der Wälder liegt global gesehen immer noch in weiter Ferne. Die Ideen des naturnahen Waldbaus haben sich vor allem in West- und Mitteleuropa durchgesetzt. Und es fragt sich, inwiefern die Bezeichnung «naturnaher Waldbau» den Kern der Sache heutzutage noch trifft. Reinhard Mosandl, der Inhaber des Lehrstuhls für Waldbau an der Technischen Universität München, bevorzugt denn auch die Bezeichnungen «ökologischer Waldbau» oder «ökologisch ausgerichtete Waldwirtschaft». Immer mehr spricht man zudem allgemein von Waldökosystemmanagement.[6] Darin kommt zum Ausdruck, dass eine nachhaltige Waldwirtschaft unter den gegenwärtigen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen verschiedenste Ansprüche zu berücksichtigen hat.
Die Sache nicht einfacher macht die Tatsache, dass seit einigen Jahren zahlreiche Forstbetriebe und Waldeigentümer in der Schweiz, aber auch in vielen anderen europäischen Ländern, mit finanziellen Schwierigkeiten konfrontiert sind. Die Erträge aus dem Holzverkauf, die nach wie vor die Haupteinnahmequelle bilden, vermögen die Aufwände immer weniger zu decken. Zum Teil stellt sich auch das Problem, dass Investitionen, die heute getätigt werden (müssten), erst in einigen Jahrzehnten ihren Nutzen erbringen. Entschärft sich die finanzielle Problematik nicht, so könnte dies zu einem ernsthaften Problem für eine ökologisch ausgerichtete Waldwirtschaft werden. Vordringlich ist daher eine kosteneffiziente Waldnutzung, ohne die Vorteile der Naturnähe preiszugeben.
Mechanisierung bringt neue Herausforderungen
Die Forstbetriebe versuchen ihre Lage zu verbessern, indem sie Personal abbauen und sich auf das Wesentliche konzentrieren. Immer mehr werden Arbeiten auch an private Forstunternehmer ausgegliedert, denn diese sind in der Lage, die Holzernte mit grossen Maschinen rentabel zu betreiben. Dies wirft jedoch die zentrale Frage auf, wie die zunehmende Mechanisierung den Waldbau beeinflussen wird. Werden wir anstelle von einem naturnahen Wald bald einen maschinengerechten Wald haben? Reinhard Mosandl verneint dies. Man dürfe sich den Waldbau nicht durch die Maschinen vorschreiben lassen. Und Jean-Philippe Schütz sagt, dass Maschinen grundsätzlich kein Problem seien, solange der Förster die zu fällenden Bäume bestimme. Diese Aufgabe dürfe unter keinen Umständen an den Forstunternehmer oder Maschinisten delegiert werden. Der Fachverein Wald des SIA hat die Problematik der Unternehmereinsätze ebenfalls erkannt. Damit die Zusammenarbeit künftig möglichst geordnet abläuft, wird deshalb eine neue SIA-Norm ausgearbeitet (siehe Kasten).
Klimaänderungen und Zwangsnutzungen
Immer mehr beschäftigt die Waldfachleute auch der Klimawandel. Im Vordergrund stehen vor allem Extremereignisse wie Stürme und Trockenheit. Damit war man zwar auch schon früher konfrontiert. Doch scheinen sich Extremereignisse zu häufen. Seit 1990 haben die durch Stürme oder Borkenkäferbefall bedingten Zwangsnutzungen bedrohlich zugenommen. Gayers Warnung, dem Waldeigentümer oder Bewirtschafter könnte das Zepter im Wald aus der Hand genommen werden, hat jedenfalls nichts an Aktualität eingebüsst. Ganz allgemein geht man davon aus, dass ein naturnaher und gemischter Wald verhältnismässig gut gewappnet ist, um Klimaänderungen standzuhalten. Eine der Schwierigkeiten ist dabei, dass das Ausmass und die Geschwindigkeit des Klimawandels unsicher sind. Anpassungsfähige und gegen Störungen resistente Wälder sind deshalb noch stärker als bisher zu fördern. Anzustreben sind Wälder mit einer hohen Vielfalt an Strukturen und Baumarten.[7] Immer mehr wird auch der Vergleich zu Aktien gemacht. Was in der Finanzwelt als «Risikostreuung» oder «Diversifikation» schon länger bekannt ist (allerdings nicht immer befolgt wird), lässt sich sinngemäss auf die Waldwirtschaft übertragen. Kürzlich entwickelten Wissenschafter der Technischen Universität München erste Modelle über die unterschiedlichen Produktionsrisiken von Mischwäldern und Monokulturen. Dabei integrierten sie auch Elemente aus der Finanztheorie. Und es erstaunt kaum, dass Mischwälder deutlich besser abschnitten als Monokulturen.[8]
Braucht es ein neues ökologisches Sicherheitsnetz?
Während die Waldwirtschaft in den vergangenen Jahren sich über eine mangelnde Holznachfrage beklagte, könnte sich dies bald ändern. Teilweise wird sogar das Gespenst eines neuen Raubbaus infolge eines höheren Bedarfs an erneuerbaren Energien oder Rohstoffen heraufbeschworen. Und auch der Naturschutz könnte unter die Räder kommen. Um die Balance in der Waldwirtschaft nicht zu verlieren, wird deshalb zurzeit über «Grundanforderungen an den naturnahen Waldbau» diskutiert. Das durch das Bundesamt für Umwelt initiierte Projekt soll sicherstellen, dass ein minimales ökologisches Niveau in der Waldwirtschaft auch bei einer erhöhten Holznutzung erreicht wird. Bei der Frage der Verbindlichkeit von solchen minimalen Standards sind sich die Akteure hingegen nicht einig. Der Verband der Schweizer Waldeigentümer sieht keinen zusätzlichen Regulierungsbedarf. Ein grosser Teil der Waldfläche sei ohnehin zertifiziert (siehe Kasten). Die Naturschutzorganisa tionen hingegen begrüssen die Festlegung von minimalen Anforderungen für die Waldbewirtschaftung. Die Kantone finden eine Diskussion grundsätzlich sinnvoll. Wie Ueli Meier, der Präsident der Konferenz der Kantonsoberförster, erklärt, wolle man aber auf keinen Fall neue verbindliche Vorschriften, die in der Praxis gar nicht vollzogen werden könnten. Durch die Verweigerung von Schlagbewilligungen könnten die Kantone immer noch die Notbremse ziehen. Im eidgenössischen Waldgesetz ist in Artikel 21 nämlich festgeschrieben, dass wer im Wald Bäume fällen will, eine Bewilligung des Forstdienstes benötigt.
Vielleicht liegt die Herausforderung künftig ohnehin an einem ganz anderen Ort. Urs Mühlethaler, Professor für Waldökosystemlenkung an der Schweizerischen Hochschule für Landwirtschaft, ortet ein grosses Problem darin, dass die Waldfachleute immer weniger Zeit haben, um Waldbau wirklich auch draussen im Wald zu betreiben. Doch genügend Zeit für diese Kernaufgabe ist Voraussetzung, um die künftige Waldentwicklung entscheidend beeinflussen zu können.
Anmerkungen
[01] J.-Ph. Schütz: Naturnaher Waldbau: gestern, heute, morgen. Schweiz. Zeitschrift für Forstwesen 150, S. 478–483, 1999
[02] J.-Ph. Schütz: Der naturnahe Waldbau Leibundguts: Befreiung von Schemen und Berücksichtigung der Naturgesetze. Schweiz. Zeitschrift für Forstwesen 145, S. 449–462, 1994
[03] K. Gayer: Der gemischte Wald – seine Begründung und Pflege insbesondere durch Horst- und Gruppenwirtschaft. Berlin, 1886
[04] H. Leibundgut: Der Wald – eine Lebensgemeinschaft. Zürich, 1951
[05] Direktion für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe (DEH): Die Schweiz und die Konferenz von Rio über Umwelt und Entwicklung. Schrift enreihe der DEH 3, 1993
[06] R. Mosandl, B. Felbermeier: Vom Waldbau zum Waldökosystemmanagement. Forstarchiv 72, S. 145–151, 2001
[07] P. Brang et al.: Klimawandel als waldbauliche Herausforderung. Schweiz. Zeitschrift für Forstwesen 159, S. 362–373, 2008
[08] T. Knoke, A. Hahn: Baumartenvielfalt und Produktionsrisiken: ein Forschungseinblick und -ausblick. Schweiz. Zeitschrift für Forstwesen 158, S. 312–322, 2007
Naturnaher Waldbau als umfassendes Konzept
Interessanterweise gibt es bis heute keine genaue Definition des naturnahen Waldbaus. Dessen ungeachtet haben die meisten Waldfachleute in der Schweiz jedoch eine relativ klare Vorstellung davon, was unter naturnahem Waldbau verstanden wird. So ist damit nicht eine spezifische Waldbehandlung gemeint, sondern vielmehr eine Denkhaltung oder ein umfassendes Gesamtkonzept der Waldnutzung. Es geht also um die grundsätzliche Frage, wie der Wald genutzt werden soll.
Jean-Philippe Schütz, der Nachfolger von Leibundgut an der ETH Zürich, zählt zu den Grundprinzipien der naturnahen Nutzung unter anderem naturkonforme Waldbestände mit verschiedenen Baumarten. Ziel ist es, die Produktionskräfte der jeweiligen Waldstandorte, die sehr unterschiedlich sein können, möglichst gut auszunützen. Grundsätzlich ist die Nutzung von Bäumen gleichzeitig auch ein pflegerischer Eingriff. Die Walderneuerung erfolgt zudem kontinuierlich und in der Regel auf natürlichem Weg. Eine erfolgreiche Naturverjüngung setzt allerdings voraus, dass genügend Samenbäume der gewünschten Baumarten vorhanden sind. Weil der naturnahe Waldbau sich auf die örtlichen Verhältnisse abstütze, könne er nicht präzis definiert werden, sagt Schütz. Klar sei hingegen, was nicht dazu gehöre, so zum Beispiel grosse Kahlschläge, Methoden und Eingriffe, die dem Boden schaden, ein grossflächiger Anbau von fremdländischen Baumarten oder der Einsatz von Chemikalien.[1]
Um den Wald in die gewünschte Richtung zu lenken, stehen dem Bewirtschafter ein ganze Palette von Eingriffsmöglichkeiten zur Verfügung. So kann er durch die Jungwaldpflege und das Fällen von bestimmten Bäumen (Durchforstungen) die Baumartenzusammensetzung sowie die Struktur eines Bestandes beeinflussen. Durch die Eingriffsstärke beziehungsweise die Grösse eines Schlages wird bestimmt, wie viel Licht auf den Boden gelangt, was beispielsweise entscheidend dafür ist, ob eher schattentolerante Arten wie die Buche eine Chance haben oder lichtbedürftige Arten wie etwa die Eiche. Jean-Philippe Schütz vergleicht die Methoden des Waldbaus mit einer Werkzeugkiste. Je nach Ausgangssituation und Zielsetzung kommen andere Werkzeuge zum Einsatz. Und es gibt Parallelen zum Ingenieurdenken. So ist nach Schütz zuerst immer der Waldbestand zu analysieren und anschliessend eine Lösung zu suchen, die der Individualität des Bestandes Rechnung trägt. Genau auf diesen Aspekt ist auch eines der am häufigsten zitierten Leitmotive Leibundguts gemünzt: «Jeder Bestand ist etwas Einziges und Einmaliges.»[2]
Karl Gayer und der Mischwald
Die Initialzündung für den naturnahen Waldbau kam jedoch nicht von Hans Leibundgut. Die entscheidenden Anstösse gab in erster Linie Karl Gayer, der von 1878 bis 1893 als Professor für forstliche Produktionslehre an der Universität München wirkte. 1886 veröffentlichte Gayer sein berühmtes Buch «Der gemischte Wald»[3], in dem er die damals üblichen Reinbestände, vorwiegend Fichtenmonokulturen, kritisierte und stattdessen für Mischwälder plädierte. Seine Schrift ist auch heute noch lesenswert, und man nimmt mit Staunen zur Kenntnis, mit welcher Klarheit Gayer vor mehr als 100 Jahren die Probleme erkannt hat. So schrieb er etwa: «Wollte man, wie es ja von vereinzelten Stimmen verlangt wird, einigen wenigen Nadelholzarten die Alleinherrschaft im zukünftigen Walde einräumen, so wäre das jener allgemeine Wälderzustand, in welchem nicht mehr der Eigentümer die Wirtschaft im Walde führt, sondern der Sturm, die Insekten und die übrigen ihn bedrohenden Gefahren und Angriffe, wie es leider an vielen Orten schon heute der Fall ist.» Und weiter: «Es ist ein alterkanntes Gesetz, dass mit jeder Störung des Gleichgewichtes in der natürlichen Ordnung der Dinge, ein verstärktes Heraufwachsen der Gefahren für das Bestehende verknüpft ist.» Diese Äusserungen verdeutlichen, weshalb Gayer zu Recht als Vater des naturnahen Waldbaus betrachtet wird.
In einer Zeit, in der die Forstwirtschaft durch ein flächiges und schematisches Vorgehen geprägt war, schlug der Gelehrte aus München einen völlig neuen Weg ein. Karl Gayer habe das forstliche Denken paradigmatisch verändert, sagt Schütz. Wichtig seien aber auch die Ideen von Adolphe Gurnaud gewesen, der zur selben Zeit in Frankreich die sogenannte Kontrollmethode entwickelt und diese 1878 an der Weltausstellung in Paris vorgestellt habe. Die damals übliche grossflächige Schlagwirtschaft mit ihren gleichförmigen Waldbeständen wurde unter anderem praktiziert, weil dieses Vorgehen einen besseren Überblick ermöglichte und damit die forstliche Planung sehr erleichterte. Aufgrund des Raubbaus am Wald war man bestrebt, nur so viel Holz zu nutzen, wie jeweils auch nachwächst. Den Holzvorrat und den Zuwachs in gemischten und ungleichaltrigen Beständen zuverlässig zu erfassen, war jedoch schwierig. Deshalb teilte man den Wald in gleich grosse Flächen ein, die dann im Turnus genutzt werden sollten. Gurnaud lieferte mit seiner Methode, die auf periodischen Inventuren im Wald beruht, das Werkzeug, um die relevanten Wachstumsgrössen auch in heterogenen Waldbeständen relativ einfach bestimmen zu können.
Durchbruch in der Schweiz
Gayer stiess bei seinen Zeitgenossen auf ein unterschiedliches Echo. Die einen befürworteten seine Ideen, während andere seine Methoden als «Ausbund an Unordnung» charakterisierten. Sein Vorgehen, Löcher in den Wald zu schlagen, um die Walderneuerung einzuleiten, war so ziemlich das Gegenteil von einer klaren räumlichen Ordnung und damit eine Provokation für die klassisch denkenden Forstbeamten. Gurnaud wiederum publizierte zwar viel, seine Kontrollmethode fand im zentralistischen Frankreich aber keine Gnade – als Einzelkämpfer wurde er schliesslich auf eine andere Stelle versetzt.
In der Schweiz hingegen wurden die neuen Ideen aus Deutschland und Frankreich relativ rasch aufgenommen – und auch umgesetzt. An der ETH Zürich war es Arnold Engler, der um 1900 die Gedanken von Gayer übernahm und lehrte. Dazu zählte auch die Idee der Naturverjüngung, wonach der Wald über den Weg der natürlichen Ansamung kontinuierlich erneuert wird und nicht abrupt mittels Kahlschlägen und anschliessender Pflanzungen. Henry Biolley, der als Kreisförster im neuenburgischen Val de Travers wirkte, wandte die von Gurnaud entwickelte Kontrollmethode 1890 in Couvet (NE) zum ersten Mal an. Diese ermöglichte ihm, seine Vision eines ungleichförmigen Waldes, in dem junge und alte Bäume auf engstem Raum zusammenstehen, umzusetzen. Biolley nannte diese Art der Bewirtschaftung «jardinage cultural». Er legte damit den Grundstein für die berühmten Plenterwälder in Couvet, die – obwohl sehr stark durch den Menschen geprägt – als Inbegriff für einen naturnahen Wald gelten. Plenterwälder kommen in der Schweiz traditionellerweise auch im bäuerlich geprägten Emmental vor.
Der Waldbau hat sich somit endgültig von einer schematischen Planung emanzipiert. In seinem 1951 erschienenen Buch «Der Wald»[4] schreibt Leibundgut, einst habe der Förster versucht, die Natur zu beherrschen und ausschliesslich nach seinem Sinn und Geist Wälder zu schaffen und zu formen. Heute aber begnüge sich der Waldbauer damit, als neuer, zusätzlicher Faktor in das unübersichtliche Räderwerk der Natur einzugreifen, um den Lebensablauf des Waldes derart zu lenken, dass der nachhaltig grösstmögliche Nutzen unter geringstem Aufwand erzielt werde. So ist es auch folgerichtig, dass Leibundgut die Urwälder und die dort ablaufenden Prozesse intensiv studierte (vgl. Artikel Seite 26 ff.).
Dennoch bekannte sich Leibundgut zu einer grundsätzlich sehr liberalen Interpretation des naturnahen Waldbaus. So akzeptierte er beispielsweise kleinere Kahlschläge, sofern diese fachlich begründet waren. Seine Überzeugung brachte er auf folgende Kurzformel: «Das wesentliche Merkmal unseres Waldbaus liegt in der Freiheit von jedem Dogma und jeder Schablone.» Diese Unverbindlichkeit wurde verschiedentlich auch kritisiert. Tatsächlich stellt sich die Frage, ob einfach alles erlaubt ist. Natürlich nicht. Und auf gar keinen Fall bedeute dies die komplette Narrenfreiheit des Bewirtschafters, erläutert Schütz. Das Handeln im Wald habe sich primär an den Gegebenheiten der Natur und deren Reaktion zu orientieren.
Beginn des internationalen Umweltschutzes
Leibundgut hatte ein feines Gespür für neue Entwicklungen. So erkannte er sehr früh die Bedeutung einer multifunktional ausgerichteten Waldwirtschaft. «Die waldwirtschaftliche Aufgabe besteht überall namentlich darin, ununterbrochen möglichst viel und möglichst wertvolles Holz zu erzeugen und dabei den Wald in einem Zustand zu erhalten, in welchem er gleichzeitig auch die zahlreichen Wohlfahrts- und Schutzwirkungen in bester Weise auszuüben vermag», schreibt er in seinem Buch 1951. Bereits 1970 organisierte Leibundgut ein sehr gut besuchtes Symposium zum Thema «Schutz unseres Lebensraumes». In jener Zeit formierte sich der Umweltschutz. Der Club of Rome publizierte seinen Bericht zu den «Grenzen des Wachstums». 1972 fand in Stockholm die erste Uno-Konferenz zum Umweltschutz statt, die unter anderem zur Gründung des Umweltprogramms (UNEP) der Vereinten Nationen führte. Ein weiterer Meilenstein der internationalen Bemühungen zum Schutz der Lebensgrundlagen war 1992 die Uno-Konferenz für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro. Seither ist die nachhaltige Entwicklung als allgemein anerkannte Leitlinie in aller Munde. In Rio wurden damals zwei Rahmenkonventionen verabschiedet: die Klima- und die Biodiversitätskonvention. Ursprünglich war auch eine Konvention zum Schutz der Wälder vorgesehen. Sie scheiterte aber am Widerstand der Entwicklungsländer. Stattdessen einigte man sich auf sogenannte Rahmenprinzipien für den Schutz der Wälder.[5]
Das Ziel einer nachhaltigen Nutzung der Wälder liegt global gesehen immer noch in weiter Ferne. Die Ideen des naturnahen Waldbaus haben sich vor allem in West- und Mitteleuropa durchgesetzt. Und es fragt sich, inwiefern die Bezeichnung «naturnaher Waldbau» den Kern der Sache heutzutage noch trifft. Reinhard Mosandl, der Inhaber des Lehrstuhls für Waldbau an der Technischen Universität München, bevorzugt denn auch die Bezeichnungen «ökologischer Waldbau» oder «ökologisch ausgerichtete Waldwirtschaft». Immer mehr spricht man zudem allgemein von Waldökosystemmanagement.[6] Darin kommt zum Ausdruck, dass eine nachhaltige Waldwirtschaft unter den gegenwärtigen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen verschiedenste Ansprüche zu berücksichtigen hat.
Die Sache nicht einfacher macht die Tatsache, dass seit einigen Jahren zahlreiche Forstbetriebe und Waldeigentümer in der Schweiz, aber auch in vielen anderen europäischen Ländern, mit finanziellen Schwierigkeiten konfrontiert sind. Die Erträge aus dem Holzverkauf, die nach wie vor die Haupteinnahmequelle bilden, vermögen die Aufwände immer weniger zu decken. Zum Teil stellt sich auch das Problem, dass Investitionen, die heute getätigt werden (müssten), erst in einigen Jahrzehnten ihren Nutzen erbringen. Entschärft sich die finanzielle Problematik nicht, so könnte dies zu einem ernsthaften Problem für eine ökologisch ausgerichtete Waldwirtschaft werden. Vordringlich ist daher eine kosteneffiziente Waldnutzung, ohne die Vorteile der Naturnähe preiszugeben.
Mechanisierung bringt neue Herausforderungen
Die Forstbetriebe versuchen ihre Lage zu verbessern, indem sie Personal abbauen und sich auf das Wesentliche konzentrieren. Immer mehr werden Arbeiten auch an private Forstunternehmer ausgegliedert, denn diese sind in der Lage, die Holzernte mit grossen Maschinen rentabel zu betreiben. Dies wirft jedoch die zentrale Frage auf, wie die zunehmende Mechanisierung den Waldbau beeinflussen wird. Werden wir anstelle von einem naturnahen Wald bald einen maschinengerechten Wald haben? Reinhard Mosandl verneint dies. Man dürfe sich den Waldbau nicht durch die Maschinen vorschreiben lassen. Und Jean-Philippe Schütz sagt, dass Maschinen grundsätzlich kein Problem seien, solange der Förster die zu fällenden Bäume bestimme. Diese Aufgabe dürfe unter keinen Umständen an den Forstunternehmer oder Maschinisten delegiert werden. Der Fachverein Wald des SIA hat die Problematik der Unternehmereinsätze ebenfalls erkannt. Damit die Zusammenarbeit künftig möglichst geordnet abläuft, wird deshalb eine neue SIA-Norm ausgearbeitet (siehe Kasten).
Klimaänderungen und Zwangsnutzungen
Immer mehr beschäftigt die Waldfachleute auch der Klimawandel. Im Vordergrund stehen vor allem Extremereignisse wie Stürme und Trockenheit. Damit war man zwar auch schon früher konfrontiert. Doch scheinen sich Extremereignisse zu häufen. Seit 1990 haben die durch Stürme oder Borkenkäferbefall bedingten Zwangsnutzungen bedrohlich zugenommen. Gayers Warnung, dem Waldeigentümer oder Bewirtschafter könnte das Zepter im Wald aus der Hand genommen werden, hat jedenfalls nichts an Aktualität eingebüsst. Ganz allgemein geht man davon aus, dass ein naturnaher und gemischter Wald verhältnismässig gut gewappnet ist, um Klimaänderungen standzuhalten. Eine der Schwierigkeiten ist dabei, dass das Ausmass und die Geschwindigkeit des Klimawandels unsicher sind. Anpassungsfähige und gegen Störungen resistente Wälder sind deshalb noch stärker als bisher zu fördern. Anzustreben sind Wälder mit einer hohen Vielfalt an Strukturen und Baumarten.[7] Immer mehr wird auch der Vergleich zu Aktien gemacht. Was in der Finanzwelt als «Risikostreuung» oder «Diversifikation» schon länger bekannt ist (allerdings nicht immer befolgt wird), lässt sich sinngemäss auf die Waldwirtschaft übertragen. Kürzlich entwickelten Wissenschafter der Technischen Universität München erste Modelle über die unterschiedlichen Produktionsrisiken von Mischwäldern und Monokulturen. Dabei integrierten sie auch Elemente aus der Finanztheorie. Und es erstaunt kaum, dass Mischwälder deutlich besser abschnitten als Monokulturen.[8]
Braucht es ein neues ökologisches Sicherheitsnetz?
Während die Waldwirtschaft in den vergangenen Jahren sich über eine mangelnde Holznachfrage beklagte, könnte sich dies bald ändern. Teilweise wird sogar das Gespenst eines neuen Raubbaus infolge eines höheren Bedarfs an erneuerbaren Energien oder Rohstoffen heraufbeschworen. Und auch der Naturschutz könnte unter die Räder kommen. Um die Balance in der Waldwirtschaft nicht zu verlieren, wird deshalb zurzeit über «Grundanforderungen an den naturnahen Waldbau» diskutiert. Das durch das Bundesamt für Umwelt initiierte Projekt soll sicherstellen, dass ein minimales ökologisches Niveau in der Waldwirtschaft auch bei einer erhöhten Holznutzung erreicht wird. Bei der Frage der Verbindlichkeit von solchen minimalen Standards sind sich die Akteure hingegen nicht einig. Der Verband der Schweizer Waldeigentümer sieht keinen zusätzlichen Regulierungsbedarf. Ein grosser Teil der Waldfläche sei ohnehin zertifiziert (siehe Kasten). Die Naturschutzorganisa tionen hingegen begrüssen die Festlegung von minimalen Anforderungen für die Waldbewirtschaftung. Die Kantone finden eine Diskussion grundsätzlich sinnvoll. Wie Ueli Meier, der Präsident der Konferenz der Kantonsoberförster, erklärt, wolle man aber auf keinen Fall neue verbindliche Vorschriften, die in der Praxis gar nicht vollzogen werden könnten. Durch die Verweigerung von Schlagbewilligungen könnten die Kantone immer noch die Notbremse ziehen. Im eidgenössischen Waldgesetz ist in Artikel 21 nämlich festgeschrieben, dass wer im Wald Bäume fällen will, eine Bewilligung des Forstdienstes benötigt.
Vielleicht liegt die Herausforderung künftig ohnehin an einem ganz anderen Ort. Urs Mühlethaler, Professor für Waldökosystemlenkung an der Schweizerischen Hochschule für Landwirtschaft, ortet ein grosses Problem darin, dass die Waldfachleute immer weniger Zeit haben, um Waldbau wirklich auch draussen im Wald zu betreiben. Doch genügend Zeit für diese Kernaufgabe ist Voraussetzung, um die künftige Waldentwicklung entscheidend beeinflussen zu können.
Anmerkungen
[01] J.-Ph. Schütz: Naturnaher Waldbau: gestern, heute, morgen. Schweiz. Zeitschrift für Forstwesen 150, S. 478–483, 1999
[02] J.-Ph. Schütz: Der naturnahe Waldbau Leibundguts: Befreiung von Schemen und Berücksichtigung der Naturgesetze. Schweiz. Zeitschrift für Forstwesen 145, S. 449–462, 1994
[03] K. Gayer: Der gemischte Wald – seine Begründung und Pflege insbesondere durch Horst- und Gruppenwirtschaft. Berlin, 1886
[04] H. Leibundgut: Der Wald – eine Lebensgemeinschaft. Zürich, 1951
[05] Direktion für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe (DEH): Die Schweiz und die Konferenz von Rio über Umwelt und Entwicklung. Schrift enreihe der DEH 3, 1993
[06] R. Mosandl, B. Felbermeier: Vom Waldbau zum Waldökosystemmanagement. Forstarchiv 72, S. 145–151, 2001
[07] P. Brang et al.: Klimawandel als waldbauliche Herausforderung. Schweiz. Zeitschrift für Forstwesen 159, S. 362–373, 2008
[08] T. Knoke, A. Hahn: Baumartenvielfalt und Produktionsrisiken: ein Forschungseinblick und -ausblick. Schweiz. Zeitschrift für Forstwesen 158, S. 312–322, 2007
Für den Beitrag verantwortlich: TEC21
Ansprechpartner:in für diese Seite: Judit Solt