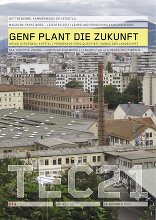Zeitschrift
TEC21 2013|43
Genf plant die Zukunft

Genfs Lust auf ein neues Städtebau-Kapitel
Schonungslos rechnet die Genfer Regierung mit der Stadtentwicklung der vergangenen Jahrzehnte ab. Der neue kantonale Richtplan soll die Folgen von 40 Jahren planerischem Stillstand korrigieren. Dafür werden gesetzliche Grundlagen und Planungsverfahren erneuert. Neue Bauformen sollen Genfs Rückkehr zu einem innovativen Städtebau beflügeln, das für die Stadt so charakteristische Scheibenhochhaus hat ausgedient.
18. Oktober 2013 - Cedric van der Poel
Im Februar 2013 verabschiedete die Genfer Kantonsregierung den neuen kantonalen Richtplan 2030. Die vorangegangene Konsultation der Verwaltung und die öffentliche Vernehmlassung hatten die grundsätzlichen Ziele des Entwurfs nicht infrage gestellt. Da der technisch formulierte Richtplan nicht für alle verständlich ist, hat der Regierungsrat dazu eine Broschüre herausgegeben und sie mit dem ebenso reizvollen wie doppeldeutigen Wortspiel «Genève Envie» betitelt.[2] Die Publikation übersetzt die technischen Paragrafen in politische Willensbekundungen und macht die Absichten der Regierung im Bereich der Stadt- und Raumentwicklung deutlich, nicht zuletzt im Hinblick auf die Behandlung des neuen Richtplans im Kantonsrat, der ihn am 20. September ebenfalls gutgeheissen hat. Die Broschüre enthält erstaunliche Aussagen, auch wenn sie nicht viel Konkretes über den Inhalt des neuen Richtplans verrät und jenen, die sich zur Sache äussern wollen, dessen Lektüre nicht erspart. Die Illustration tendiert in Richtung Stadtmarketing, der Text jedoch überhaupt nicht. Bei aufmerksamem Lesen wird klar, dass er eher zur Kategorie der politischen Weissbücher gehört, die einen historischen Bruch markieren wollen.
Schonungslose Stadtkritik
Wer den Willen zu einem Bruch bekundet, hat eine Bestandsaufnahme gemacht. Der Befund der Kantonsregierung ist schonungslos. Er beschreibt den Kanton in der Broschüre als monozentrisches Gebiet, in dessen Kern «sich alle Begierden und alle Frustrationen kristallisieren»[3], mit einem Zentrum, das der Arbeit und dem Konsum vorbehalten sei, tagsüber belebt, doch «nachts und am Wochenende verlassen, abgesehen von einigen Touristen und unerlaubten Aktivitäten», und mit Randgebieten, «in denen man nichts tut ausser schlafen»[4]. Ein Kanton, in dem die Wohnungsknappheit und die Höhe der Mieten für einen «neuen Feudalismus» und «Schmugglerpraktiken»[5] gesorgt hätten, in dem Familien verarmten und die Nettoeinkommen der Haushalte zu den niedrigsten der Schweiz gehörten, wo «junge Familien mehr arbeiten müssen und mehr Zeit brauchen, um vom Wohn- zum Arbeitsort zu gelangen, dafür weniger Zeit für ihre Kinder finden und am Monatsende nach dem Begleichen von Miete und Kinderbetreuungskosten weniger Geld haben.»[6] Schliesslich beurteilt der Regierungsrat trocken und ohne Umschweife die Wohnbauarchitektur der vergangenen Jahre: «Seit mehreren Jahrzehnten scheinen Fantasie und Kreativität, was den Wohnungsbau angeht, unseren Kanton verlassen zu haben. Die behördliche Praxis und die kantonalen Normen sind dafür mitverantwortlich. Wir errichten nur noch standardisierte Bauten, rechteckige Quader mit ebenso normierten, traurigen Rasenstreifen. Diese sind zu klein für die Ballspiele der Kinder und zu nah an den Fassaden, als dass Geruch und Rauch einer Grillade erträglich wären, umgekehrt aber so gross, dass auf den Trottoirs kein Raum bleibt, wo sich eine urbane Betriebsamkeit entfalten könnte», kurz: «Quartiere, die niemanden zum Träumen bringen.»[7] Nach dieser Zustandsanalyse würde man Genf am liebsten verlassen – doch die Broschüre verkündet Lust auf Veränderungen. Sie betreffen die Gesetzgebung und die behördliche Praxis in den Bereichen Architektur, Städtebau und Stadtentwicklung und auch die Architektur selbst: Statt der «Barres», der in Genf allgegenwärtigen Scheibenhochhäuser, sollen endlich andere bauliche Formen gefunden werden. Die im Richtplan 2030 vorgesehenen Stadterweiterungen und Nachverdichtungen bieten reichlich Gelegenheit zur architektonischen Formsuche, allerdings müssen noch einige hemmende gesetzliche Grundlagen und behördliche Verfahren modernisiert werden, bevor die jahrzehntealte Blockade der Genfer Stadtentwicklungspolitik überwunden werden kann.
Gesetzesänderungen für die sozialräumliche Entwicklung
Im August 2013 wurde das Gesetz über die Zonen für industrielle oder gemischte Nutzung[8] angepasst; dabei wurden die strikten Nutzungsvorschriften für Industriezonen aufgeweicht. Diese dürfen künftig 40 % Dienstleistungen, Kultur und Veranstaltungen enthalten. Das führt zur Frage, wie solche Mischzonen gestaltet werden und wie Architekturen aussehen sollen, die gleichzeitig Produktionsbetriebe, Dienstleistungen und Freizeitaktivitäten aufnehmen. Dass die Industriezonen nicht mehr einer unkoordinierten, chaotischen Entwicklung geopfert werden, zeigt sich auch darin, dass für die Industriezonen von Meyrin, Satigny und Vernier – eines von zehn prioritären Grossprojekte im Richtplan 2030 – vor Kurzem ein übergreifender Planungsauftrag ausgeschrieben wurde.
Eine andere vom Regierungsrat angestrebte Änderung betrifft einen neuen Lastenausgleich. Heute zahlen Bewohner des Kantons Genf einen Grossteil der Gemeindesteuern am Arbeitsort und nicht, wie in anderen Kantonen, in der Wohngemeinde. Dies regt die Gemeinden nicht zur Förderung des Wohnungsbaus an und trägt zum finanziellen Gefälle zwischen ihnen bei. Eine Korrektur erscheint im Hinblick auf die Grossprojekte des Richtplans 2030 und auf die Investitionen, die etliche Gemeinden dafür erbringen müssen, zwingend.
Neue Planungsverfahren für bessere Architektur
Während diese Änderungen auf Gesetzesebene vor allem die funktionale Vielfalt der Quartiere und die soziale Durchmischung der Bevölkerung beeinflussen und für ein Gleichgewicht in der sozialräumlichen Entwicklung sorgen wollen, zielen Veränderungen bei den behördlichen Verfahren auf bauliche Verdichtung und architektonische Vielfalt. Seit November 2012 beraten Stadtplaner, Architekturschaffende, Projektentwickler und Vertreter verschiedener Verwaltungsebenen ausführlich über die Art und Weise, wie das Verfahren des «Plan localisé de Quartier» (PLQ, vgl. Kasten) künftig durchgeführt werden soll. Die Ziele sind einfachere und systematischere Abläufe, eine grössere Effizienz des Verfahrens und eine bessere Qualität. Die Diskussion ist noch im Gang, doch konnte Kantonsarchitekt Francesco della Casa schon einige Wege vorspuren.
Eine wichtige Änderung betrifft die Reichweite des PLQ: Die heute übliche Regulierungsdichte könnte durch einen «Mantelperimeter» ersetzt werden, auf dem Varianten getestet werden können. Dies zielt auf die bisherige behördliche Praxis, nicht nur die Lage der Bauten, sondern auch deren Form und Nutzung zu diktieren. Della Casa räumt ein: «Der Kanton hat seine Rolle manchmal überinterpretiert. Unser Ziel ist nicht, im Städtebau und in der Stadtgestaltung die Hauptrolle zu spielen, sondern Regeln aufzustellen – etwa über die Bezüge zwischen Baufront und Strasse –, zwischen Privatgrund und öffentlichem Raum oder zwischen Erdgeschoss und Strasse, auf deren Basis die Planer ihr Projekt entwickeln und realisieren können.»[9]
Künftig soll das PLQ-Verfahren in vier Etappen unterteilt werden: In einer ersten Phase werden die Interessen der verschiedenen Akteure, namentlich der Grundbesitzer, geklärt. Es folgt eine Phase mit Machbarkeitsstudien, in der bereits zum ersten Mal die Vertreter der bewilligenden Amtsstellen zusammenkommen sollen, um technische Rahmenbedingungen und Hauptziele des PLQ herauszuschälen. Diese Phase soll das Verfahren wesentlich vereinfachen, denn «die 42 behördlichen Instanzen, die zu einem PLQ Stellung nehmen müssen, sollen das nicht mehr einzeln, eine nach der andern tun, sondern mehrere von ihnen werden zusammengerufen – je nach thematischer Prioritätensetzung die einen früher, die anderen etwas später. Das sollte uns erlauben, den Planungsgebieten einen deutlicheren Charakter zu geben und dann rasch eine Übereinstimmung zu erzielen», erklärt della Casa. Die beiden letzten Phasen betreffen die Koordination und die technische Umsetzung des Plans. Diese Änderungen sollen das Planungsverfahren stärker im konkreten städtischen und landschaftlichen Kontext verankern, den Architekturschaffenden mehr Freiheit bei der Ausarbeitung der Bauprojekte lassen und die architektonische Vielfalt fördern.
Die politische wie die fachliche Debatte werden gegenwärtig von der baulichen Verdichtung beherrscht. Die politische, weil das Volk nach einem Referendum zum erneuerten Gesetz über die Entwicklungszonen Stellung nehmen muss und dieses Gesetz für jede Zone Mindestausnützungsziffern in den PLQ einführen will. Die fachliche Debatte, weil diese Mindestausnützungsziffer nicht alle Fachleute überzeugt. Denn sie kommt zu der bereits im Zonenplan festgelegten Ausnützungsziffer hinzu und droht damit die Planung noch komplizierter zu machen, als sie jetzt schon ist. Und Baudirektor François Longchamp liess verlauten, die Idee stamme nicht von der Regierung, diese könne auch ohne sie leben.[10]
Das Scheibenhochhaus ist tot
Betrachtet man alle diese Gesetzes- und Verfahrensänderungen, zeichnet sich der Umriss einer neuen städtebaulichen Vision ab. Sie verwirft Teile der architektonischen Produktion der Nachkriegszeit und gliedert sich in den aktuellen Diskurs ein, der sich um die soziale und funktionelle Durchmischung, den öffentlichen Raum, Dichte und urbane Intensität, die gemeinsame Nutzung von Räumen und um typologische und formale Vielfalt dreht. «Vergleicht man Luftaufnahmen von Basel und von Genf, springt ein Unterschied ins Auge», erläutert della Casa. «Zwei relativ flache, von einem Fluss durchströmte Gegenden im selben Land – doch zwei ganz verschiedene Traditionen: Blockrandbebauung in Basel, Scheibenhochhäuser in Genf. Das vom Architekten Denis Honegger in Genf in der Nachkriegszeit perfektionierte System der Vorfabrikation von Hochhausscheiben aus Beton war so effizient, dass es alle anderen Formen verdrängen konnte.»
Der historische Bruch, den die Regierung in «Genève Envie» verkündet, vollzieht mit einigen Jahren Verspätung eine Entwicklung nach, die der an der ETH Lausanne lehrende französische Architekt und Architekturhistoriker Jacques Lucan in seinem Buch «Où va la ville aujourd’hui? Formes urbaines et mixités» beschreibt. Ausgehend von einer gründlichen Untersuchung der Erfahrungen, die in Frankreich seit den 1990er-Jahren mit den «Zones d’aménagement concertés» (ZAC) gemacht werden, zeigt er, dass sich aus den wichtigsten inhaltlichen Anliegen der Stadtentwicklung eine neue Art von Planungsverfahren entwickelt hat.[11] Hier finden sich Vokabular und Leitmotive der aktuellen Genfer Debatte wieder: soziale Durchmischung und funktionale Vielfalt, gemeinsame und flexible Nutzungen, Partnerschaft und Verhandlung zwischen Behörden und privaten Akteuren. Und wie in den jüngsten Genfer Planungen kommt die differenziert gestaltete offene Blockrandbebauung als Bauform zum Zug. Lucan bezieht sich dabei auf Bauten und Theorie des französischen Architekten Christian de Portzamparc. Ihm zufolge tritt die moderne europäische Stadt – nach dem 19. Jahrhundert mit geschlossener Blockrandbebauung und der klassischen Moderne mit frei im Raum stehenden Bauten – heute mit dem differenziert und individuell überbauten Block als prägender Bauform in ihre dritte historische Phase ein.[12]
Steht Genf vor diesem städtebaulichen Übergang? Politik und Architekturszene haben genug vom Scheibenhochhaus. Zwar ist der Richtplan 2030 nicht auf eine bestimmte architektonische Form angewiesen, doch scheint es in erster Linie um einen psychologischen Faktor zu gehen: Man sehnt sich nach neuen Formen, die den Aufbruch signalisieren, um den längst umfassend diskutierten Richtplan endlich umsetzen zu können. Den Mumm, aus dessen Prinzipien eigene Formen zu entwickeln, scheint man allerdings noch nicht gefunden zu haben und sucht deshalb Referenzen in der französischen Postmoderne.
Doch Zeichen des Aufbruchs gibt es viele: die Rede vom historischen Bruch, die Dringlichkeit, die Grossprojekten wie der Entwicklung des Gebiets Praille-Acacias-Vernets eingeräumt wird (Tec21 36/2011, S. 22), die Fortschritte beim Bau der S-Bahn CEVA (Tec21 36/2011, S. 27), die Aufmerksamkeit, die dem öffentlichen Raum zukommt, und der Eifer, den Bauvorstand François Longchamp bei der Erneuerung der Gesetze an den Tag legt. Vorerst eher kleine Projekte privater Akteure, bei denen das Vorgehen an neuere französische Quartierplanungen erinnert, bestärken die Hoffnung (vgl. S. 28). Doch der Nachholbedarf aus den vergangenen Jahrzehnten ist enorm und die Skepsis der Fachleute nach wie vor gross. Der einzige Weg, die «Envie» der Genferinnen und Genfer wieder zu wecken, ist wohl, die bisherige Übervorsichtigkeit aufzugeben, den Mut zum Fehlermachen zu finden und von einer Planungspraxis der Berichte, Studien und Pläne endlich zum Bauen und Ausprobieren überzugehen.
Anmerkungen:
[01] Informationen und Dokumente zum Richtplan 2030: http://etat.geneve.ch/dt/amenagement/projet_pdcn_2030-686-4369.html
[02] République et Canton de Genève: Genève Envie, Februar 2013. (PDF: http://etat.geneve.ch/geo-data/SIAMEN/PDCn/PDCn_CE_Brochure.pdf)
[03] République et Canton de Genève: Genève Envie, Februar 2013, S. 11.
4 Ebd. S. 8.
5 Ebd. S. 16.
6 Ebd. S. 20.
7 Ebd. S. 24.
[08] Loi générale sur les zones de développement industriel ou d’activités mixtes (LGZDI).
[09] Alle Aussagen von Kantonsarchitekt Francesco
della Casa stammen aus einem Gespräch mit Koautor Cedric van der Poel im August 2013 in Genf.
[10] «Décroître, pour une ville, c’est la mort» in: Le Temps, 18.7.2013.
[11] Jacques Lucan: Ou va la ville aujourd’hui? Formes urbaines et mixités. Paris 2012, S. 9.
[12] Christian de Portzamparc: «La ville âge III», Vortrag an den Conferences Paris d’architectes im Pavillon de l’Arsenal 1994. Les mini-PA, Nr. 5, Paris 1995, zit. nach Lucan, a .a. O., S. 43–46; vgl. auch Lucan, a. a. O., S. 45.
Schonungslose Stadtkritik
Wer den Willen zu einem Bruch bekundet, hat eine Bestandsaufnahme gemacht. Der Befund der Kantonsregierung ist schonungslos. Er beschreibt den Kanton in der Broschüre als monozentrisches Gebiet, in dessen Kern «sich alle Begierden und alle Frustrationen kristallisieren»[3], mit einem Zentrum, das der Arbeit und dem Konsum vorbehalten sei, tagsüber belebt, doch «nachts und am Wochenende verlassen, abgesehen von einigen Touristen und unerlaubten Aktivitäten», und mit Randgebieten, «in denen man nichts tut ausser schlafen»[4]. Ein Kanton, in dem die Wohnungsknappheit und die Höhe der Mieten für einen «neuen Feudalismus» und «Schmugglerpraktiken»[5] gesorgt hätten, in dem Familien verarmten und die Nettoeinkommen der Haushalte zu den niedrigsten der Schweiz gehörten, wo «junge Familien mehr arbeiten müssen und mehr Zeit brauchen, um vom Wohn- zum Arbeitsort zu gelangen, dafür weniger Zeit für ihre Kinder finden und am Monatsende nach dem Begleichen von Miete und Kinderbetreuungskosten weniger Geld haben.»[6] Schliesslich beurteilt der Regierungsrat trocken und ohne Umschweife die Wohnbauarchitektur der vergangenen Jahre: «Seit mehreren Jahrzehnten scheinen Fantasie und Kreativität, was den Wohnungsbau angeht, unseren Kanton verlassen zu haben. Die behördliche Praxis und die kantonalen Normen sind dafür mitverantwortlich. Wir errichten nur noch standardisierte Bauten, rechteckige Quader mit ebenso normierten, traurigen Rasenstreifen. Diese sind zu klein für die Ballspiele der Kinder und zu nah an den Fassaden, als dass Geruch und Rauch einer Grillade erträglich wären, umgekehrt aber so gross, dass auf den Trottoirs kein Raum bleibt, wo sich eine urbane Betriebsamkeit entfalten könnte», kurz: «Quartiere, die niemanden zum Träumen bringen.»[7] Nach dieser Zustandsanalyse würde man Genf am liebsten verlassen – doch die Broschüre verkündet Lust auf Veränderungen. Sie betreffen die Gesetzgebung und die behördliche Praxis in den Bereichen Architektur, Städtebau und Stadtentwicklung und auch die Architektur selbst: Statt der «Barres», der in Genf allgegenwärtigen Scheibenhochhäuser, sollen endlich andere bauliche Formen gefunden werden. Die im Richtplan 2030 vorgesehenen Stadterweiterungen und Nachverdichtungen bieten reichlich Gelegenheit zur architektonischen Formsuche, allerdings müssen noch einige hemmende gesetzliche Grundlagen und behördliche Verfahren modernisiert werden, bevor die jahrzehntealte Blockade der Genfer Stadtentwicklungspolitik überwunden werden kann.
Gesetzesänderungen für die sozialräumliche Entwicklung
Im August 2013 wurde das Gesetz über die Zonen für industrielle oder gemischte Nutzung[8] angepasst; dabei wurden die strikten Nutzungsvorschriften für Industriezonen aufgeweicht. Diese dürfen künftig 40 % Dienstleistungen, Kultur und Veranstaltungen enthalten. Das führt zur Frage, wie solche Mischzonen gestaltet werden und wie Architekturen aussehen sollen, die gleichzeitig Produktionsbetriebe, Dienstleistungen und Freizeitaktivitäten aufnehmen. Dass die Industriezonen nicht mehr einer unkoordinierten, chaotischen Entwicklung geopfert werden, zeigt sich auch darin, dass für die Industriezonen von Meyrin, Satigny und Vernier – eines von zehn prioritären Grossprojekte im Richtplan 2030 – vor Kurzem ein übergreifender Planungsauftrag ausgeschrieben wurde.
Eine andere vom Regierungsrat angestrebte Änderung betrifft einen neuen Lastenausgleich. Heute zahlen Bewohner des Kantons Genf einen Grossteil der Gemeindesteuern am Arbeitsort und nicht, wie in anderen Kantonen, in der Wohngemeinde. Dies regt die Gemeinden nicht zur Förderung des Wohnungsbaus an und trägt zum finanziellen Gefälle zwischen ihnen bei. Eine Korrektur erscheint im Hinblick auf die Grossprojekte des Richtplans 2030 und auf die Investitionen, die etliche Gemeinden dafür erbringen müssen, zwingend.
Neue Planungsverfahren für bessere Architektur
Während diese Änderungen auf Gesetzesebene vor allem die funktionale Vielfalt der Quartiere und die soziale Durchmischung der Bevölkerung beeinflussen und für ein Gleichgewicht in der sozialräumlichen Entwicklung sorgen wollen, zielen Veränderungen bei den behördlichen Verfahren auf bauliche Verdichtung und architektonische Vielfalt. Seit November 2012 beraten Stadtplaner, Architekturschaffende, Projektentwickler und Vertreter verschiedener Verwaltungsebenen ausführlich über die Art und Weise, wie das Verfahren des «Plan localisé de Quartier» (PLQ, vgl. Kasten) künftig durchgeführt werden soll. Die Ziele sind einfachere und systematischere Abläufe, eine grössere Effizienz des Verfahrens und eine bessere Qualität. Die Diskussion ist noch im Gang, doch konnte Kantonsarchitekt Francesco della Casa schon einige Wege vorspuren.
Eine wichtige Änderung betrifft die Reichweite des PLQ: Die heute übliche Regulierungsdichte könnte durch einen «Mantelperimeter» ersetzt werden, auf dem Varianten getestet werden können. Dies zielt auf die bisherige behördliche Praxis, nicht nur die Lage der Bauten, sondern auch deren Form und Nutzung zu diktieren. Della Casa räumt ein: «Der Kanton hat seine Rolle manchmal überinterpretiert. Unser Ziel ist nicht, im Städtebau und in der Stadtgestaltung die Hauptrolle zu spielen, sondern Regeln aufzustellen – etwa über die Bezüge zwischen Baufront und Strasse –, zwischen Privatgrund und öffentlichem Raum oder zwischen Erdgeschoss und Strasse, auf deren Basis die Planer ihr Projekt entwickeln und realisieren können.»[9]
Künftig soll das PLQ-Verfahren in vier Etappen unterteilt werden: In einer ersten Phase werden die Interessen der verschiedenen Akteure, namentlich der Grundbesitzer, geklärt. Es folgt eine Phase mit Machbarkeitsstudien, in der bereits zum ersten Mal die Vertreter der bewilligenden Amtsstellen zusammenkommen sollen, um technische Rahmenbedingungen und Hauptziele des PLQ herauszuschälen. Diese Phase soll das Verfahren wesentlich vereinfachen, denn «die 42 behördlichen Instanzen, die zu einem PLQ Stellung nehmen müssen, sollen das nicht mehr einzeln, eine nach der andern tun, sondern mehrere von ihnen werden zusammengerufen – je nach thematischer Prioritätensetzung die einen früher, die anderen etwas später. Das sollte uns erlauben, den Planungsgebieten einen deutlicheren Charakter zu geben und dann rasch eine Übereinstimmung zu erzielen», erklärt della Casa. Die beiden letzten Phasen betreffen die Koordination und die technische Umsetzung des Plans. Diese Änderungen sollen das Planungsverfahren stärker im konkreten städtischen und landschaftlichen Kontext verankern, den Architekturschaffenden mehr Freiheit bei der Ausarbeitung der Bauprojekte lassen und die architektonische Vielfalt fördern.
Die politische wie die fachliche Debatte werden gegenwärtig von der baulichen Verdichtung beherrscht. Die politische, weil das Volk nach einem Referendum zum erneuerten Gesetz über die Entwicklungszonen Stellung nehmen muss und dieses Gesetz für jede Zone Mindestausnützungsziffern in den PLQ einführen will. Die fachliche Debatte, weil diese Mindestausnützungsziffer nicht alle Fachleute überzeugt. Denn sie kommt zu der bereits im Zonenplan festgelegten Ausnützungsziffer hinzu und droht damit die Planung noch komplizierter zu machen, als sie jetzt schon ist. Und Baudirektor François Longchamp liess verlauten, die Idee stamme nicht von der Regierung, diese könne auch ohne sie leben.[10]
Das Scheibenhochhaus ist tot
Betrachtet man alle diese Gesetzes- und Verfahrensänderungen, zeichnet sich der Umriss einer neuen städtebaulichen Vision ab. Sie verwirft Teile der architektonischen Produktion der Nachkriegszeit und gliedert sich in den aktuellen Diskurs ein, der sich um die soziale und funktionelle Durchmischung, den öffentlichen Raum, Dichte und urbane Intensität, die gemeinsame Nutzung von Räumen und um typologische und formale Vielfalt dreht. «Vergleicht man Luftaufnahmen von Basel und von Genf, springt ein Unterschied ins Auge», erläutert della Casa. «Zwei relativ flache, von einem Fluss durchströmte Gegenden im selben Land – doch zwei ganz verschiedene Traditionen: Blockrandbebauung in Basel, Scheibenhochhäuser in Genf. Das vom Architekten Denis Honegger in Genf in der Nachkriegszeit perfektionierte System der Vorfabrikation von Hochhausscheiben aus Beton war so effizient, dass es alle anderen Formen verdrängen konnte.»
Der historische Bruch, den die Regierung in «Genève Envie» verkündet, vollzieht mit einigen Jahren Verspätung eine Entwicklung nach, die der an der ETH Lausanne lehrende französische Architekt und Architekturhistoriker Jacques Lucan in seinem Buch «Où va la ville aujourd’hui? Formes urbaines et mixités» beschreibt. Ausgehend von einer gründlichen Untersuchung der Erfahrungen, die in Frankreich seit den 1990er-Jahren mit den «Zones d’aménagement concertés» (ZAC) gemacht werden, zeigt er, dass sich aus den wichtigsten inhaltlichen Anliegen der Stadtentwicklung eine neue Art von Planungsverfahren entwickelt hat.[11] Hier finden sich Vokabular und Leitmotive der aktuellen Genfer Debatte wieder: soziale Durchmischung und funktionale Vielfalt, gemeinsame und flexible Nutzungen, Partnerschaft und Verhandlung zwischen Behörden und privaten Akteuren. Und wie in den jüngsten Genfer Planungen kommt die differenziert gestaltete offene Blockrandbebauung als Bauform zum Zug. Lucan bezieht sich dabei auf Bauten und Theorie des französischen Architekten Christian de Portzamparc. Ihm zufolge tritt die moderne europäische Stadt – nach dem 19. Jahrhundert mit geschlossener Blockrandbebauung und der klassischen Moderne mit frei im Raum stehenden Bauten – heute mit dem differenziert und individuell überbauten Block als prägender Bauform in ihre dritte historische Phase ein.[12]
Steht Genf vor diesem städtebaulichen Übergang? Politik und Architekturszene haben genug vom Scheibenhochhaus. Zwar ist der Richtplan 2030 nicht auf eine bestimmte architektonische Form angewiesen, doch scheint es in erster Linie um einen psychologischen Faktor zu gehen: Man sehnt sich nach neuen Formen, die den Aufbruch signalisieren, um den längst umfassend diskutierten Richtplan endlich umsetzen zu können. Den Mumm, aus dessen Prinzipien eigene Formen zu entwickeln, scheint man allerdings noch nicht gefunden zu haben und sucht deshalb Referenzen in der französischen Postmoderne.
Doch Zeichen des Aufbruchs gibt es viele: die Rede vom historischen Bruch, die Dringlichkeit, die Grossprojekten wie der Entwicklung des Gebiets Praille-Acacias-Vernets eingeräumt wird (Tec21 36/2011, S. 22), die Fortschritte beim Bau der S-Bahn CEVA (Tec21 36/2011, S. 27), die Aufmerksamkeit, die dem öffentlichen Raum zukommt, und der Eifer, den Bauvorstand François Longchamp bei der Erneuerung der Gesetze an den Tag legt. Vorerst eher kleine Projekte privater Akteure, bei denen das Vorgehen an neuere französische Quartierplanungen erinnert, bestärken die Hoffnung (vgl. S. 28). Doch der Nachholbedarf aus den vergangenen Jahrzehnten ist enorm und die Skepsis der Fachleute nach wie vor gross. Der einzige Weg, die «Envie» der Genferinnen und Genfer wieder zu wecken, ist wohl, die bisherige Übervorsichtigkeit aufzugeben, den Mut zum Fehlermachen zu finden und von einer Planungspraxis der Berichte, Studien und Pläne endlich zum Bauen und Ausprobieren überzugehen.
Anmerkungen:
[01] Informationen und Dokumente zum Richtplan 2030: http://etat.geneve.ch/dt/amenagement/projet_pdcn_2030-686-4369.html
[02] République et Canton de Genève: Genève Envie, Februar 2013. (PDF: http://etat.geneve.ch/geo-data/SIAMEN/PDCn/PDCn_CE_Brochure.pdf)
[03] République et Canton de Genève: Genève Envie, Februar 2013, S. 11.
4 Ebd. S. 8.
5 Ebd. S. 16.
6 Ebd. S. 20.
7 Ebd. S. 24.
[08] Loi générale sur les zones de développement industriel ou d’activités mixtes (LGZDI).
[09] Alle Aussagen von Kantonsarchitekt Francesco
della Casa stammen aus einem Gespräch mit Koautor Cedric van der Poel im August 2013 in Genf.
[10] «Décroître, pour une ville, c’est la mort» in: Le Temps, 18.7.2013.
[11] Jacques Lucan: Ou va la ville aujourd’hui? Formes urbaines et mixités. Paris 2012, S. 9.
[12] Christian de Portzamparc: «La ville âge III», Vortrag an den Conferences Paris d’architectes im Pavillon de l’Arsenal 1994. Les mini-PA, Nr. 5, Paris 1995, zit. nach Lucan, a .a. O., S. 43–46; vgl. auch Lucan, a. a. O., S. 45.
Für den Beitrag verantwortlich: TEC21
Ansprechpartner:in für diese Seite: Judit Solt